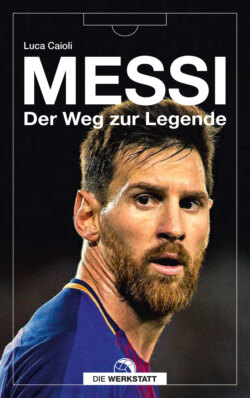Читать книгу Messi - Luca Caioli - Страница 5
ОглавлениеKapitel 2
Das Garibaldi-Krankenhaus
24. Juni 1987
Auf einem rechteckigen Grundstück in der Viasoro 1249 befindet sich ein cremefarbenes Gebäude, errichtet im Stil des 19. Jahrhunderts. Es ist das italienische Krankenhaus, und es ist Guiseppe Garibaldi gewidmet. In Rosario würdigt man diesen Mann auch noch mit einer Statue auf der Plaza de Italia. Er ist eine populäre Figur und als „Held zweier Welten“ bekannt, weil er nicht nur in Italien, sondern auch während seines Exils in Südamerika eine Reihe von Schlachten geschlagen hat, so am Flusslauf des Río Paraná. Dort haben seine Rothemden in jedem Ort, an den sie kamen, ihre Spuren hinterlassen, beispielsweise in den Namen von Krankenhäusern in Rosario und Buenos Aires. Diese wurden von politischen Exilanten, Anhängern Guiseppe Garibaldis und seines revolutionären Kollegen Guiseppe Mazzini, und ihren Arbeitergewerkschaften gegründet. Das Krankenhauses von Rosario wurde am 2. Oktober 1892 eingeweiht und sollte der italienischen Gemeinde dienen, die damals über 70 Prozent aller europäischen Einwanderer stellte. Heute verfügt es über eine der besten Entbindungsstationen der Stadt. An einem Wintermorgen um sechs Uhr früh beginnt hier die Geschichte Lionel Messis, des dritten Kindes der Familie Messi-Cuccittini.
Leos Vater Jorge ist 29 Jahre alt und Abteilungsleiter beim Stahlproduzenten Acindar in Villa Constitution, das etwa 50 Kilometer entfernt von Rosario liegt. Die 27-jährige Celia arbeitet in einem Betrieb, der Magneten herstellt. Sie haben sich in jungen Jahren im Viertel Las Heras kennengelernt, einem Viertel, das früher einmal als Estado de Israel bekannt war und das man heute als San-Martín-Viertel kennt. Die Menschen dort sind bescheiden und fleißig. Celias Vater Antonio ist Mechaniker und repariert Kühlschränke, Klimaanlagen und andere elektrische Geräte. Ihre Mutter, die ebenfalls Celia heißt, ist seit vielen Jahren als Putzfrau tätig. Jorges Vater Eusebio verdient auf dem Bau seine Brötchen, während seine Frau Rosa María wie Celia als Putzfrau arbeitet. Ihre Häuser liegen nicht viel mehr als hundert Meter voneinander entfernt. Wie viele Familien Rosarios haben auch sie italienische und spanische Vorfahren. Der Nachname Messi stammt aus der in der italienischen Provinz Macerata liegenden Stadt Porto Recanati, zu deren Söhnen auch der Dichter Giacomo Leopardi und der Tenor Beniamino Gigli zählen. Von dort aus machte sich Ende des 19. Jahrhunderts ein gewisser Angelo Messi auf den Weg an Bord eines der vielen Dampfer, die Richtung Amerika ablegten. Genau wie die vielen anderen Auswanderer, die dritter Klasse reisten, war auch er auf der Suche nach einem besseren Leben in der Neuen Welt. Die Cuccittinis stammen väterlicherseits ebenfalls aus Italien. Zunächst lebten die Familien in der feuchten Pampa, ließen sich aber schließlich in der Stadt nieder.
Rosario ist 305 Kilometer von Buenos Aires entfernt und hat etwa eine Million Einwohner. Die Stadt ist die größte in der Provinz Santa Fe und liegt am Ufer des Río Paraná. Entlang des Flusses zieht sich bis zur Brücke Nuestra Señora del Rosario die Costanera-Promenade. Die Brücke wiederum überquert den von Hochseeschiffen passierbaren Wasserlauf und die darin liegenden Inseln. Sie verbindet die Stadt mit der gegenüberliegenden Stadt Victoria. Der Río Paraná war schon immer eine wichtige Handelsstraße. Von hier aus werden eine Reihe landwirtschaftlicher Produkte in Südamerikas Mercosur-Wirtschaftszone exportiert – wie etwa Soja, das der Region in der jüngsten Vergangenheit einigen Wohlstand gebracht und das urbane Gefüge Rosarios verändert hat. Am feinen, vom Fluss aufgespülten Sandstrand sprießen neue Gebäude, Wolkenkratzer und atemberaubende Villen aus dem Boden. Aber immer noch bleibt Rosario die patriotische Stadt schlechthin. Am Sockel des monumentalen Flaggendenkmals reihen sich in Weiß gekleidete Schülergruppen für ein Foto auf. Das Denkmal ist im alten sowjetischen Stil gehalten und wurde 1957 eingeweiht. Es soll jene Stelle markieren, an der General Manuel Belgrano am 27. Februar 1812 zum ersten Mal das Hissen der Nationalflagge befahl.
Rosario ist eine Stadt der Enkelgeneration der Einwanderer, hier gibt es sowohl Slums als auch Landhäuser. Wir wollen uns jedoch nicht weiter mit Einwanderergeschichten und der Mischung aus Kulturen, Sprachen und Traditionen aufhalten, die es in Argentinien so reichlich gibt. Stattdessen wenden wir uns wieder Jorge und Celia zu, die sich schon früh ineinander verliebten und regelmäßig trafen.
Am 17. Juni 1978 schließlich heiraten sie in der Kirche Corazón de María. Das ganze Land liegt im Taumel der Weltmeisterschaft – die frisch Verheirateten planen ihre Hochzeitsreise nach Bariloche sogar extra so, dass sie auch ja nicht das in Rosario ausgetragene Spiel zwischen Argentinien und Brasilien verpassen. Endstand: null zu null. Acht Tage später schlägt César Luis Menottis argentinische Nationalmannschaft, bekannt als Albiceleste (wörtlich: die „Weiß-Himmelblaue“), im Finale, ausgetragen im Monumental-Stadion von River Plate in Buenos Aires, die Niederlande mit 3:1 und wird Weltmeister. Es folgt der kollektive Wahnsinn. Fillol, Olguín, Galván, Passarella, Tarantini, Ardiles, Gallego, Ortiz, Bertoni, Luque und Kempes scheinen jeden Gedanken an den Proceso de Reorganización Nacional, die Zeit der Militärregierung, zu vertreiben. Für einen Moment vergessen scheinen die getöteten Dissidenten und die mehr als 30.000 „Verschwundenen“ wie auch die Folter und der Terror der grausam-blutigen Militärdiktatur General Jorge Rafael Videlas, die mit dem Putsch gegen Isabel Perón am 24. März 1976 ihren Anfang nahm. Auf den Straßen von Buenos Aires kann man immer noch die Worte „Inmundo mundial“ – „schmutzige Welt(meisterschaft)“ – lesen, gepinselt unterhalb eines Fußballfeldes und der Inschrift „1978“.
Zwei Jahre nach dem Staatsstreich lastet die Terrorherrschaft nach wie vor auf dem Land, das Leben aber geht weiter. Celia und Jorge werden Eltern: Am 9. Februar 1980 kommt Rodrigo Martín zur Welt. Der zweite Sohn, Matías Horacio, wird in einer der dunkelsten Stunden Argentiniens geboren. Man schreibt den 25. Juni 1982. Elf Tage zuvor ist der Falklandkrieg zu Ende gegangen. Das besiegte Land zählt mehr als 649 Gefallene und über 1.000 Verwundete. Zu Letzteren muss man noch all diejenigen rechnen, die jene zweieinhalb „vom Feuerschein erhellten“ Monate ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden: junge, unerfahrene und schlecht ausgerüstete Männer, durch billigen Patriotismus zum freiwilligen Eintritt in die Armee verführt, um die 1833 von den Briten besetzten Falklandinseln zurückzuerobern. Operation Rosario, wie das von General Leopoldo Galtieri geführte argentinische Haupt-Landungsunternehmen am 2. April 1982 genannt wird, gehört zu den unzähligen Versuchen der Militärjunta, von den katastrophalen Wirkungen des 1980 verabschiedeten Wirtschaftsprogramms abzulenken. Die Finanzpolitik hat zu einer Inflation von 90 Prozent geführt, zu einer Rezession in allen Wirtschaftssektoren, zu einem Anstieg der Auslandsverschuldung von Privatunternehmen und Staat, zur Entwertung von Löhnen und Gehältern und vor allem zur fortschreitenden Verarmung der Mittelklasse (eine Besonderheit in der Geschichte Argentiniens, die im Vergleich zu anderen Staaten Lateinamerikas stark hervorsticht). Der Krieg sollte das Land die Dramen der Vergangenheit vergessen machen und das Volk auf einer Welle des Patriotismus tragen. Galtieri war allerdings nicht auf die „Eiserne Lady“ Margaret Thatcher vorbereitet, und die britische Armee hatte er ebenfalls nicht auf der Rechnung.
Im Verlauf weniger Wochen zermalmen britische Streitkräfte die argentinische Armee, was innerhalb nur eines Jahres zum Sturz der Militärjunta und schließlich in die Demokratie führt. Die Forderung nach Rückgabe der Malvinas, wie die Falklandinseln in Argentinien genannt werden, wird allerdings bestehen bleiben. Im Parque Nacional de la Bandera, dem „Nationalpark der Flagge“, hat man ein Monument zu Ehren der „auf den Malvinas lebenden Helden“ errichtet. In der Verfassung von 1994 wird die Rückgabe der Inseln zudem als ein unwiderrufliches Staatsziel aufgeführt. 1983 aber gewinnt Raúl Alfonsín die Wahlen. Er ist einer der wenigen Politiker, die sich von der Armee distanziert hatten und bei ihrer Meinung geblieben waren, dass das einzige Kriegsziel in der Stärkung der Diktatur bestand.
Als Celia vier Jahre später ihr drittes Kind erwartet, ist die Lage weiterhin dramatisch. In der Semana Santa, der Heiligen Woche, steht Argentinien am Rande eines Bürgerkriegs. Die carapintadas (wörtlich: „bemalte Gesichter“), eine Gruppe junger Armeeoffiziere unter der Führung von Aldo Rico, haben sich gegen die Regierung erhoben. Sie fordern ein Ende der Strafprozesse gegen Menschenrechtsverletzungen während des Militärregimes. Die Militärkommandanten verweigern sich dem Befehl des Präsidenten. Das Volk geht unterdessen zur Verteidigung der Demokratie auf die Straße, und die Zentralgewerkschaft Confederación General de Trabajo (CGT) ruft einen Generalstreik aus. Am 30. April wendet sich Raúl Alfonsín an die auf der Plaza des Mayo versammelten Menschen und spricht den Satz, der wegen seiner Realitätsferne in die Geschichte eingegangen ist: „Das Haus ist aufgeräumt. Frohe Ostern.“ Doch ohne Befehlsgewalt über die Streitkräfte ist der Präsident zu Verhandlungen mit den carapintadas gezwungen. Schließlich garantiert er ihnen ein Ende der Prozesse gegen das Militär. Das Gesetz der Obediencia Debida, das Befehlsnotstandsgesetz, verordnet Straffreiheit für Terrorhandlungen, die von Offizieren und ihren Untergegebenen begangen worden waren. Dies wird damit begründet, dass sie ja lediglich den Befehlen höherer Stellen Gehorsam geleistet hätten. Das Gesetz tritt am 23. Juni 1987 in Kraft. Am gleichen Tag kommt Celia auf die Entbindungsstation des Garibaldi-Krankenhauses. Die beiden Söhne – der siebenjährige Rodrigo und der fünfjährige Matías – bleiben daheim bei der Großmutter, während Jorge Celia in die Klinik begleitet. Eigentlich hätte er nach zwei Jungen gerne ein Mädchen gehabt, doch er soll einen weiteren Sohn bekommen. Die Schwangerschaft war ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, doch in den letzten Stunden kommt es zu Komplikationen. Gynäkologe Norberto Odetto diagnostiziert fetalen Stress und beschließt, zur Vermeidung langfristiger Schäden für das Baby die Geburt einzuleiten. Bis heute ist Jorge die Angst präsent, als der Doktor ihm mitteilte, die Geburtszange einsetzen zu müssen. Jorge bittet ihn, alles Erdenkliche zu tun, um dies zu vermeiden. Zu sehr haben ihm die Horrorgeschichten über Deformationen und Schäden, die diese an Neugeborenen anrichten kann, zugesetzt. Am Ende ist der Einsatz der Geburtszange dann doch nicht erforderlich. Um kurz vor sechs Uhr morgens wird Lionel Andrés Messi geboren. Er wiegt drei Kilogramm und ist 47 Zentimeter groß, rot wie eine Tomate und hat ein vollständig eingefaltetes Ohr – kleinere Unregelmäßigkeiten, die aber wie bei so vielen Neugeborenen bereits im Laufe der ersten Stunden verschwinden. Nach dem Schock folgt die Freude: Der Neuankömmling ist rosig und gesund.
Außerhalb der Krankenhausmauern ist die Lage deutlich weniger entspannt. In der Stadt ist eine Bombe explodiert, eine weitere in Villa Constitución, wo Jorge arbeitet. In ganz Argentinien gehen schließlich als Reaktion auf das Befehlsnotstandsgesetz fünfzehn Sprengsätze in die Luft. Es gibt zwar nur Sachschäden, die Bomben zeigen aber, wie gespalten das Land ist, wie überfordert mit der Macht der Armee. Zudem steckt es mitten in einer schweren Wirtschaftskrise: Der Minister für den Binnenhandel hat gerade Preissteigerungen für die Grundversorgung angekündigt. Milch und Eier sollen sich um neun Prozent verteuern, Zucker und Getreide um zwölf Prozent, Strom um zehn und Gas um acht Prozent – schwer zu verkraftende Erhöhungen für Arbeiterfamilien wie die Messi-Cuccittinis, auch wenn sie sich auf zwei Einkommen und einen Immobilienbesitz stützen können. Mit Hilfe seines Vaters Eusebio hat Jorge ihr Haus über viele Wochenenden auf einem 300 Quadratmeter großen Familiengrundstück selbst errichtet. Es ist ein zweigeschossiger, im Viertel Las Heras befindlicher Ziegelbau mit einem Hof zum Spielen für die Kinder. Nachdem Mutter und Sohn aus dem italienischen Krankenhaus entlassen worden sind, trifft Lionel am 26. Juni dort ein.
In einem Fotoalbum der Familie ist Lionel mit sechs Monaten zu sehen: Mit Pausbäckchen und einem Lächeln im Gesicht, in kleinen blauen Hosen und einem weißen T-Shirt liegt er auf dem Bett seiner Eltern. Mit zehn Monaten fängt er an, seinen großen Brüdern hinterherzujagen. Und er hat seinen ersten Unfall. Leo läuft plötzlich aus dem Haus – niemand weiß, warum. Vielleicht will er mit den anderen Kindern auf der noch ungeteerten Straße spielen, die nur selten von Autos befahren wird. Doch ein vorbeikommender Fahrradfahrer fährt ihn an. Er brüllt wie am Spieß, und alle im Haus rennen auf die Straße. Zunächst scheint es nur der Schrecken gewesen zu sein. Doch er hört die ganze Nacht nicht auf zu jammern, und sein linker Arm ist angeschwollen. Man bringt ihn ins Krankenhaus, wo ein Ellenbogenbruch festgestellt wird. Leo bekommt einen Gipsverband, und der Bruch heilt innerhalb weniger Wochen. Zu seinem ersten Geburtstag kaufen ihm seine Tanten und Onkels ein Fuß-balltrikot, um ihn schon jetzt zu einem Fan seines zukünftigen Vereins zu machen – den Newell’s Old Boys. Doch noch ist es zu früh dafür. Mit drei Jahren mag Leo lieber Bilderkarten und viel kleinere Kugeln – und zwar Murmeln. Er gewinnt sie in Massen von seinen Spielkameraden und trägt stets ein volles Säckchen davon herum. Im Kindergarten oder in der Schule hat man immer Zeit, mit runden Gegenständen zu spielen. Zu seinem vierten Geburtstag schenken ihm seine Eltern einen weißen Ball mit roten Rauten. Vielleicht ist das der Beginn seiner Liebe zum Ball. Eines Tages bringt er schließlich alle zum Staunen. Sein Vater kickt mit den Brüdern auf der Straße, und Leo entschließt sich zum ersten Mal zum Mitmachen. Oftmals war er lieber Murmeln gewinnen gegangen – dieses Mal jedoch kommt es anders. „Wir waren überwältigt, als wir sahen, was er alles konnte“, sagt Jorge. „Er hatte vorher noch nie gespielt.“