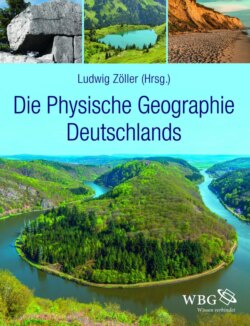Читать книгу Die Physische Geographie Deutschlands - Ludwig Zöller - Страница 8
Оглавление1 Die Abgrenzung Mitteleuropas
Mit dem Aufkommen der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert gewann der Begriff „Mitte“ bzw. „Mitteleuropa“ an Bedeutung, denn damit war ein Anspruch an Macht und Wichtigkeit verbunden. Die Wiederbelebung der „Mitteleuropa“-Diskussion zu Beginn der 1990er-Jahre hat verschiedene Autoren, darunter Schultz (1997) und Fassmann & Wardenga (1999), animiert, sich damit zu beschäftigen. Diese Arbeiten beleuchten auch die historische Entwicklung des Mitteleuropabegriffes und wie unter gegebenen Machtansprüchen und Paradigmen „Räume gemacht“ werden. Diese Veröffentlichungen seien zur weiteren Vertiefung in dieses disziplingeschichtlich aufschlussreiche und bedeutsame Thema empfohlen. Von Interesse für die Geomorphologie ist, dass auch der durch seine glazialgeomorphologischen Arbeiten im Alpenvorland (Tetraglazialismus) so bedeutsam gewordene Albrecht Penck sich 1915 dazu äußerte. Er unterschied Vorder-, Zwischen- und Hintereuropa. Zu Vordereuropa gehören nach Penck außer Norwegen und den Britischen Inseln alle Gebiete Europas westlich einer Linie etwa von Dünkirchen (Dunkerque) nach Hyères (Côte d’Azur). Zwischeneuropa grenzt östlich an Vordereuropa an, schließt dabei wie selbstverständlich Elsass-Lothringen ein, aber auch Korsika und Sardinien und endet erst an der Westküste des Schwarzen Meeres. Die Grenze zu Hintereuropa bilden eine Linie etwa von östlich Odessa bis westlich Sankt Petersburg sowie die Ostgrenze von Finnland und der Halbinsel Kola. Interessant bzw. erschreckend ist, dass der von Penck für diese Ostgrenze gebrauchte Begriff des „warägischen Grenzsaums“ im Dokument „Der Reichsführer SS, SS-Hauptamt – Sicherung Europas – Der zweite Weltkrieg – eine weltanschauliche Auseinandersetzung“ zur Rechtfertigung der Aggression des Dritten Reiches auftaucht (www.archive.org).
Ebenso wenig wie politische Grenzen zur physisch-geographischen Abgrenzung Mitteleuropas geeignet sind, dürfen physisch-geographische Grenzen oder Grenzsäume als Rechtfertigung für die Forderung nach Verschiebung staatlicher Grenzen missbraucht werden, wie in der Vergangenheit geschehen. Davon wird hiermit endgültig Abstand genommen zugunsten der Suche nach geeigneten physisch-geographischen Kriterien.
1.1 Geomorphologische Kriterien
In dem umfangreichen Buch „Geomorphology of Europe“ (Embleton 1984) werden verschiedene Ansätze zur geologisch-geomorphologischen Gliederung Europas vorgestellt, darunter geomorphologische Regionen Europas, morphotektonische Regionen, Kratone und präkambrische Faltung, herzynische (variszische) Strukturen, Megamorphostrukturen und Relieftypen. Keine der kartographischen Darstellungen lässt erkennen, dass ein einziges Kriterium zur Abgrenzung Mitteleuropas ausreicht. Bei den Megamorphostrukturen bieten sich „junge orogenetische Zonen“ als südliche Abgrenzung an, während die Relieftypen völlig ungeeignet für die gesuchte Abgrenzung erscheinen. Bei den variszischen Srukturen könnte die „pre-Hercynian platform“ im Nordosten tauglich sein, allerdings setzt sie sich in Norddeutschland unter mächtigerer känozoischer Bedeckung deutlich südlich der Ost- und Nordseeküste gegen Westen fort. Deutlicher tritt die mögliche Nordostbegrenzung bei den Kratonen hervor (s.u.). Sie bildet auch bei den morphotektonischen Regionen die Westgrenze der Russischen Tafel ab, während die alpinen Faltengebirge der Alpen und der Karpaten die schon bei den Megamorphostrukturen genannte mögliche Südgrenze nachzeichnen. Völlig offen beibt aber die Abgrenzung Mitteleuropas nach Westen bzw. Südwesten.
Neef (1956, S. 35) hat bereits die Probleme einer Abgrenzung Mitteleuropas benannt und sein Vorschlag muss besonders unter dem Gesichtspunkt der „Übergangsgebiete“ hier erwähnt werden. „Mitteleuropa … ist … das Mittelglied zwischen dem maritimen Westen Europas und dem kontinentalen Osten, zwischen dem wärmeren Süden und dem kühleren Norden. Es ist also ein ausgesprochenes Übergangsgebiet und weist außerdem eine eigentümliche Dreigliederung des Reliefs in Tiefland, Mittelgebirge und Hochgebirge auf … Die Abgrenzung Mitteleuropas gegen das übrige Europa ist nicht einfach und wird in der Literatur auch nicht einheitlich vorgenommen. Auf fast allen Seiten leiten mehr oder weniger breite Übergangsgebiete zu den anderen Teilen des Kontinentes hin, ohne dass sich eine einigermaßen deutliche Grenze erkennen lässt. Etwas klarer liegen die Verhältnisse nur im Norden. Hier bilden die Küsten von Nord- und Ostsee die Begrenzung des mitteleuropäischen Raumes. Dänemark, das mit seiner skandinavischen Bevölkerung eng mit Schweden und Norwegen verbunden ist, gehört seiner Natur nach eindeutig zu Mitteleuropa. Im Süden rechnet man allgemein den größten Teil der Alpen noch Mitteleuropa zu. Für die westliche Abgrenzung Mitteleuropas gilt allgemein, dass die physisch-geographische Grenze zwischen Mittel- und Westeuropa auf den Höhen des Schweizer Juras und der Vogesen, dann am Südrand der Ardennen und dann über die Schwelle von Artois verläuft. Am schwierigsten lässt sich die Grenze im Osten finden, da hier der mitteleuropäische Tieflandsstreifen ganz unmerklich in die Osteuropäische Tiefebene übergeht. Die in diesem Buch getroffene Lösung, Osteuropa an der Staatsgrenze zur Sowjetunion beginnen zu lassen, ist nicht die einzig mögliche.“
1.2 Geologische Kriterien
In seinem Buch „Geologie von Mitteleuropa“ hat Walther (1995) eine Abgrenzung Mitteleuropas vorgenommen (Abb. 1.1), die in großen Teilen mit der von Neef (1956) übereinstimmt, teilweise aber auch abweicht (Begrenzung nach Süden und Nordosten).
Im Nordosten nimmt Walther die Tornquist-Teisseyre-Zone als Abgrenzung Mitteleuropas. Diese Zone verläuft vom Nordostrand der Karpaten und des Polnischen Mittelgebirges in Südost-Nordwest-Erstreckung quer durch Polen und das Ostseebecken bis zur Nordspitze Jütlands (Dänemark). Die Tornquist-Teisseyre-Zone stellt die Nordostbegrenzung der variszisch geprägten Kruste Mitteleuropas gegen den präkambrischen und kaledonischen Baltischen Schild und den Untergrund der Russischen Tafel dar. An der Oberfläche ist die Tornquist-Teisseyre-Zone kaum oder gar nicht zu erkennen, aber inzwischen vor allem durch verbesserte seismische Methoden sehr gut bekannt.
Im Norden kann für die festländischen Teile der Abgrenzung von Neef gefolgt werden. Für hochglaziale Zeiten mit glazialeustatischem Trockenfallen fast der gesamten Nordsee wäre die Nordgrenze Mitteleuropas neu zu diskutieren, worauf hier aber verzichtet werden kann.
Eine zumindest für Geographen überraschende Abweichung der Süd-Grenze Mitteleuropas nach Walther gegenüber Neef ergibt sich für die Zugehörigkeit der Alpen. Walther zieht diese Grenze an der Überschiebung der Decken des alpidischen Systems über die variszisch geprägte Kruste einschließlich ihrer Molassebecken, das heißt an den geomorphologischen Nordrand der Alpen und der Karpaten. Nach Walther verbleiben das Mitteleuropäische Bruchschollengebiet und die nördlich anschließende Mitteleuropäische Senke als Hauptbestandteile Mitteleuropas aus geologischer Sicht.
Abb. 1.1 Mitteleuropa aus geologischer Sicht (aus Walter 1995).
Die Westbegrenzung Mitteleuropas nach Walther fällt praktisch mit der nach Neef zusammen. Geologisch schließt im Westen das Pariser Becken an. Sein scheinbar nach Osten bzw. Nordosten gerichteter zweifacher Sporn in Form der Zweibrücker Mulde und der Trier-Bitburger Mulde täuscht, denn das Pariser Becken begann erst seit dem Jura abzusinken, wohingegen Trias-Sedimente zwischen der Metternicher Bucht und der Trierer Bucht im Bereich der schon devonisch angelegten Eifeler Nord-Süd-Zone und Trias-Sedimente der Zweibrücker Mulde bzw. Pfälzer Mulde einer spätvariszisch angelegten Struktur folgen.
Aus geologischer Sicht lässt sich für eine Abgrenzung Mitteleuropas folgendes Fazit ziehen:
▷ Eine Abgrenzung von Mitteleuropa nach dem tektonischen Bau ist sinnvoll.
▷ Im Westen ist es die Linie Artois – Ardennenwestrand – Vogesen – Schweizer Jura,
▷ im Süden der Nordrand von Alpen und Karpaten,
▷ im Osten bzw. Nordosten die Tornquist-Teysseire-Linie,
▷ und im Norden sind es Skagerak und Ostsee sowie Nordsee.
Daraus folgt fur die kanozoische (und landschaftspragende) Tektonik in Mitteleuropa:
▷ Es handelt sich ausschlieslich um Intraplattentektonik.
▷ Der Aufbau ist grostenteils variszisch (mit einzelnen eingearbeiteten alteren Massiven), im Norden kaledonisch und alter.
▷ Es stellt sich die Frage, ob der inhomogene Krustenaufbau Einfluss auf die endogene Formung in der Neotektonik hat.
Dieses Buch folgt weitestgehend der Abgrenzung durch Walter, weil diese als einzige der diskutierten Möglichkeiten konsistent ist. Allerdings muss die Geomorphologie auch Fernwirkungen vor allem von Hochgebirgen einbeziehen. Das nördliche Alpenvorland zum Beispiel mit seinen lehrbuchhaften Vergletscherungsspuren ist nicht erklärbar ohne Berücksichtigung der Alpen. Fernwirkungen betreffen noch mehr die Klimatologie, in der die Alpen als „Wetterküche Europas“ gelten. Deshalb endet der räumliche Bezug dieses Buches nicht abrupt am Nordrand der Alpen. Für umfassendere Darstellungen der Alpen muss allerdings auf einschlägige neuere Literatur verwiesen werden wie Veit (2002) und Pfiffner (2010/2015).