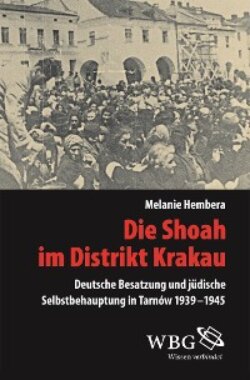Читать книгу Die Shoah im Distrikt Krakau - Melanie Hembera - Страница 10
Ziel und Aufbau der Studie
ОглавлениеThema dieser Studie ist die Frage nach dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Tarnów unter nationalsozialistischer Besatzung. Die Stadt soll einer grundlegenden lokalgeschichtlichen Analyse in Bezug auf die nationalsozialistische „Judenpolitik“ unterzogen werden. Allerdings geht es dabei nicht nur um eine Darstellung des Handelns und Verhaltens der Täter vor Ort. In jedem Stadium der nationalsozialistischen Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung wird auch die Perspektive der Opfer berücksichtigt, deren Lebensbedingungen, Verhalten, Reaktionen und konkrete Handlungsspielräume werden analysiert. Die Studie intendiert demzufolge, die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Tarnóws unter nationalsozialistischer Besatzung aus einer multiperspektivischen Sicht auszuleuchten.
Die Arbeit folgt dabei einem zu großen Teilen diachronen Aufbau, der sich an den Phasen der Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Tarnóws orientiert. Der zeitliche Fokus umfasst die Zeit vom deutschen Überfall auf Polen im September 1939 bis Februar 1944, als die letzten Juden aus Tarnów deportiert wurden. Allerdings erscheint es darüber hinaus sinnvoll, auch auf die Vor- und Nachgeschichte einzugehen. Die Analyse des Schicksals der jüdischen Bevölkerung unter NS-Besatzung bildet den Hauptteil der vorliegenden Untersuchung, der in zwei große Teile gegliedert ist: Der erste Teil behandelt die Phase ab dem deutschen Einmarsch bis zum Beginn des systematischen Genozids an der jüdischen Bevölkerung. Im Zentrum des zweiten Teils steht sowohl das Ghetto also auch die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Tarnóws im Rahmen der „Aktion Reinhard“.
Daraus ergibt sich für die vorliegende Arbeit folgender Aufbau: In dem der Einleitung folgenden ersten Kapitel wird zunächst das jüdische Leben in Tarnów vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zur Besetzung der Stadt im September 1939 dargestellt. Welche Bedeutung nahm die jüdische Bevölkerung im dortigen Leben ein? Wie gestaltete sich deren Gemeindeleben? Und schließlich: In welcher Beziehung standen Juden und Christen in der Vorkriegszeit? Im darauffolgenden Unterkapitel wird die Etablierung der „neuen“, nationalsozialistischen Ordnung in Tarnów beschrieben. Diesem folgt eine Darstellung des Besatzungsapparats sowohl für die Distriktebene als auch für Tarnów. Diese Analyse liefert den biographisch-institutionellen Hintergrund für das Nachfolgende.
Die Phase der allmählichen Radikalisierung der nationalsozialistischen „Judenpolitik“ bis unmittelbar vor Beginn der „Aktion Reinhard“ steht im Zentrum des zweiten Kapitels. Zunächst wird ein allgemeiner Überblick über die nationalsozialistische Politik gegeben, die seit dem Einmarsch der Deutschen in Polen gegenüber der jüdischen Bevölkerung praktiziert wurde. Im Anschluss erfolgt eine Rekonstruktion der in Tarnów realisierten antijüdischen Entrechtungs- und Verfolgungsschritte, wobei der Fokus zunächst auf den von der Zivilverwaltung betriebenen Maßnahmen liegt. Jenseits der von der Kreishauptmannschaft erlassenen NS-Verordnungen entwickelte sich seit September 1939 eine Eigendynamik der Gewalt gegenüber den jüdischen Einwohnern, was in einem separaten Unterkapitel behandelt wird. Die Betrachtungsebene der Täter wird anschließend durch die Perspektive der jüdischen Bevölkerung durchbrochen und erweitert. Zunächst erfolgt eine Analyse der jüdischen Bevölkerungsentwicklung in Tarnów, die angesichts des Kriegs einer massiven Veränderung unterlag. Nachfolgend werden die einzelnen jüdischen Institutionen, die im Rahmen der „Selbstverwaltung“ agierten, dargestellt und deren genaue Tätigkeit näher beleuchtet. Im darauffolgenden Unterkapitel wird jüdisches Leben im Angesicht der seit September 1939 forcierten nationalsozialistischen „Judenpolitik“ untersucht. Wie gestaltete sich die Situation unter deutscher Besatzung für die Menschen konkret? Mit welchen Problemen war die einfache jüdische Bevölkerung im Zuge der fortschreitenden NS-Maßnahmen konfrontiert? Existierten Wege, sich einzelnen Verordnungen zu entziehen?
Die Phase der systematischen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Tarnów im Zuge der „Aktion Reinhard“ wird im dritten Kapitel beleuchtet. Zunächst allerdings wird die Entscheidungsbildung zur „Aktion Reinhard“ sowie das Personal, die Organisation und der Verlauf der Mordkampagnen im Distrikt Krakau nachgezeichnet. Diese Rekonstruktion erscheint notwendig, liefert sie doch den makrohistorischen Hintergrund für die folgenden Kapitel. Danach wird die NS-Vernichtungspolitik in Tarnów rekonstruiert. Dabei werden nicht nur die einzelnen Mordkampagnen und die Ghettobildung nachgezeichnet, sondern es wird auch ein spezielles Augenmerk auf die Täter und die durch sie verübten Verbrechen gerichtet.
Anschließend wird die Perspektive der jüdischen Bevölkerung eingenommen, indem das Ghetto aus dessen Innenansicht beleuchtet wird. Der Begriff des „Ghettos“ war und ist, wie der israelische Historiker Dan Michman aufzeigte, keineswegs immer eindeutig konnotiert und unterlag zudem im zeitlichen Verlauf einem steten Wandel.66 Im Nationalsozialismus definierte sich der Begriff primär durch die Sprache, der ein Gebiet als „Wohngebiet der Juden“, „Jüdisches Wohnviertel“ oder eben als Ghetto umschrieb.67 In der vorliegenden Arbeit wird auf die Definition von Martin Dean, Herausgeber der „United States Holocaust Memorial Museums Encyclopedia of Camps and Ghettos“, zurückgegriffen: Er charakterisiert ein Ghetto als einen abgetrennten Bezirk, in welchem die Juden auf Befehl der Deutschen konzentriert wurden. In diesem Bereich durften lediglich Juden leben; nichtjüdischen Menschen war dies nicht gestattet.68 Als weiteres Kriterium sei ergänzt, dass es der jüdischen Bevölkerung unter Strafandrohung verboten war, das Ghetto ohne Erlaubnis der Deutschen zu verlassen.
Im Zentrum des Kapitels über das Ghetto stehen Fragen nach den konkreten Lebensbedingungen der eingeschlossenen Menschen. Von besonderem Interesse ist hierbei die Frage, auf welche Weise sich deren Alltag gestaltete. Welcher Arbeit gingen die Ghettoinsassen nach? Wie gelangten sie an Waren des täglichen Bedarfs? Und schließlich: Welche Überlebensstrategien wurden entwickelt, um der Vernichtung entkommen zu können? Das dritte Kapitel schließt mit einer Beschreibung der Ghettoliquidierung, die im September 1943 realisiert wurde.
Das vierte Kapitel widmet sich der unmittelbaren Nachkriegszeit. Zunächst geht es um die Frage, auf welche Weise versucht wurde, jüdisches Leben nach der Shoah in der Stadt zu reaktivieren. Im Zentrum des zweiten Teils steht die justizielle Ahndung der NS-Verbrechen, die an der jüdischen Bevölkerung begangen wurden.