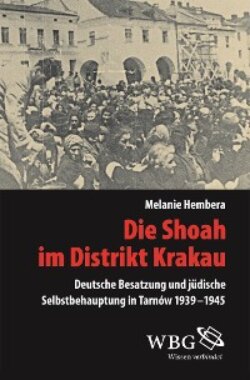Читать книгу Die Shoah im Distrikt Krakau - Melanie Hembera - Страница 17
1.2.3 Der deutsche Besatzungsapparat
ОглавлениеNach der Etablierung des Generalgouvernements bestand der deutsche Besatzungsapparat aus drei Institutionen: Der Zivilverwaltung, dem SS-und Polizeiapparat sowie der Wehrmacht. Letztere hatte im Generalgouvernement die geringsten Handlungsbefugnisse, da die Ablösung der Militärverwaltung mit einem starken Kompetenzverlust der Wehrmacht einherging. In der Folgezeit konnte sich diese durch die Übernahme zahlreicher Rüstungsbetriebe in wirtschaftlicher Hinsicht jedoch eine wichtige Stellung sichern.67
Der zivile Verwaltungsapparat war nach dem Muster der deutschen Verwaltung im klassischen Sinne aufgebaut. Unterhalb der Organe der deutschen Zivilverwaltung existierte darüber hinaus eine polnische Selbstverwaltung mit Gemeindevorstehern (Wójts) und Bürgermeistern in kleineren Städten sowie Dorfschulzen (Sołtys). Der deutsche zivile Verwaltungsapparat war demnach eine Mischform aus einer Regierungsverwaltung und einer Kolonialverwaltung.68 Adolf Hitler ernannte den Juristen Hans Frank zum Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete, der fortan die höchste zivile Instanz auf Verwaltungsebene bilden sollte. Franks zentrale Behörde war das Amt des Generalgouverneurs in Krakau69, das im Wawel, dem alten polnischen Königsschloss, eingerichtet wurde. Als Franks Stellvertreter amtierte zunächst Arthur Seyß-Inquart. Nach dessen Ernennung zum Reichskommissar für die besetzten Niederlande im Mai 1940 folgte Josef Bühler.70 Dieser hatte als langjähriger Mitarbeiter Franks die Leitung des Amts des Generalgouverneurs bis zum Ende der deutschen Besatzung in Polen inne. Bühlers Aufgabe bestand darin, die unterschiedlichen Behörden dieses Amts zu leiten und zu koordinieren. Als oberste Instanz im Generalgouvernement war die Regierung allein befugt, Rechtsverordnungen zu erlassen.71 Insgesamt setzte sich die Regierung aus zwölf Hauptabteilungen zusammen, die sich an der Ressorteinteilung des Reiches orientierten72: Innere Verwaltung, Justiz, Finanzen, Wirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft, Forsten, Arbeit, Propaganda, Wissenschaft und Unterricht, Bauwesen, Eisenbahnen und Post. Daneben bestand die Regierung aus dem Staatssekretariat, das sich in folgende Ämter gliederte: Amt für Außenhandel, Kanzlei des Generalgouverneurs, Regierungskanzlei, Amt für Gesetzgebung, Amt für Preisbildung, Amt für Raumordnung, Personalamt, Betriebsamt und Direktion der Archive des Generalgouvernements. Die einzelnen Hauptabteilungen waren wiederum in Abteilungen, Unterabteilungen, Hauptreferate und Referate unterteilt.73
Für die jeweiligen Verwaltungen der Distrikte bildete die erste Verordnung über den Aufbau der Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete vom 26. Oktober 1939 die Rechtsgrundlage. Demnach stand an der Spitze eines Distrikts ein Distriktchef, ab 25. September 1941 der Gouverneur des Distrikts. Dessen Aufgabe war es, die gesamte Verwaltungstätigkeit im Namen des Generalgouverneurs innerhalb des Distrikts zu leiten. Der Gouverneur war dem Generalgouverneur sowie dem Chef der Regierung persönlich unterstellt. Die für ihn bindenden Verwaltungsrichtlinien erhielt er von der Regierung des Generalgouvernements. Die zentrale Behörde des Gouverneurs stellte das Amt des Gouverneurs dar, das von einem Chef des Amts, der zeitgleich der Stellvertreter des Gouverneurs war, geleitet wurde. Gegliedert war es in mehrere Fachabteilungen, die wiederum aus Unterabteilungen und Referaten bestanden.74 Verglichen mit einem preußischen Regierungspräsidenten verfügte der Gouverneur über einen umfangreicheren Zuständigkeitsbereich sowie einen größeren Verwaltungsbezirk. Generell war er in Personalunion für seinen Distrikt der Hoheitsträger der NSDAP. Darüber hinaus übte er Funktionen in diversen Institutionen, wie beispielsweise in den Wohnungs- und Siedlungsgesellschaften oder den Wirtschaftskammern innerhalb des Distrikts aus. Auch besaß er maßgebliche Zuständigkeiten im Gnadenrecht. So konnte er im Falle von Juden, die aufgrund des Verlassens des Ghettos zum Tode verurteilt worden waren, als letzte Instanz über die Ablehnung des Gnadengesuchs entscheiden. Wurde das Gesuch befürwortet, musste eine Entscheidung des Generalgouverneurs erwirkt werden. Nominell hatten die Gouverneure alle administrativen und ökonomischen Kompetenzen in ihren Machtbereichen inne.75
Im Distrikt Krakau amtierten während der annähernd fünfjährigen deutschen Besatzung insgesamt vier Distriktchefs (Gouverneure).76 Ihr Lebensweg wies einige Parallelen auf. Sie alle waren Juristen und bereits frühzeitig in rechtsnationalen Kreisen aktiv. Der erste, der die Position des Distriktchefs besetzte, war seit 7. November 1939 der promovierte Jurist Otto Wächter. Am 8. Juli 1901 in Wien geboren, war er bereits in jungen Jahren in diversen rechtsnationalen Kreisen aktiv. Von 1919 bis 1922 war er Mitglied im Freikorps „Deutsche Wehr“, im Folgejahr trat Wächter der Wiener Sturmabteilung (SA) bei. 1930 wurde er Mitglied der NSDAP, 1931 ernannte man Wächter im Range eines SS-Gruppenführers zum Bezirksleiter Innere Stadt in Wien; anschließend war er dort Gauamtsleiter sowie Hauptschulungsleiter in der Landesleitung Österreich der NSDAP. 1934 nahm Wächter am Juliputsch teil, ein Jahr später erfolgte sein Eintritt in die Schutzstaffel (SS). Nach dem „Anschluss“ Österreichs wurde er Chef der Inneren Verwaltung. Im Zuge des deutschen Besatzungsaufbaus in Polen wurde Otto Wächter am 7. November 1939 zum Gouverneur des Distrikts Krakau ernannt. Er bekleidete dieses Amt bis Anfang 1942, anschließend wechselte er in den Distrikt Galizien.77
Abgelöst wurde Wächter von Richard Wendler, der ein Verwandter Heinrich Himmlers war. Der am 22. Januar 1898 in Oberdorf geborene Wendler besuchte zunächst ein humanistisches Gymnasium in München. Nach dem Abitur leistete er von 1916 bis 1919 Kriegsdienst, in der Folgezeit war er in mehreren Freikorps aktiv. Wendler studierte Rechts- und Staatswissenschaften in München und legte 1925 die große juristische Staatsprüfung ab. Wie Wächter war auch Wendler bereits in frühen Jahren in der NSDAP, SA und der SS aktiv: 1928 war er der NSDAP und der SA, am 1. April 1933 der SS beigetreten. Im Oktober 1933 wurde er zum Oberbürgermeister von Hof ernannt. Nach dem deutschen Überfall auf Polen meldete sich Wendler freiwillig für den Dienst in der Besatzungsverwaltung, wo er in der Folgezeit diverse Ämter an unterschiedlichen Standorten bekleidete. Zunächst war er Stadtkommissar in Kielce, ab 1. November 1939 Stadthauptmann in Tschenstochau, anschließend Stadthauptmann in Radom. Mitte Februar 1942 trat Richard Wendler schließlich das Amt des Gouverneurs im Distrikt Krakau an.78
Wendlers Nachfolger wurde Ende Mai 1943 Ludwig Losacker. Am 29. Juli 1906 in Mannheim geboren, nahm Losacker nach dem im zweiten Bildungsweg erworbenen Abitur ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Heidelberg auf. Dort gehörte er der NSDAP-Studentengruppe an und beteiligte sich aktiv an den Kampagnen gegen den jüdischen Universitätsprofessor Emil Julius Gumbel. Seit dem 1. Dezember 1931 war er Mitglied der NSDAP, am 1. Juni 1933 trat er der SS bei. Nachdem er im Jahr 1933 promoviert hatte, legte Losacker im Folgejahr die zweite große juristische Staatsprüfung ab. Von 1934 bis 1936 war er als Regierungsassessor bei der Polizeidirektion in Baden-Baden tätig. Nachdem er 1937 ein Praktikum bei der I.G. Farben absolviert hatte, wurde er im Dezember 1938 bei den Wanderer-Werken beschäftigt und war in Chemnitz als Rechtsanwalt tätig. Kurze Zeit nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, Anfang Oktober 1939, begab sich Losacker freiwillig in das besetzte Polen. Er war zunächst Landkommissar in Jaslo, anschließend wurde er zum Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD (KdS) in Krakau abkommandiert, im Dezember 1940 übernahm er die Leitung der Kreishauptmannschaft in Jaslo. Ab Mitte Januar 1941 war er Amtschef im Distrikt Lublin, ab 1. August 1941 Amtschef im Distrikt Galizien. Von 1. Januar 1943 bis Oktober 1943 übernahm Losacker die Leitung der Hauptabteilung Innere Verwaltung in der Regierung des Generalgouvernements. Am 25. Mai 1943 erfolgte seine Ernennung zum kommissarischen Gouverneur des Distrikts Krakau.79 Losacker war ein überzeugter Nationalsozialist und Antisemit. Als die systematische Ermordung der Juden im gesamten Generalgouvernement ihren Höhepunkt erreichte, betonte er auf einer Polizeisitzung am 18. Juni 1942, dass „[v]or allem dafür gesorgt werden müsse, daß die Juden entfernt würden“.80
Der letzte amtierende Gouverneur im Distrikt Krakau war der am 16. Dezember 1886 in Chemnitz geborene Kurt Ludwig Ehrenreich von Burgsdorff. Nach dem Besuch eines humanistischen Gymnasiums studierte er Rechts- und Staatswissenschaften in Dresden, Freiburg und Leipzig. 1910 war von Burgsdorff als Verwaltungsbeamter in Sachsen tätig. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Offizier teil, danach übte er die Stellung eines Regierungsamtmanns in Sachsen aus. Von 1928 bis 1933 war er Amtshauptmann in Löbau/Sachsen. Von Burgsdorff, Gründungsmitglied der Deutschnationalen Volkspartei, trat am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein. Am 1. Oktober 1933 wurde er zum Ministerialdirektor im sächsischen Innenministerium befördert. 1938 kam er als Vertreter des Innenministeriums zum Reichsstatthalter in Wien, Arthur Seyß-Inquart. Im März 1939 erfolgte seine Ernennung zum Stabschef des CdZ in Mähren, wo er als Ministerialdirektor beim Reichsprotektor tätig war. Anfang April 1942 wurde von Burgsdorff aufgrund von Differenzen mit Heydrich zur Wehrmacht abkommandiert. Ab November 1943 bekleidete er schließlich das Amt des Gouverneurs im Distrikt Krakau.81
Die unterste Stufe des dreistufigen Verwaltungsaufbaus im Generalgouvernement stellten die einzelnen Kreis- und Stadthauptmannschaften in den jeweiligen Distrikten dar. An der Spitze der Kreise und Städte standen die Kreis- beziehungsweise Stadthauptmänner.82 Zu Beginn ihrer Tätigkeit existierte für diese keine einheitliche Verwaltungsorganisation. Es stand in ihrem Ermessen, wie sie ihre Dienststelle in organisatorischer Hinsicht gestalteten. Zunächst verfügten die ins Generalgouvernement abkommandierten Kreishauptleute nur über wenig Personal, was sich auch bis Frühjahr 1940 nicht ändern sollte. Generell waren die Kreishauptleute für die Ausführung der in der Krakauer Zentrale getroffenen Anordnungen zuständig.83 Gesetzlich exakt geregelt war ihr Arbeitsgebiet nicht, allerdings leitete sich dieses in Teilen durch die Distriktverwaltung und die Regierung sowie durch die Verordnungen für einzelne Verwaltungsbereiche ab. In ihren Zuständigkeitsbereich fiel zunächst die Sicherung und Festigung der deutschen Herrschaft, die Erfassung landwirtschaftlicher Kontingente und die Rekrutierung von Arbeitskräften, die Erschließung von Rohstoffen, die Sicherstellung des Funktionierens der Wirtschaft sowie die Beaufsichtigung der polnischen, ukrainischen und jüdischen „Selbstverwaltung“. Auch das Pass- und Meldewesen, die Preisüberwachung, die Schleichhandelsbekämpfung, die staatliche Fürsorge für die deutsche und polnische Bevölkerung, das Straßenverkehrswesen, die Aufsicht über die Krankenhäuser sowie das medizinische Personal lag in ihrer Verantwortung.84 Einigen Kreishauptmännern standen Land- und Stadtkommissariate zur Seite, die ihnen bei der Ausübung ihrer Aufgaben zur Hand gingen. In der Regel waren auch diese personell schwach besetzt.85 Zur Unterstützung der Umsetzung polizeilicher Aufgaben wurde den Kreishauptmännern Personal der deutschen Gendarmerie zur Verfügung gestellt, wobei sie jedoch nur über ein sachliches Weisungsrecht gegenüber den Polizisten verfügten. Dieses bezog sich auf die Erfüllung polizeilicher Einzeldienstaufgaben, soweit reichs- oder volksdeutsche Interessen tangiert waren.86 Darüber hinaus war den Kreishauptleuten sowohl die polnische Polizei als auch der Sonderdienst unterstellt.87
Unterhalb des deutschen Verwaltungsapparats existierte die sogenannte polnische beziehungsweise ukrainische Selbstverwaltung, deren Organisationsstruktur weitgehend aus der Vorkriegszeit weitergeführt wurde. In den Städten übten die Bürgermeister die polnische Verwaltung aus. In ländlichen Gegenden waren in den meisten Fällen mehrere Dörfer zu Sammelgemeinden zusammengefasst, denen ein Vogt vorstand. In den einzelnen Dörfern waren Dorfschulzen eingesetzt. Diese sollten primär für die Umsetzung der deutschen Befehle innerhalb ihrer Orte Sorge tragen. In diesen Bereich fiel das Zusammenstellen von Kontingenten oder die Rekrutierung von Zwangsarbeitern. Die Wojts sollten die Arbeit der Dorfschulzen lenken und überwachen. Häufig wurden die Bürgermeister, Vögte und Dorfschulzen, die bereits in der Vorkriegszeit ihrem Amt nachgegangen waren, übernommen. Entsprach ihr Verhalten nicht den Vorstellungen der deutschen Besatzer, wurden sie mit der Zeit ersetzt. Die Position der Dorfschulzen und Vögte zwischen der einheimischen Bevölkerung einerseits und den deutschen Behörden andererseits war heikel. Die Deutschen versuchten die Wojts und Dorfschulzen für ihre Belange zu gewinnen, unter anderem durch Erpressung oder auch Belohnung.88
Neben der zivilen Verwaltung nahm der SS- und Polizeiapparat eine außerordentliche Stellung im Machtgefüge des Generalgouvernements ein. An seiner Spitze stand SS-Obergruppenführer Friedrich-Wilhelm Krüger, der am 4. Oktober 1939 von Heinrich Himmler zum Höheren SS-und Polizeiführer (HSSPF) ernannt worden war.89 Krüger, 1894 in Straßburg geboren, diente nach dem Besuch einer Kadettenanstalt im Ersten Weltkrieg als Offizier. Nach seiner Tätigkeit im Freikorps Lützow übte er ab 1920 diverse Berufe aus. 1929 erfolgte sein Eintritt in die NSDAP, 1931 in die SS, im darauffolgenden Jahr wechselte er zur SA. 1932 wählte man ihn für die NSDAP in den Reichstag. Krüger war in den Jahren 1934/1935 Chef des Ausbildungswesens innerhalb der SA; 1935 wurde er zum Obergruppenführer befördert. Vom 4. Oktober 1939 bis zum 9. November 1943 hatte Krüger das Amt des HSSPF im Generalgouvernement inne. Sein Nachfolger wurde der ehemalige HSSPF im Gau Wartheland, SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe.90
Dem HSSPF oblag es, die Tätigkeit der gesamten Polizei im Generalgouvernement zu leiten und aufeinander abzustimmen. Unterstellt war der HSSPF einerseits dem Generalgouverneur, andererseits jedoch direkt Heinrich Himmler. Priorität für Krüger hatten die Befehle des Reichsführers SS (RFSS).91 Darüber hinaus wurde Himmler am 7. Oktober 1939 von Hitler mit den „Aufgaben zur Festigung des deutschen Volkstums“ betraut. Dies hatte weitreichende Konsequenzen. Himmler, der nun den Titel „Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums“ (RKF) führte und Krüger zu seinem Stellvertreter im Generalgouvernement ernannte, konnte mit den neu erworbenen Befugnissen eine autarke Volkstumspolitik in den besetzten Ostgebieten betreiben. Diese Kompetenzen nutzte er bereits Ende 1939 zur Vertreibung der polnischen und jüdischen Bevölkerung aus den eingegliederten Ostgebieten in das Generalgouvernement.92
Der Polizeiapparat im Generalgouvernement gliederte sich in Sicherheitspolizei und Ordnungspolizei. Dem HSSPF waren der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS), der Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO)93 sowie die SS- und Polizeiführer (SSPF) in den einzelnen Distrikten unterstellt. Dem BdS nachgeordnet waren auf der Distriktebene die KdS. Entsprechend war die Ordnungspolizei in den BdO und den ihm unterstellten Kommandeuren der Ordnungspolizei (KdO) gegliedert. Die Ordnungspolizei übernahm zunächst den Behörden- und Objektschutz, Verkehrskontrollen sowie den Feuer- und Luftschutz. In der Folgezeit wurden deren Aufgaben erweitert und Einheiten beispielsweise auch für paramilitärische Einsätze herangezogen.94 Demgegenüber bestand die primäre Aufgabe der Sicherheitspolizei in der Anfangszeit in der Verfolgung und Ermordung der polnischen politischen Funktionäre. Sie war allerdings auch für Grenzschutzaufgaben, Fragen des Passwesens sowie für die Verbrechensbekämpfung verantwortlich. Der Sicherheitsdienst (SD) übernahm Aufgaben eines Nachrichtendiensts. Aber auch für „polizeiliche Maßnahmen“ gegenüber der jüdischen Bevölkerung im Generalgouvernement war generell der BdS, in den einzelnen Distrikten die KdS und die ihnen unterstehenden Außenstellen der Sicherheitspolizei zuständig.95
Das Amt des BdS bekleidete zunächst der 1902 in Hamburg geborene Bruno Streckenbach. Nachdem dieser 1919 die Schule verlassen hatte, schloss sich Streckenbach einem Freikorps an. Im Oktober 1930 trat er der NSDAP, im Dezember 1930 der SA bei. Im September 1931 wechselte er zur SS.96 Streckenbach wurde Mitte Januar 1941 von SS-Brigadeführer Eberhard Schöngarth abgelöst. Der letzte amtierende BdS war SS-Oberführer Walter Bierkamp, der dieses Amt von Sommer 1943 bis Ende 1944 bekleidete.97
Der Vertreter des BdS im Distrikt Krakau war zunächst SS-Sturmbannführer Walter Huppenkothen, der als erster KdS in Krakau eingesetzt wurde. 1907 im rheinländischen Haan geboren, nahm Huppenkothen nach seiner Schulzeit ein Jurastudium auf, das er 1934 mit dem Großen Staatsexamen in Berlin abschloss. 1933 erfolgte sein Partei- und SS-Beitritt; 1934 wurde er zum SD beurlaubt. Seit 1935 war er beim Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin tätig, 1937 avancierte Huppenkothen zum Leiter der Staatspolizeistelle und des SD-Abschnitts Lüneburg. Im Februar 1940 wurde er nach Lublin versetzt.98 Als KdS im Distrikt löste ihn der 1908 in Eitzen bei Lüneburg geborene Ludwig Hahn ab. Hahn, promovierter Jurist, trat 1930 in die NSDAP, 1933 in die SS ein. Im Jahr 1936 wurde er stellvertretender Leiter der Staatspolizeistelle Hannover, im Folgejahr Leiter der Staatspolizeistelle Weimar. 1939 führte er das Einsatzkommando 1 nach Polen. Im August 1940 wurde Hahn als Sonderbeauftragter des RFSS nach Preßburg (Bratislava) versetzt.99 Hahns Nachfolger als KdS, SS-Obersturmbannführer Max Großkopf, wies einen etwas anderen Werdegang auf: Zwar war auch er Jurist und darüber hinaus Ökonom, jedoch wurde er bereits 1892 geboren und nahm am Ersten Weltkrieg teil. Seit 1932 NSDAP-Mitglied, ging Großkopf im Jahr 1933 zum Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin. Er blieb bis Mitte 1943 in Krakau, war anschließend zunächst Leiter der Staatspolizeistelle Graz und wurde Anfang des Jahres 1945 Verbindungsführer beim Stab der Wlassow-Armee.100
Der letzte amtierende KdS im Distrikt war der 1903 geborene SS-Obersturmbannführer Rudolf Batz. Der studierte Jurist war seit 1933 Mitglied der NSDAP und seit 1935 der SS. Im gleichen Jahr kam Batz zum Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin, im Folgejahr avancierte er zum stellvertretenden Leiter der Staatspolizeistelle in Breslau, ab 1938 leitete er die Staatspolizeistellen in Linz und Hannover. Zwischenzeitlich war Batz zudem als stellvertretender BdS in Den Haag und 1941 als Chef des Einsatzkommandos 2 in Lettland tätig.101 Allen KdS Krakau war gemeinsam, dass sie Juristen waren. Mit Ausnahme von Großkopf gehörten sie der Kriegsjugendgeneration an. Bestimmend für ihre Karrieren war zudem ein Wechsel zwischen bürokratischer Tätigkeit in Berlin und der exekutiven Arbeit an der Peripherie.102
Im künftigen Distrikt Krakau erreichte das Gros der Angehörigen der Sicherheitspolizei das Gebiet bereits als Mitglieder der Einsatzgruppe I, die von Bruno Streckenbach geführt worden war. Ab November 1939 bildete deren Einsatzkommando 1 den Mitarbeiterstab des KdS in Krakau. Das Personal der KdS-Außenstellen im Distrikt wurde hingegen aus den Mitgliedern der Einsatzkommandos 2, 3 und 4 zusammengestellt. An den Grenzregionen zur Slowakei wurden Grenzpolizeikommissariate in Zakopane, Neu-Sandez, Jaslo, Sanok mit Außenstellen in Krosno, Gorlice und Przemyśl geschaffen. Darüber hinaus wurden bis 1943 KdS-Außenstellen in Miechów, Tarnów, Debica, Mielec, Reichshof, Jaroslau, Stalowa Wola sowie Dobromil eingerichtet. Die Sicherheitspolizei in Krakau verfügte im März 1940 über 2.250 Stellen, hiervon entfielen allerdings allein auf die KdS-Zentrale 479 Stellen. Demgegenüber waren die Außenstellen personell meist nur schwach besetzt. So zählte die KdS-Außenstelle Jaroslau einschließlich Dolmetscher und Schreibkräften zwischen sechs und acht Personen.103
Dem HSSPF unterstanden in den jeweiligen Distrikten auch die SSPF, die für polizeiliche Sonderaufgaben zuständig waren. Ihnen waren innerhalb der jeweiligen Distrikte alle Polizeieinheiten untergeordnet.104 Die Dienststelle des SSPF Krakau war personell nur schwach besetzt, sodass diese in der Regel nicht exekutiv tätig werden konnte und sich aus diesem Grund an die KdS, KdO oder auch an Einheiten der Waffen-SS wenden musste.105 Im Distrikt Krakau bekleideten insgesamt vier Männer das Amt des SSPF. Der erste war SS-Gruppenführer Karl Zeck, der bis Herbst 1940 amtierte. Sein Nachfolger war SS-Oberführer Hans Schwedler, der Anfang August 1941 von SS-Oberführer Julian Scherner abgelöst wurde. Scherner übte das Amt des SSPF für den längsten Zeitraum aus: Er war bis März 1944 auf diesem Posten. Unter seiner Regie wurde die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im Distrikt realisiert. Abgelöst wurde Scherner von SS-Brigadeführer Theobald Thier, der bis zum Ende der Besatzungszeit in Polen diesen Posten bekleiden sollte.106 In einem Brief resümierte Scherner sein Aufgabengebiet folgendermaßen: „Beim SS- und Polizeiführer laufen die Aufgaben der Polizeiverwaltung, der Sicherheit im Distrikt, der Arbeitseinsatz der Juden, die polnischen Zwangsarbeitslager und die des Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums zusammen.“107
Die unterschiedlichen deutschen Behörden auf höchster Regierungsebene verfolgten im Generalgouvernement während der gesamten Besatzungszeit in einigen Bereichen divergierende Zielvorstellungen. So erwuchs bereits im Herbst 1939 ein Konflikt zwischen der Zivilverwaltung und dem SS- und Polizeiapparat um die Frage der Zuständigkeit für die „Judenangelegenheiten“. Vor allem aber seit der Ingangsetzung der „Endlösung“ sollten sich die Interessenskonflikte innerhalb des Besatzungsgefüges im Generalgouvernement verschärfen.