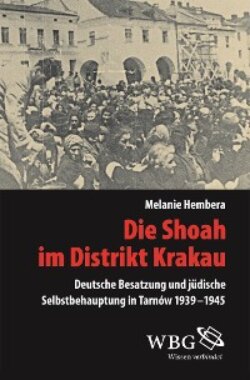Читать книгу Die Shoah im Distrikt Krakau - Melanie Hembera - Страница 11
Quellenlage
ОглавлениеDie vorliegende Studie basiert in der Hauptsache auf unveröffentlichten Quellen, die sich in drei Quellengattungen unterteilen lassen: Erstens zeitgenössische Überlieferungen, zweitens NS-Ermittlungsakten und drittens sogenannte „Ego-Dokumente“ und Selbstzeugnisse. Die zeitgenössische Quellenlage zur vorliegenden Thematik ist nicht unproblematisch. Ein großer Teil der Dokumente der Besatzungsinstitutionen wurde vor dem deutschen Rückzug vernichtet. Die erhalten gebliebenen Unterlagen befinden sich verstreut in unterschiedlichen deutschen und polnischen Archiven. Kopien einschlägiger Dokumente verwahrt zudem das Archiv des United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C., wie beispielsweise Quellen aus dem Staatsarchiv Krakau-Außenstelle Tarnów.69 Im letztgenannten Archiv lassen sich zentrale Überlieferungen der lokalen Besatzungsbehörden finden, wie der Bestand des Kreishauptmanns in Tarnów, der Einblicke in die zahlreichen antijüdischen Verordnungen und NS-Maßnahmen gegen die jüdische Gemeinde der Stadt gewährt.70 Im Bereich der Kreisverwaltung sind in Teilen die Lageberichte des Kreishauptmanns überliefert, die Aufschlüsse über die Tätigkeit der Kreisbehörde erlauben. Die Berichte sind in den polnischen Prozessunterlagen gegen Josef Bühler, einstiger Stellvertreter des Generalgouverneurs, zu finden. Die Unterlagen dieses Prozesses sind umfangreich: Beinahe 300 Bände umfassend, sind darin unzählige Originaldokumente und Kopien, Vernehmungsprotokolle und Gutachten enthalten, die weitreichende Erkenntnisse über die Besatzungspolitik im Generalgouvernement ermöglichen.71 Auch das Regionalmuseum in Tarnów verwahrt eine Reihe von Quellendokumenten diverser Provenienz. Ein Großteil dieser Bestände wurde für die vorliegende Arbeit ebenfalls ausgewertet.
Als wenig ergiebig erwiesen sich Recherchen nach Akten des SS- und Polizeiapparats in Tarnów. Die meisten Dokumente sind nicht überliefert, vielmehr sind lediglich Aktensplitter auffindbar. Ähnliche Befunde gelten für die Schriftstücke der jüdischen Gemeinde in Tarnów. Allerdings finden sich einige Dokumente im Archiv des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau.72 Ebenfalls von Interesse für die vorliegende Studie sind schließlich die im dortigen Archiv aufbewahrten Akten des Zentralkomitees der Juden in Polen (Centralny Komitet Żydów Polskich, CKŻP), die Aufschluss über die Situation der jüdischen Gemeinde kurz nach Kriegsende zu geben vermögen.73 Einige der Unterlagen von Yad Vashem über die „Gerechten unter den Völkern“ sind im Archiv des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau in Kopie einsehbar. Diese Quellen können einen Eindruck der Rettungsaktionen von Juden durch christliche Polen vermitteln. In diesem Bestand sind auch Informationen über Hilfeleistungen für Juden in Tarnów auffindbar, obgleich diese lediglich eine Annäherung an die Thematik sein können.74 Als aufschlussreich erwiesen sich zudem die überlieferten Akten der Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht in Tarnów, die Ermittlungstätigkeiten aufgrund diverser Delikte unter deutscher Besatzung dokumentieren.75 Neben den bereits genannten Quellen wurde für die vorliegende Arbeit die polnischsprachige Jüdische Zeitung (Gażeta Żydowska, GŻ) systematisch ausgewertet. Die GŻ, die erstmalig am 23. Juli 1940 veröffentlicht wurde, stand unter deutscher Aufsicht und erschien jeweils dienstags und freitags, wobei der Umfang jeweils zwischen sechs und 16 Seiten variierte. Die GŻ wurde bis Juli 1942 veröffentlicht.76 Inhaltlich lag ihr Fokus vor allem auf unterschiedlichen Bereichen des alltäglichen Lebens der jüdischen Gemeinden im Generalgouvernement.77 Die Zeitung ist in digitalisierter Form im Archiv des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau einsehbar.
Den zweiten wichtigen Quellenfundus bilden die Ermittlungsakten bundesdeutscher sowie polnischer Staatsanwaltschaften der Nachkriegszeit. Diese beinhalten neben den Vernehmungsprotokollen78 auch die Anklage- und Urteilsschriften sowie, falls vorhanden, die Einstellungsverfügungen. Die bundesdeutschen Justizakten lassen sich auszugsweise im Bundesarchiv-Außenstelle Ludwigsburg finden. Die vollständigen Ermittlungsakten sind hingegen bei der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft, die das Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten führte oder im jeweiligen Landesarchiv einzusehen. Neben zahlreichen Beständen im Bundesarchiv-Außenstelle Ludwigsburg wurden für die vorliegende Studie Verfahrensakten der Staatsanwaltschaft Bochum herangezogen, die nun im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Westfalen lagern.79 Diese Überlieferungen wurden bislang nicht auf historischer Basis ausgewertet. Rechtskräftige Urteile bis 2012 sind zudem in der Sammlung „Justiz und NS-Verbrechen“ veröffentlicht.80 Darüber hinaus finden sich einige einschlägige Anklage- und Urteilsschriften in Kopie im Institut für Zeitgeschichte in München.
Neben den bundesdeutschen Ermittlungsverfahren sind polnische Verfahren für das Thema der vorliegenden Arbeit von Relevanz. Die polnischen Gerichtsakten befinden sich entweder im Archiv des Instituts für Nationales Gedenken (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, AIPN) in Warschau oder in dessen regionaler Abteilung in Krakau. Darüber hinaus wurden umfangreiche Ermittlungsverfahren eingesehen, die sich in der Bezirkskommission zur Verfolgung der Verbrechen gegen das polnische Volk in Krakau befinden.81 Auch polnische Prozessakten auf Basis des sogenannten „August-Dekrets“ zur Verfolgung von Verbrechen gegen die polnische Nation liefern wichtige Informationen, die Rückschlüsse auf Verbrechen gegen die jüdische Bevölkerung in Tarnów zu geben vermögen.82 Schließlich wurden auch Kopien einiger umfangreicher Prozessunterlagen polnischer Provenienz, wie das Verfahren gegen Amon Leopold Göth, im Archiv des United States Holocaust Memorial Museum ausgewertet.83
Gerade angesichts des Mangels an zeitgenössischen Dokumenten avancierten NS-Ermittlungsakten zu einer wichtigen Grundlage der NS-Forschung. Obgleich das Hauptaugenmerk solcher Justizakten auf den Taten und Tätern liegt, werden diese Quellen auch zunehmend für andere historische Fragestellungen herangezogen.84 Allerdings sollte auch im Umgang mit diesen Überlieferungen nicht auf die nötige Quellenkritik verzichtet werden.85 Gerade mit der Heranziehung von NS-Ermittlungsakten verbinden sich eine Reihe methodischer Probleme, wie deren Entstehungszusammenhang: Akten aus NS-Prozessen spiegeln die Ermittlungsarbeit von Staatsanwälten, Richtern sowie Polizeibeamten wider.86 Wolfgang Scheffler formulierte hierzu zutreffend, das Ziel eines Strafprozesses sei es, die Verletzung der Gesetzesnorm zu untersuchen und zu ahnden. Es sei nicht sein Zweck, Geschichtsforschung zu betreiben.87 Sich dessen bewusst zu sein, ist eine notwendige Voraussetzung für den Umgang mit diesen Akten. Eine weitere methodische Problematik betrifft den Zeitpunkt der Aussagen und Vernehmungen, da diese häufig erst viele Jahre nach den Ereignissen zu Protokoll gegeben wurden. Die Erinnerung an das Erlebte kann in der Zwischenzeit vielfältigen inneren und äußeren Einflüssen und damit Veränderungen unterlegen haben. Dies zu berücksichtigen ist ebenso erforderlich wie die Vergegenwärtigung, welche Stellung die befragte Person zu Zeiten des historischen Ereignisses als auch im Moment der Befragung einnahm. So neigten Täter im Rahmen von Ermittlungen natürlich dazu, Tatsachen zu verschweigen, zu verharmlosen oder andere Personen für Verbrechen verantwortlich zu machen. Demgegenüber wird man bei der Auswertung von Aussagen des Opferkreises häufig mit ganz anderen Schwierigkeiten konfrontiert. So stellten Jürgen Finger und Sven Keller fest, dass der Holocaust die Überlebenden mit lang andauernden existenziellen Ausnahmesituationen konfrontiert, sie nicht selten als einzige Überlebende des eigenen familiären und sozialen Umfeldes zurückgelassen und tief traumatisiert habe.88
Die dritte relevante Quellengattung für diese Arbeit sind persönliche Aufzeichnungen. Neben Tagebüchern, die während der NS-Besatzung geführt wurden89, berücksichtigt die vorliegende Arbeit in der Hauptsache Memoiren und Erinnerungsberichte, die nach Kriegsende entstanden sind. Hierbei ist zunächst der Bestand 301 aus dem Archiv des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau von großer Bedeutung.90 Diese Sammlung beinhaltet Berichte, die von Überlebenden vor der jüdischen Kommission in Polen mündlich gegeben und aufgezeichnet wurden, sowie selbst verfasste Berichte. Letztere entstanden vielfach unmittelbar nach der Befreiung, was sich meist günstig auf deren Detailgenauigkeit auswirkte. Weitere, unveröffentlichte Erinnerungsberichte jüdischer Überlebender lassen sich zudem im Archiv von Yad Vashem in Jerusalem und im Archiv des United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. finden. Neben diesen wichtigen Quellen existiert ein zweibändiges Erinnerungsbuch über die jüdische Gemeinde in Tarnów, das nach Kriegsende entstand. Verfasst wurde dieses sogenannte Yizkor-Buch in jiddischer und hebräischer Sprache; es beinhaltet Beiträge von Überlebenden über die jüdische Gemeinde in Tarnów vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die historische Abteilung des Regionalmuseums in Tarnów ließ dieses Erinnerungsbuch vor einigen Jahren ins Polnische übersetzen.91 Teile dieser Übersetzungen, die sich auf die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung beziehen, wurden veröffentlicht.92 Einige Überlebende aus Tarnów haben ihre Erinnerungen niedergeschrieben, um diese der Nachwelt zugänglich zu machen. Vor allem in den letzten Jahren wurden zahlreiche Memoiren publiziert.93 Die meisten liegen in englischer Sprache vor; nur vereinzelt wurden diese ins Deutsche übersetzt.94 Manche Memoiren sind allerdings nicht veröffentlicht und daher lediglich im jeweiligen Archiv einsehbar, in dem sie abgegeben wurden. Für die vorliegende Studie wurden vor allem unveröffentlichte Memoiren im Archiv des United States Holocaust Memorial Museum hinzugezogen.95 Auch bei den Quellenüberlieferungen der jüdischen Überlebenden, die zum Teil eine große Emotionalität hervorrufen können, ist es erforderlich, sorgfältige Quellenkritik zu üben: So existieren Widersprüche in Bezug auf historische Fakten, Ereignisse, Personen sowie vor allem Daten. Zudem sollte auch die zeitliche Distanz zu den Aussagen der jüdischen Überlebenden stets als Kriterium präsent sein.96 Eine weitere Quellenart, deren Stellenwert innerhalb der Historiographie in den kommenden Jahren zunehmen dürfte und die gerade für Fragestellungen nach dem Alltag der jüdischen Bevölkerung unter nationalsozialistischer Besatzung äußerst gewinnbringend sein kann, sind Interviews mit Holocaust-Überlebenden.97 Die größte Sammlung aufgezeichneter mündlicher Zeitzeugenbefragungen von NS-Verfolgten bietet die von Steven Spielberg im Jahre 1994 gegründete „Survivors of the Shoah Visual History Foundation“. Einige dieser Oral History Testimonies wurden im United States Holocaust Memorial Museum ausgewertet, wie auch Zeitzeugeninterviews, die sich im Bestand des Museums selbst befinden.98
Die für die vorliegende Studie benutzten Quellen vermögen eine multiperspektivische Sicht auf die Frage nach dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung unter NS-Besatzung zu geben. Die meisten zeitgenössischen Überlieferungen deutscher Provenienz ermöglichen es, die einzelnen nationalsozialistischen Entrechtungs- und Verfolgungsschritte gegenüber der jüdischen Bevölkerung zu rekonstruieren. Aufgrund der Tatsache, dass eine Vielzahl der Behördenschriftstücke systematisch vernichtet wurde, ist die Heranziehung anderer Dokumente von Nöten. Gerade NS-Ermittlungsakten geben wichtige Hinweise auf die begangenen NS-Verbrechen sowie über die an der Verfolgung und Entrechtung beteiligten Institutionen und Individuen.
Welche konkreten Auswirkungen die Umsetzung der „Judenpolitik“ allerdings auf die Betroffenen hatte, wird nur anhand von Überlieferungen der jüdischen Perspektive deutlich. Die Quellen der jüdischen Institutionen, im Falle Tarnów in der Hauptsache der Jüdischen Sozialen Selbsthilfe, geben mitunter Einblicke in die immer größer werdende Not der Bevölkerung im Zuge der NS-Maßnahmen. Sie ermöglichen damit wichtige Erkenntnisse über die allgemeine Situation der jüdischen Gemeinde Tarnóws. Für die Rekonstruktion des Alltags unter NS-Besatzung sowie des Verhaltens und der Reaktionen der Menschen sind individuelle Zeugnisse von großem Belang. Das Gros dieser Quellen entstand nach 1945 und spiegelt im Gesamten nur einen kleinen Ausschnitt wider, da die Mehrzahl der jüdischen Bevölkerung die Shoah nicht überlebte und somit auch kein Zeugnis über ihre Lebenssituation während des Zweiten Weltkriegs ablegen konnte. Aber auch Zeugenaussagen im Rahmen von Ermittlungen können tiefe Einblicke in individuelle Lebenssituationen gewähren.
Zwar lassen die vorhandenen Überlieferungen keine allgemeingültigen Befunde über die gesamte jüdische Gemeinde Tarnóws unter NS-Besatzung zu, allerdings mindert dies keineswegs den Wert dieser Quellen: Die eine und einzige Geschichte der Juden Tarnóws unter NS-Besatzung kann es ohnehin nicht geben; zu heterogen war nicht nur die Gemeinde, sondern auch deren Alltag, ihr Denken, Fühlen und Handeln. Kurzum: Die soziale Wirklichkeit tausender Individuen ist nicht generalisierbar. Durch die Heranziehung einer Vielzahl der vorhandenen Überlieferungen ist es allerdings möglich, sich auf breiter Basis der Erfahrungswelt der Betroffenen anzunähern. Ergänzend wurden in der vorliegenden Arbeit einige Quellen der „Zuschauer“ – jene Personen, die a priori weder der Täter- noch der Opferseite zuzurechnen sind – hinzugezogen. Hierdurch werden die beiden anderen Perspektiven ergänzt und erweitert.