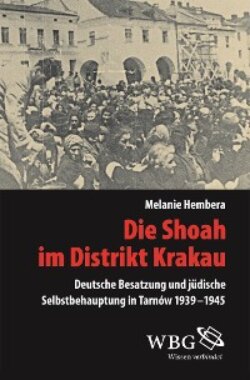Читать книгу Die Shoah im Distrikt Krakau - Melanie Hembera - Страница 8
Einleitung
ОглавлениеWir schreiben das Jahr 1994. Ein Rabbiner aus dem US-amerikanischen Baltimore organisiert eine Reise nach Polen. Auch Felicia Graber nimmt gemeinsam mit ihrem Ehemann Howard daran teil. In Polen angekommen, besichtigt die Reisegruppe verschiedene Ortschaften, auch ehemalige Lager, die von den Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs errichtet worden waren, um die jüdische Bevölkerung auszubeuten und zu ermorden – Majdanek, Auschwitz und Treblinka. Nach zehn Tagen ist die Reise zu Ende. Die Gruppe kehrt in die Vereinigten Staaten zurück. Felicia und Howard allerdings beginnen nun ihre eigene, ganz persönliche Reise.1 Ihr Ziel ist Tarnów, rund 80 Kilometer ostwärts von Krakau gelegen, gegenwärtig die nach Krakau zweitgrößte Stadt der heutigen Wojewodschaft Kleinpolen (małopolskie). In Tarnów angekommen, findet Felicia Graber das Haus und die Wohnung, in der sie geboren wurde. Jenes Haus, in dem sie gemeinsam mit ihren Eltern bis zur zwangsweisen Umsiedlung ins Ghetto lebte. In ihrer einstigen Wohnung lebt nun eine ältere Polin, die, wie sich herausstellt, bereits seit vielen Jahrzehnten dort wohnt. Sie hatte diese übernommen, nachdem die jüdische Familie sie verlassen musste. Im Gespräch mit der Frau fragt sich Felicia, ob die alten Massivmöbel wohl einst ihren Eltern gehört hatten. Sie scheut sich jedoch, danach zu fragen. Neben der Wohnung findet Felicia auch das Geschäft, in dem ihr Vater und Großvater arbeiteten. Zufälligerweise trifft sie auf einen alten polnischen Uhrmacher, der sich sogar an ihre Familie zu erinnern scheint. Auch das Haus, in dem sie nach der Ghettobildung mit vielen anderen Menschen leben musste, kann Felicia Graber finden. Bevor das Ehepaar Tarnów verlässt, besucht es den jüdischen Friedhof der Stadt. Sie hofft, mit Hilfe einer Fotografie das Grab ihrer Großmutter zu finden. Felicias Mutter hatte den Grabstein restaurieren lassen, ehe sie im Jahre 1947 aus Polen emigrierte.2
Jahre zuvor bildete Tarnów ein bedeutendes jüdisches Zentrum im einstigen Westgalizien.3 Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zählte die Stadt rund 25.000 jüdische Einwohner, was 45 Prozent der Gesamtbevölkerung entsprach.4 Somit war beinahe die Hälfte der Bewohner Tarnóws mosaischen Glaubens. Die jüdische Gemeinde nahm nicht nur zahlenmäßig, sondern auch im sozialen, kulturellen, politischen und vor allem im ökonomischen Bereich eine wichtige Rolle innerhalb des städtischen Gesellschaftsgefüges ein. Dies sollte sich jedoch mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schlagartig ändern. Unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch Anfang September 1939 folgten antijüdische Verordnungen, die auf Entrechtung, Ausbeutung und Isolierung der jüdischen Bevölkerung abzielten. Ein geschlossenes Ghetto wurde in der Stadt erst im Juni 1942 eingerichtet. Das Ghetto in Tarnów war eines der größeren im gesamten Generalgouvernement, in dem nicht nur die Ortsansässigen, sondern auch Juden aus anderen Städten und Ländern auf engstem Raum leben mussten. Im September 1943, zu einer Zeit, als die meisten anderen Ghettos im Distrikt Krakau bereits aufgelöst waren, wurde das Ghetto in Tarnów liquidiert; das Gros der Insassen deportierte man nach Auschwitz. Sieht man von jenen Juden ab, die bereits 1939 in das sowjetisch besetzte Gebiet geflohen waren, überlebten lediglich einige hundert Juden aus Tarnów die NS-Besatzungszeit, hiervon ein geringer Teil außerhalb des Ghettos mit falschen Papieren oder in Verstecken.
Innerhalb der westlichen Holocaust-Historiographie gleicht Tarnów immer noch einem weißen Fleck auf der Landkarte. Dies verwundert angesichts der Größe und der Bedeutung, die diese Kehilla, die alte jüdische Gemeinde, im Vorkriegspolen hatte: Schließlich war sie die viertgrößte jüdische Gemeinde im einstigen Galizien. Aber auch unter NS-Besatzung nahm Tarnów eine Sonderrolle ein: Das dortige Ghetto war eines der größten im gesamten Distrikt Krakau. Obgleich vor allem in den letzten Jahren einige Regionalstudien entstanden sind, wurde die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Tarnóws unter NS-Besatzung von der bisherigen westlichen Forschung nur unzureichend beleuchtet. Die Historiographie verfügt über keine weitreichenden Erkenntnisse in Bezug auf die vor Ort agierenden Täter und die von ihnen praktizierten nationalsozialistischen Maßnahmen gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Analoge Befunde gelten für die Betroffenen: Auch deren konkrete Lebensbedingungen im Zuge der fortschreitenden Entrechtung und Verfolgung, deren Reaktionen, Handlungsspielräume und damit einhergehende Überlebensstrategien bleiben bis dato im Dunkeln. In der vorliegenden Studie werden diese Themenkomplexe umfassend behandelt, um das Forschungsdesiderat zu beheben.