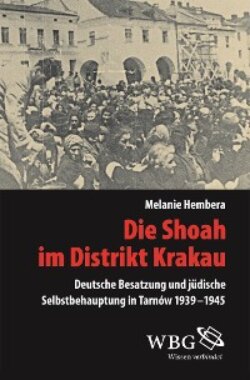Читать книгу Die Shoah im Distrikt Krakau - Melanie Hembera - Страница 9
Stand der Forschung
ОглавлениеBereits unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzte in Polen eine intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit der deutschen Besatzungspolitik im Allgemeinen und mit der deutschen „Judenpolitik“ im Speziellen ein. Eine Fülle von Publikationen entstand.5 Demgegenüber beschäftigte sich die westliche Historiographie erst viel später mit der Judenverfolgung und dem Judenmord in den besetzten polnischen Gebieten. Seit den 1960er Jahren erfolgte ganz allmählich eine wissenschaftliche Annäherung an diesen Gegenstand. Erstmalig umfassend wurde der deutsche Besatzungsapparat und die durch ihn praktizierte Politik von Martin Broszat und Gerhard Eisenblätter untersucht.6 Im folgenden Jahrzehnt beschäftigte sich zunächst Christoph Kleßmann mit der NS-Kulturpolitik und der polnischen Widerstandsbewegung im Generalgouvernement, während sich Hans Umbreit den deutschen Militärverwaltungen in Polen und der Tschechoslowakei widmete.7 Nach der Veröffentlichung der Quellenedition des Diensttagebuches von Generalgouverneur Hans Frank durch Werner Präg und Wolfgang Jacobmeyer8 sowie Diemut Majers Monographie über die rechtliche Behandlung der „Fremdvölkischen“ im Dritten Reich9 verschwand das Generalgouvernement zunächst von der wissenschaftlichen Agenda. Im Vordergrund der westlichen Historiographie stand in den 1970er und 1980er Jahren vor allem die intensiv geführte Debatte zwischen Intentionalisten und Funktionalisten.10
Erst zu Beginn der 1990er Jahre, mit dem Ende des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa und den damit einhergehenden Archivöffnungen, setzte innerhalb der westlichen Geschichtswissenschaft ein Wandel in der Themensetzung ein, wobei nun auch die besetzten Gebiete Ost- und Ostmitteleuropas zunehmend untersucht wurden. In den Blick der Forschung rückte das Generalgouvernement wieder mit der Arbeit von Götz Aly und Susanne Heim über die „Vordenker der Vernichtung“, die erstmalig 1990 veröffentlicht wurde.11 In der Folgezeit wurden einige ausführliche Regionalstudien publiziert, die sich mit unterschiedlichen Regionen sowie Teilbereichen deutscher Besatzungspolitik12, vor allem jedoch mit dem Mord an der jüdischen Bevölkerung im besetzten Polen befassten. Den Anfang machte Dieter Pohl, der sowohl die „Judenpolitik“ im Distrikt Lublin als auch im Distrikt Galizien analysierte.13 Ebenfalls mit Galizien befasste sich Thomas Sandkühler, allerdings legte er einen Schwerpunkt auf die Rettungsaktionen von Berthold Beitz für jüdische Zwangsarbeiter.14 Die Rolle der Zivilverwaltung bei der Organisation und Realisierung der „Endlösung“ wurde von Bogdan Musial am Beispiel des Distrikts Lublin untersucht.15 Auch David Silberklang forschte zum Distrikt Lublin, wobei er sich auf die Judenverfolgung und -vernichtung in diesem Gebiet konzentrierte.16 Robert Seidel analysierte demgegenüber die Ausbeutungs-, Terror- sowie Vernichtungspolitik im Distrikt Radom, wobei er die Behörden der Distrikt- und Kreisebene untersuchte.17 2007 erschien zudem eine von Jacek Andrzej Młynarczyk verfasste Studie zur gleichen Region, die den Fokus allerdings speziell auf die dort realisierte Judenverfolgung und den Judenmord legte.18
Die genannten Arbeiten analysieren nicht nur die Organisation und den konkreten Ablauf der Judenverfolgung im regionalen Bereich, sondern sie fokussieren auch auf die Täter vor Ort und deren Motivation. Innerhalb des „frühen Täterdiskurses“19 allerdings, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit geführt wurde, beließ man es bei der Distanzierung vom Gros der Täter. Gerhard Paul merkte hierzu an, dass ein bipolares Täterprofil entstanden sei, das die Täter der Shoah entweder auf dämonische Führungspersonen oder aber auf kriminelle Exzesstäter ein- und damit aus der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt habe.20 Angesichts des Eichmann-Prozesses in Jerusalem und Hannah Arendts These von der „Banalität des Bösen“21 wurde das Bild des bürokratischen „Schreibtischtäters“ geprägt, der als emotionsloser Befehlsempfänger innerhalb der ihm vorgegebenen Strukturen agierte.22 Eine Überwindung des bis zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden „amorphen Täterbegriffs“23 ging von dem Kriminologen Herbert Jäger aus, der in seiner Habilitationsschrift auf Grundlage von NS-Ermittlungsakten drei Formen der Tatbeteiligung herausarbeitete: Exzess-, Initiativ- und Befehlstaten.24 Darüber hinaus gelang es Jäger, den „Befehlsnotstand“ zu entkräften, auf den sich zur damaligen Zeit viele Täter vor bundesdeutschen Gerichten beriefen. Empirisch konnte dieser in keinem der analysierten Fälle nachgewiesen werden.25 Allerdings sollten noch einige Jahre vergehen, bis sich die westliche Forschung den Tätern des Holocaust auf breiter Basis wissenschaftlich annahm.26 Zu diesem Paradigmenwechsel trugen vor allem die Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung „Verbrechen der Wehrmacht“27 sowie die kontroversen Studien von Christopher R. Browning und Daniel Jonah Goldhagen bei. Browning entwarf in seiner Monographie über das Reserve-Polizeibataillon 10128 ein multikausales Erklärungsmuster, wobei er nicht nur ideologische, kulturelle und situative Rahmenbedingungen berücksichtigte, sondern auch individuelle Motivlagen und Dispositionen betonte.29 Brownings Ergebnisse standen in scharfem Kontrast zu Daniel Jonah Goldhagens Publikation „Hitlers willige Vollstrecker“.30 Goldhagen, der gleichfalls das Bataillon 101 analysiert hatte, schlussfolgerte, dass sich die Täter aus freiem Willen an den Verbrechen beteiligten und auf diese Weise zu „willigen Vollstreckern“ avancierten. Begründet sah Goldhagen deren Hauptmotivation in einem „eliminatorischen“ Antisemitismus.31 Nach der Goldhagen-Kontroverse gingen Historiker zunächst verstärkt dazu über, die Funktionseliten des Dritten Reiches zu analysieren.32 Seit den letzten Jahren zeichnet sich jedoch der Trend ab, auch Täter der mittleren und unteren Hierarchieebene in den Blick zu nehmen.33
Im Gegensatz zu den Distrikten Radom, Lublin, Galizien, die inzwischen relativ gut erforscht sind, mangelt es jedoch an westlichen Studien über den Warschauer34 und Krakauer Distrikt, während in Polen selbst bereits frühzeitig einige Arbeiten über diese Gebiete publiziert wurden.35 Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenvernichtung im Distrikt Krakau veröffentlichte die polnische Historikerin Elżbieta Rączy im Jahr 2014.36 Trotz der Tatsache, dass Rączy wichtige Aspekte kaum oder gar nicht berücksichtigt und auch zentrale Quellenbestände (beispielsweise bundesdeutsche NS-Ermittlungsakten) vernachlässigt hat, gibt die Arbeit einen ersten systematischen Überblick über die Judenverfolgung und -ermordung im Distrikt und kann so wichtige Anknüpfungspunkte für künftige Forschungsarbeiten bieten.
Obgleich innerhalb der westlichen Geschichtswissenschaft bis dato keine Arbeit über den gesamten Distrikt vorliegt, wurden in den letzten Jahren zumindest einige Teilaspekte analysiert. Klaus-Michael Mallmann beschäftigte sich erstmalig umfassender mit dieser Region. In einem 2002 publizierten Aufsatz ging er der Frage nach der Beteiligung der Sicherheitspolizei am Judenmord im Distrikt Krakau nach, wobei er nicht nur die Organisation und das Personal darstellte, sondern auch die Täter und die durch sie begangenen Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung charakterisierte.37 Mallmann widmete sich auch der Biografie des berüchtigten Leiters des Grenzpolizeikommissariats Neu-Sandez, Heinrich Hamann, der weder ein „ganz normaler Mann“ noch ein „gewöhnlicher Deutscher“ gewesen sei.38 Die Rolle der Kreishauptleute im Generalgouvernement untersuchte Markus Roth, der an einigen Stellen auch den Distrikt Krakau näher beleuchtete.39 Daneben beschäftigte sich Dieter Schenk mit der Krakauer Machtzentrale des Generalgouverneurs Hans Frank.40 Ebenfalls zu Krakau arbeiteten Andrea Löw und Markus Roth. Sie stellten die Judenverfolgung in der Stadt von 1939 bis 1945 dar.41 Im selben Jahr, 2011, erschien Jan Grabowskis polnischsprachige Studie zur Jagd nach Juden im ländlichen Raum Dąbrowa Tarnowska, die kurze Zeit später auch in englischer Sprache vorgelegt wurde.42 Darüber hinaus veröffentlichte die israelische Wissenschaftlerin Rochelle G. Saidel 2013 eine Untersuchung über die Vernichtung der jüdischen Gemeinde in der Ortschaft Mielec.43
Die nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager, die auf dem Gebiet des besetzten Polen errichtet wurden, sind unterschiedlich gut erforscht. Immerhin wurde in den vergangenen Jahren zu verschiedenen Lagerstandorten eine Fülle von Veröffentlichungen vorgelegt.44 Schwieriger gestaltet sich die Forschungslage45 zu den von den Nationalsozialisten errichteten jüdischen Zwangsarbeitslagern46 und Ghettos. In Letzteren lebten – zumindest temporär – rund fünfzig bis sechzig Prozent der jüdischen Opfer.47 Raul Hilberg schätzt die Zahl der in den Ghettos umgekommenen Juden auf rund 600.000.48
Bereits Anfang der 1950er Jahre legte Philip Friedman einen Überblick über die Ghettoisierungspolitik vor.49 Auch Christopher R. Browning beschäftigte sich in seinen Arbeiten intensiv mit dieser Thematik.50 Gerade das Warschauer Ghetto gilt als verhältnismäßig gut erforscht, obgleich auch zu anderen Ghettos mittlerweile Einzelstudien vorliegen.51 So befasste sich der polnische Historiker Robert Kuwałek mit unterschiedlichen Ghettos im Distrikt Lublin.52 Das Ghetto Lublin wurde von Tadeusz Radzik erforscht53, während Adam Kopciowski den jüdischen Wohnbezirk in Zamość analysierte.54 Sara Bender untersuchte die Ghettos Białystok und Kielce.55 Andrej Angrick und Peter Klein beschäftigten sich in ihrer Studie mit dem Pendant in Riga.56 Auch das Krakauer Ghetto wurde im Rahmen von Monographien behandelt.57 Der italienische Historiker Gustavo Corni widmete sich in seiner Untersuchung den Menschen im Ghetto.58 Litzmannstadt stand im Zentrum von Andrea Löws Dissertation.59 Ihre Arbeit, die sich mit der Innenansicht des Ghettos befasst, stellte innerhalb der westlichen Historiographie Neuland dar: Sie rückte die jüdische Sichtweise in das Zentrum ihrer Studie. Die meisten zuvor publizierten Arbeiten hatten aufgrund ihrer Quellenauswahl eher die Täterperspektive eingenommen und die Seite der Opfer vernachlässigt. Eine Ausnahme bildete hier die bereits erwähnte Arbeit von Jacek Andrzej Młynarczyk. Er rekonstruierte nicht nur die Perspektive der Täter, sondern auch die der Opfer und „Zuschauer“.60 Demgegenüber muss jedoch resümiert werden, dass Arbeiten, die sich mit Ghettos von kleinerer und mittlerer Größe befassen, innerhalb der Historiographie immer noch ein Desiderat darstellen.61
Speziell mit Blick auf das Ghetto in Tarnów und hinsichtlich des Schicksals der jüdischen Bevölkerung unter NS-Besatzung lässt sich festhalten, dass westliche Studien, die sich mit der Judenverfolgung und dem Judenmord in Tarnów befassen, fehlen. In Polen selbst wurden zwar wenige knappe Studien publiziert, die sich der Thematik annähern. Allerdings erschienen viele bereits in den 1970er und 1980er Jahren; es wurden daher nicht die heute zugänglichen Quellen genutzt und darüber hinaus kaum moderne Fragestellungen entwickelt.62 Vor allem Mitarbeiter des Regionalmuseums in Tarnów (Muzeum Okręgowy w Tarnowie) legten einige Veröffentlichungen vor, die sich auch der Geschichte der jüdischen Bevölkerung Tarnóws unter NS-Besatzung widmeten.63 Über die Juden in Tarnów nach 1945 veröffentlichte der polnische Historiker Julian Kwiek zwei Aufsätze. Auf Grundlage umfangreicher Quellenbestände zeichnete er die Entwicklung der jüdischen Gemeinde, den Aufbau des jüdischen Bezirkskomitees in der Stadt, sowie den Versuch der Reaktivierung der jüdischen politischen Parteien nach.64 Auch in den Ghettoenzyklopädien des United States Holocaust Memorial Museum sowie von Yad Vashem wurde das Ghetto in Tarnów behandelt.65
Damit lässt sich festhalten, dass die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Tarnów bis dato nur unzureichend erforscht wurde. Die existierenden polnischen Veröffentlichungen können einen ersten Zugriff auf das Thema ermöglichen, wobei bei den vor dem Ende des Sozialismus erschienenen Publikationen auch der politische Entstehungskontext Berücksichtigung finden muss. Von bisherigen Veröffentlichungen profitiert die vorliegende Studie, gleichzeitig erweitert sie die Analyse erheblich. Dies ergibt sich einerseits aufgrund der Darstellung der jüdischen Perspektive, die bis dato kaum von der Forschung beachtet wurde. Andererseits wurden umfangreiche und zum Teil bislang unberücksichtigte Quellenbestände ausgewertet, die in unterschiedlichen Archiven eingesehen worden sind.