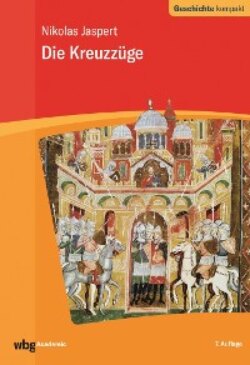Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 11
b) Die islamische Welt um 1095
ОглавлениеDie islamische Expansion
Nur wenige Jahre nach dem als Hiğra (Hedschra) bezeichneten Auszug Muḥammads (Mohammeds) von Mekka nach Medina im Jahre 622, mit dem die islamische Zeitrechnung beginnt, und unmittelbar nach dem Tode des Propheten im Jahre 632 setzte die arabisch-islamische Expansion ein. In einem beispiellosen Siegeszug eroberten die Muslime zuerst die Arabische Halbinsel und in der Folge bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts Syrien, Irak und den Iran, ganz Nordafrika sowie die Iberische Halbinsel. Die örtlichen Nachfolgeherrschaften des Römischen Reiches wie das Sassanidenreich im Osten oder die byzantinischen Herrschaften in Nordafrika und im Vorderen Orient wurden vernichtet. Mit der endgültigen Eroberung Siziliens zu Beginn des 10. Jahrhunderts kam der Mittelmeerraum fast vollständig unter islamische Kontrolle.
E
Schiiten und Sunniten (Schia und Sunna)
In Glaubensfragen war die islamische Welt keineswegs geeint: Die meisten Muslime waren Sunniten. Für sie waren und sind sowohl der Koran als auch das gute Vorbild des Propheten Richtschnur ihres Handelns. Die Sunniten sahen in Mitgliedern der Dynastie der Abbasiden den Kalifen, d.h. den Vorsteher der muslimischen Gemeinschaft. Allerdings waren die Kalifen zum Ende des 11. Jahrhunderts politisch vollständig von den mächtigen Seldschukensultanen abhängig. Unterhalb dieser Ebene gab es eine Reihe regionaler Machthaber (Sultane, Emire), die nominell von der Zentralgewalt des Kalifen abhängig waren. Die zweite große Glaubensrichtung des Islam stellen die Schiiten dar. Diese sehen in Ali, dem 661 ermordeten Cousin und Schwiegersohn Muḥammads, den ersten rechtmäßigen Kalifen und glauben, dass dessen Nachfolger (die Imame) unfehlbar und göttlich rechtgeleitet die islamische Gemeinde anführten. Die Hauptvertreter dieser Glaubensrichtung im 11. Jahrhundert waren die Fatimiden. Auch sie hatten einen Kalifen und verbanden mit ihm die Anwartschaft auf die alleinige Lenkung der universalen islamischen Gemeinde (arab. umma). Selbst innerhalb der schiitischen Ausrichtung, der Schia, gab es unterschiedliche Gruppen, die in einem jeweilig anderen imam den letzten bekannten Nachfolger des Ali und damit die höchste religiöse Autorität sahen. Die Auseinandersetzungen zwischen den sich gegenseitig ausschließenden Glaubensrichtungen der Sunniten und Schiiten waren lange innerhalb der islamischen Welt von weitaus größerer Bedeutung als die Kämpfe gegen die Christen; sie schlagen sich nicht nur in den Darstellungen der islamischen Geschichtsschreiber nieder, die teilweise gegen andersgläubige Muslime polemisierten, sondern prägten auch das Verhalten der Muslime gegenüber der christlichen Bedrohung.
Vor dem Beginn des Ersten Kreuzzugs erstreckte sich damit die islamische Welt, der dār al-islām, von der Straße von Gibraltar im Westen bis zum indischen Subkontinent im Osten. Handelsverbindungen reichten weit über diesen Raum hinaus und trugen im Verbund mit der Übernahme und Fortführung antiker geographischer Schriften dazu bei, das Weltbild der gebildeten Muslime zu erweitern. Allerdings war zu jener Zeit die alte politische Einheit unter arabischer Führung, nicht zuletzt wegen des Eindringens der Türken aus Mittelasien, einer starken Zersplitterung gewichen. Der dār al-islām zerfiel nunmehr im Wesentlichen in drei große Machtsphären. Im Osten herrschten die Seldschuken. Ihr Reich erstreckte sich vom Aralsee und dem heutigen Kasachstan bis zum Roten Meer und hatte sein Zentrum im Iran. Westlich davon grenzte das Herrschaftsgebiet der Fatimiden an. Diese arabische Dynastie führte sich auf Fatima (Fāṭima, einer Tochter Muḥammads) zurück und hatte zur Zeit der Kreuzzüge ihr Machtzentrum im ägyptischen Kairo. Ihr Reich umfasste zu Beginn des 11. Jahrhunderts noch den gesamten Maghreb, doch zum Ende des Jahrhunderts war es im Wesentlichen auf das heutige Ägypten und Tunesien zusammengeschrumpft. Weiter westlich lag das Herrschaftsgebiet der Almoraviden, einer Berberdynastie, die zum Ende des 11. Jahrhunderts den islamischen Teil der Iberischen Halbinsel sowie den westlichen Teil des Maghreb unter ihrer Führung vereint hatte.
Politische Umbrüche am Vorabend der Kreuzzüge
Die Jahre vor dem Aufruf zum Ersten Kreuzzug waren eine unruhige Zeit für die islamische Welt. Im Jahre 1094 war nach fast sechzigjähriger Herrschaft der fatimidische Kalif al-Mustanṣir (1036–1094) und kurz zuvor auch der faktische Herrscher des Reichs, der Wesir Badr al-Ğamālī, gestorben. Aus den daraufhin ausbrechenden Thronwirren sollte der Sohn des Badr al-Ğamālī, al-Afdal († 1121), als Sieger und die Sekte der Assassinen als neue Glaubensrichtung des schiitischen Islam hervorgehen. Die Angehörigen dieser neuen Sekte sahen im ermordeten Sohn des al-Mustanṣir den rechtmäßigen Kalifen. Sie errichteten ihr Zentrum im nordwestlichen Iran und ließen sich auch in Nordsyrien nieder, wo sie im 12. Jahrhundert zu einem wichtigen Faktor im Machtgefüge des Vorderen Orients wurden. Die Assassinen waren streng unter einem Anführer organisiert und verübten Attentate gegen sunnitische, aber auch christliche Herrscher (vgl. die Bezeichnung assassin, assassino, asesino etc.).
Auch im Seldschukenreich kam es zu Umbrüchen: Seit der siegreichen Schlacht gegen die Byzantiner bei Mantzikert (1071) war es den Seldschuken gelungen, sukzessive Anatolien und damit die östlichen Gebiete des Byzantinischen Reiches unter ihre Herrschaft zu bringen. Doch im Jahre 1092 verstarb der Sultan Malikšāh (1072–1092). Bis zum Jahre 1105 stritten sich dessen Söhne im Iran um das Erbe ihres Vaters, ihre Aufmerksamkeit wurde dadurch von den Schauplätzen in Syrien und Palästina abgelenkt. Im Westen, also in Anatolien, gelang es dem lokalen seldschukischen Führer Qiliğ Arslān (1092–1107), ein eigenes Herrschaftsgebiet zu bilden, aus dem bald das eigenständige Sultanat von Ikonium (Konya) wurde. Doch zur Zeit des Ersten Kreuzzugs war Qiliğ Arslān zu sehr mit der Konsolidierung seiner Herrschaft und den Machtkämpfen im Iran beschäftigt, um sich ernstlich in die Geschehnisse in der Levante (dem östlichen Mittelmeerraum) einzumischen. Auch die nomadischen Turkvölker Anatoliens waren zu jener Zeit zersplittert und daher nur kurzzeitig zu gemeinsamen Aktionen in der Lage. Schließlich verschied im Jahr 1094 auch der sunnitische Kalif in Bagdad. Damit waren zwischen 1092 und 1094 alle bedeutenden geistlichen, militärischen und politischen Persönlichkeiten der islamischen Welt im Vorderen Orient gestorben. Bedenkt man zudem die Unruhe unter den Muslimen aufgrund des nahenden Jahres 500 nach der Hiğra, zu dem allerhand apokalyptische Prophezeiungen vorlagen, so kann man im Nachhinein nur feststellen, dass aus christlicher Sicht der Zeitpunkt für einen Zug nach Palästina kaum besser hätte gewählt sein können.
Die Bedeutung Jerusalems für den Islam
Wie war die Lage in Palästina am Vorabend der Kreuzzüge und welche Bedeutung hatte Jerusalem für den Islam? Für die Muslime war und ist Jerusalem, wie für Juden und Christen, eine „heilige Stadt“. Dies drückt sich schon im Namen aus, unter dem sie seit dem 10. Jahrhundert im Islam vor allem bekannt ist: al-quds (Heiligtum). Ihre besondere Bedeutung für die Muslime rührt aus verschiedenen Wurzeln: Zum einen daraus, dass in ihr Christus starb, der im Islam als bedeutender Prophet gilt. Zum anderen und vor allem aber ist al-quds der Zielpunkt der so genannten Nachtreise (arab. isrāʾ) Muḥammads. In einer Nacht sei der Prophet nach Jerusalem und zurück nach Mekka entrückt worden, ein Beleg für seine Übernatürlichkeit und für seine Gottgefälligkeit. Außerdem soll er nach einem bis heute populären Stoff der volkstümlichen Muḥammad-Vita von Jerusalem aus auf der so genannten Himmelsleiter (arab. miʿrāğ) in den Himmel und von dort mit der Auflage zum fünfmaligen täglichen Gebet zur Erde zurückgekehrt sein. Vor diesem Hintergrund entstanden in Jerusalem zwei bedeutende Bauwerke: Um den von Muḥammad bei seinem Aufstieg zurückgelassenen Fußabdruck wurde im Jahre 691/92 auf dem Tempelplatz (arab. al-Ḥaram aš-Šarīf) der Felsendom vollendet. Unmittelbar neben ihm steht die al-Aqṣā-Moschee, das Ziel der „Nachtreise“. Schließlich galt und gilt Jerusalem im Islam als der Ort, an dem sich das Jüngste Gericht ereignen werde. Es erstaunt also nicht, dass diese heilige Stadt für Muslime einen besonderen religiösen Nimbus besitzt und nach Mekka und Medina das drittwichtigste Pilgerzentrum darstellt.
Zu Beginn des 11. Jahrhunderts war es zur Verfolgung Andersgläubiger, auch von Christen, gekommen, in deren Verlauf im Jahre 1009 die Jerusalemer Grabeskirche zerstört wurde. Doch die Situation änderte sich schnell, die Kirche wurde wiederhergestellt, und bald berichten islamische Texte wie etwa die Reisebeschreibung des spanischen Gelehrten Ibn al-ʿArabī von Palästina und insbesondere Jerusalem als Zentren islamischer, jüdischer und christlicher Gelehrsamkeit. Die unterschiedlichen christlichen Minderheiten (vgl. Kap. III., 2. a) waren zwar zur Zahlung einer Kopfsteuer (arab. ğizya) verpflichtet und den Muslimen keineswegs rechtlich gleichgestellt, aber sie genossen Religionsfreiheit und empfingen Pilger aus der lateinischen und aus der griechisch-orthodoxen Welt. Allerdings liegt auch ein Beleg dafür vor, dass im Jahre 1093/94, also unmittelbar vor dem Aufruf zum Kreuzzug, Pilger daran gehindert wurden, den Weg von den levantinischen Küstenstädten nach Jerusalem zu nehmen.
Zu dieser Zeit befand sich die Heilige Stadt in der Hand der Seldschuken, die 1071 das gesamten Hinterland Palästinas einschließlich Jerusalems erobert hatten. In der Folge lag die Stadt im Grenzgebiet fatimidischer und seldschukischer Herrschaft, was sich negativ auf die Sicherheit in der Region auswirkte: Der Wegfall einer starken seldschukischen Zentralmacht bedingte nach 1092 die Entstehung kleinerer Emirate in Syrien, v.a. um Aleppo und Damaskus. An der Küste, die durch reiche Hafenstädte mit internationalen Handelsverbindungen (z.B. Tripolis, Akkon und Tyrus) gekennzeichnet war, übernahmen lokale Machtträger die Herrschaft, soweit die Städte nicht unter fatimidischer Macht verblieben waren. Syrien und Palästina wiesen hier gewisse Ähnlichkeiten zum Italien jener Zeit auf: zersplittert, wirtschaftlich hoch entwickelt, aber ebenso ablehnend gegenüber zentralisierter Herrschaft. Nur im südlichen Palästina wurde das Machtvakuum noch einmal unmittelbar vor der Ankunft der Kreuzfahrer durch die Fatimiden gefüllt: Im Jahre 1098 nahm der Wesir al-Afdal in einem Blitzunternehmen Jerusalem ein. Es ist nicht zu klären, ob er damit einer Eroberung durch die Kreuzfahrer, über deren Anrücken er informiert gewesen zu sein scheint, zuvorkommen wollte, oder gar in Absprache mit ihnen handelte, um einen christlichen „Puffer“ gegen die Seldschuken zu errichten. Doch nunmehr bildete Jerusalem im Binnenland Palästinas einen Vorposten fatimidischer Macht.