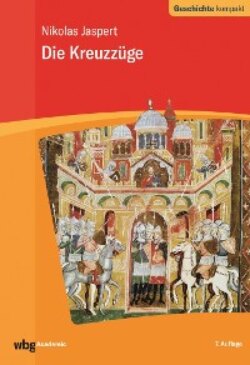Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 15
c) Das Pilgerwesen
ОглавлениеIm Hochmittelalter spielte die Pilgerfahrt nicht zuletzt deshalb eine besondere Rolle, weil den Heiligen die Fähigkeit zugesprochen wurde, vor Gott zum Wohle Einzelner einzutreten, zu intervenieren. Hier berührten sich die Sorge um das Seelenheil und um die eigene Sündhaftigkeit mit Heiligenkult und Pilgerwesen. Manche Gebeine oder Körperteile von Heiligen besaßen als Reliquien besondere Attraktivität und erlangten über den lokalen oder regionalen Rahmen hinaus Anziehungskraft. Es entstand im christlichen Europa ein Netz von Pilgerzentren, das jedoch Verdichtungszonen und Schwerpunkte aufwies. Europaweite Bedeutung erlangten vor allem drei Orte: Rom, Santiago de Compostela auf der Iberischen Halbinsel und Jerusalem. Rom genoss als Sitz des Papstes, Ort des Martyriums vieler Christen und nicht zuletzt als letzte Ruhestätte bedeutender Apostelfürsten wie Petrus und Paulus eine besondere Attraktivität. Santiago de Compostela zeichnete zum einen der dort verehrte Leichnam des heiligen Jakobus Zebedäus aus; zum anderen galt es als eine besondere Form der Läuterung, die lange Strecke dorthin gegangen zu sein – der Weg war sozusagen ein Teil des Ziels. Das Gleiche konnte man zweifelsohne vom Heiligen Land sagen. Daneben aber war Palästina wie kein anderes Gebiet unmittelbar mit der christlichen Heilsgeschichte verknüpft. Das Land selbst war dadurch geheiligt, daher der geläufige Begriff der loca sancta, der heiligen Orte.
Jerusalemfrömmigkeit
Die Vorstellung, sich durch die Anwesenheit an solch einem locus sanctus zu reinigen und selbst zu heiligen, ist älter als das Christentum. Im Judentum findet die Jerusalemsehnsucht im Gelöbnis der Pessach-Liturgie „Nächstes Jahr in Jerusalem“ ihren eindrucksvollsten Niederschlag, sie äußert sich zugleich ganz konkret in Pilgerreisen ins Heilige Land. Dort, in besonders geheiligter Erde ihre letzte Ruhe zu finden, war und ist das Ziel nicht weniger jüdischer Reisender. Auch das spätantike Christentum war stark von diesem Gedanken geprägt. Viele Christen zogen nicht nur nach Palästina, sondern blieben auch dort und beschlossen ihre Tage im Lande des Herrn. Durch den Kirchenlehrer Hieronymus (347/348–419/420) z.B. wurde diese Haltung vorgelebt und propagiert. Andere gaben sich damit zufrieden, die Stätten gesehen zu haben, um dann in ihre Heimat zurückzukehren. Dabei wurden Gegenstände zurückgebracht – nicht als Andenken, sondern als verehrungswürdige und Heil spendende Überreste. Sowohl die Orte wie auch die Heiligen konnten ihre besondere Segenskraft, die virtus oder eulogia, auch an so genannte Berührungs- oder Sekundärreliquien weitergeben, woraus sich die Verbreitung von Segensandenken wie etwa Wasser vom Jordan oder Heiligem Öl erklärt.
Im Verlauf des Hochmittelalters wurden auch die rechtlichen Aspekte des Pilgerns geregelt. Der peregrinus legte einen besonderen Pilgereid ab, er wurde von der Kirche, aber auch von weltlichen Herrschaftsträgern unter einen besonderen Schutz gestellt: Seine Habe und Familie waren in der Zeit seiner Abwesenheit geschützt, Schulden gestundet. Zum Ausweis ihres Status trugen Pilgerinnen und Pilger ein Zeichen. Dass diese Sonderstellung auch einmal von falschen Pilgern ausgenutzt wurde, liegt auf der Hand. Ebenso klar ist, dass nicht nur spirituelle Unruhe und die Sorge um das eigene Seelenheil eine Pilgerfahrt begründen konnten: Auch Abenteuerlust, Neugierde oder der Wunsch, wirtschaftliche bzw. politische Interessen mit einer Pilgerfahrt zu verbinden, konnten den Aufbruch bedingen.
Schon in spätantiker Zeit gab es einen regen Pilgerverkehr zwischen Europa und Palästina. Egeria, eine wahrscheinlich von der Iberischen Halbinsel stammende Pilgerin des 4. Jahrhunderts, verfasste einen ausführlichen Bericht über ihre Fahrt, und eine Vielzahl ähnlicher Werke folgte – manche als Führer für andere Pilger, andere als Erlebnisbericht konzipiert. Die Möglichkeit, die lange Strecke in den Vorderen Orient zurückzulegen, hing wesentlich von den politischen Verhältnissen in den Durchreise- und Zielgebieten ab. Nachdem die islamische Eroberung zuerst der Pilgerfahrt einen Riegel vorgeschoben hatte, normalisierte sich die Situation im Verlauf des 8. und 9. Jahrhunderts. Die militärischen Erfolge, die im 10. Jahrhundert die byzantinischen Kaiser im Vorderen Orient erzielten, wirkten sich auch auf die christliche Jerusalemwallfahrt aus. Zwar konnte die Heilige Stadt selbst nicht eingenommen werden, aber der Weg von Konstantinopel nach Syrien war nunmehr byzantinisch kontrolliert, und mit den Fatimiden im Westen war das Verhältnis derart, dass die Weiterfahrt nach Jerusalem recht unbeschwerlich war. Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts lässt sich denn auch – vielleicht ausgelöst durch das Millennium der Passion Christi – eine Zunahme der westlichen Pilgerreisen ins Heilige Land beobachten (s. Der Große Zug von 1064).
Erschwernisse des Pilgerverkehrs
Diese Entwicklung erfuhr einen gewissen Rückschlag durch die seldschukische Invasion. Die weitgehende muslimische Kontrolle über Kleinasien und die herrschaftliche Zersplitterung der Region behinderten nun die Reise über den Landweg, und der Seeweg nach Palästina war gefährlich und unerschwinglich zugleich. Obendrein war die fatimidische bzw. seldschukische Herrschaft nicht in der Lage, die Situation in Palästina vollständig zu kontrollieren, sodass die Pilger immer wieder Gefahr liefen, Opfer von Räubern zu werden. Doch trotz aller Beschwernisse hielt der Strom ins Heilige Land an. Es ist wohl berechtigt anzunehmen, dass wenn ein Kreuzfahrer vor seinem Aufbruch ins Heilige Land überhaupt Kontakt zur islamischen Welt gehabt hatte, es in aller Regel weniger als Kämpfer in Spanien oder Sizilien denn als Pilger gewesen war. Papst Urban II. soll dieses Faktum in seiner Rede in Clermont selbst angesprochen haben, als er daran erinnerte, dass wohl viele der Anwesenden selbst ins Heilige Land gepilgert waren oder jemand kannten, der dies getan hatte.
E
Der Große Zug von 1064
Berühmt ist der große Pilgerzug, den im Jahre 1064 Bischof Gunther von Bamberg mit anderen hohen Würdenträgern des Reiches unternahm und an dem angeblich über 7000 Pilger teilnahmen. Zeitgenössische Quellen wie die Annalen von Niederaltaich und die Chronik Lamperts von Hersfeld (* vor 1028, † nach 1081) wissen von der Fahrt und den Beschwernissen zu berichten, die auf dem langen Weg über Ungarn, Byzanz und Syrien zu erdulden waren: Räuber, Betrüger und Wegelagerer setzten den Pilgern zu, und diese wehrten sich. Allerdings war dies durchaus ungewöhnlich und den unmittelbaren Umständen des Zuges geschuldet: Die Quellen erzählen ganz ausdrücklich, dass die meisten Pilger (wie es im Grunde vorgegeben war) unbewaffnet nach Osten zogen. Auch in seiner Größe war der Zug von 1064 eine Ausnahmeerscheinung; doch geben die Chroniken und Erzählungen einen guten Eindruck von den allgemeinen Mühen des Pilgerns. Sie lassen zugleich erkennen, wie häufig Konflikte aufgrund von interkulturellen Missverständnissen zustande kamen. Auch wenn die Zahlen der großen Fahrt von 1064 übertrieben sein dürften, drücken sie doch eine Tendenz dieser Zeit aus.
Auch die besondere Würde Jerusalems als Pilgerzentrum wurde von Urban II. als Motivationspunkt ins Spiel gebracht, indem er in drastischen Bildern darstellte, wie die heiligen Stätten angeblich entweiht und besudelt wurden. Viele Kreuzfahrer verstanden ihr Unternehmen daher offenbar ganz wesentlich als einen Zug zur Befreiung des wichtigsten aller Heiligtümer Palästinas, des Grabes Christi. Jerusalemverehrung und Jerusalemsehnsucht spielten beim Einzelnen eine nicht zu unterschätzende Rolle, wie Briefe und Urkunden der Kreuzfahrer eindrucksvoll belegen. Unabhängig davon, ob der Papst in erster Linie die bedrohten Christen im Osten unterstützen wollte: Für viele Teilnehmer am Ersten Kreuzzug, aber auch an späteren Unternehmungen bestand ihr persönliches Ziel darin, ins Heilige Land zu ziehen, um Jerusalem zu „befreien“, zu beschützen oder zurückzuerobern – ganz nach der jeweiligen politischen Situation.
Pilgerfahrt und Kreuzzug: rechtliche und terminologische Ähnlichkeiten
Die Nähe zwischen Pilgerfahrt und Kreuzzug drückte sich auch terminologisch aus, denn lange Zeit wurden sie nicht klar geschieden: Kreuzfahrer und Pilger wurden gleichermaßen als peregrini bezeichnet. Iter (Weg, Marsch, Reise), expeditio (Ausmarsch) oder eben peregrinatio (Wallfahrt, Pilgerfahrt) waren die geläufigen Bezeichnungen des Zuges. Das altfranzösische croiserie kam als Begriff ebenso wie die Termini für Kreuzfahrer und Kreuzfahrerin (crucesignatus) erstmals Ende des 12. Jahrhunderts auf, cruciata gar erst im Spätmittelalter und Humanismus. Pilgern und der Kampf zum Wohle Gottes: Beide Handlungsweisen brachten dem Einzelnen Heil und Läuterung. Diese Nähe lässt sich auch in rechtlicher Hinsicht und in der äußeren Kennzeichnung feststellen: Pilger wie Kreuzfahrer legten einen Eid, ein freiwilliges und feierliches Versprechen gegenüber Gott, ab. Sie wurden dadurch auf Zeit in den geistlichen Stand versetzt – mit allen moralischen Pflichten, die damit verbunden waren – und unterstanden der kirchlichen Rechtsprechung. Um diesen besonderen Status kenntlich zu machen, legte sowohl der Pilger als auch der Kreuzfahrer ein Kreuzeszeichen an.
Dennoch: So wichtig das Pilgerwesen für die Entstehung der Kreuzzüge war, es gab auch wesentliche Unterschiede zwischen Pilgern und Kreuzfahrern, die es verhindern, beide trotz mancher Ähnlichkeiten gleichzusetzen: Die besondere Attraktivität, welche die Teilnahme an einem Kreuzzug gerade für Laien und insbesondere für Waffenträger besaß, lag darin begründet, dass diese Heiligung durch den Kampf erfolgte. Der Pilger dagegen sollte immer unbewaffnet ziehen. Auch wenn diese Auflage in Anbetracht der Gefahren nicht immer befolgt wurde: Die Kreuzzugsheere brachen ausdrücklich zum Zwecke des Krieges auf, dies war ein substanzieller Unterschied. Der bewaffnete Kampf als Akt der Sühne, als ein Mittel zur persönlichen Läuterung, als Werkzeug Gottes – dies war in der Tat etwas Neues.