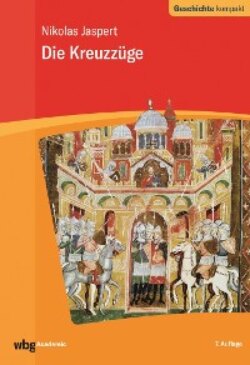Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 17
b) Neue Orden und religiöse Bewegungen
ОглавлениеAls Heil vermittelnde Institutionen wirkten Orden, Klöster und andere geistliche Einrichtungen stark auf die Vorstellungen der Zeitgenossen ein. Denn die Gläubigen waren von der Sorge um ihr Seelenheil angetrieben, was immer wieder in der Überlieferung – sowohl in den Kreuzzugsbriefen als auch in den Fassungen des Kreuzzugsaufrufs – zum Ausdruck kommt. Im Folgenden sollen die wichtigsten Orden und religiösen Bewegungen des 10. bis 13. Jahrhunderts vorgestellt werden. Die älteste unter ihnen war der Klosterverband von Cluny.
Zweierlei machte die besondere Attraktivität des 911 gegründeten Klosters und seiner Tochterhäuser aus: Zum einen waren Cluniazenserklöster direkt dem Papst unterstellt. Dadurch wurden sie dem Zugriff der lokalen Bischöfe entzogen, was ihnen eine relative Selbstständigkeit garantierte. Noch wichtiger war zum anderen, dass die Mönche nicht bloß monastische Selbstheiligung betrieben, sondern sich intensiver als andere Verbände der geistlichen Fürbitte widmeten. Daher ihre herausragende Popularität beim Adel ihrer Zeit, der hier besonders intensiv mit geistlichen Zentren in Kontakt kam. Dies drückte sich u.a. in Schenkungen und Stiftungen aus, aufgrund deren das Mutterhaus Cluny eine Vielzahl lose mit ihr verbundener Tochterklöster vor allem in Italien, Frankreich und Spanien gewinnen bzw. gründen konnte. Die enge Verbindung zum Reformpapsttum und insbesondere zum Adel machten die Cluniazenserklöster zwar zu Trägern zweier allgemeiner Aspekte der Kreuzzugsbewegung: der Verchristlichung der Ritterschaft und der Unterordnung unter das Papsttum; aber die jüngere Forschung hat gezeigt, dass der Einfluss Clunys auf die Entstehung der Kreuzzüge seine Grenzen hatte. Wichtiger noch scheinen die neuen religiösen Bewegungen des 11. Jahrhunderts gewesen zu sein.
Religiöse Reformbewegungen
In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ist allenthalben – im Christentum wie in Islam und Judentum – ein Aufbruch religiöser Kräfte festzustellen: Im muslimischen Bereich schlug sich die geistige Renaissance in der Gründung theologischer Bildungsanstalten nieder, und im Maghreb entstand die strenggläubige Bewegung der Almoraviden. In Byzanz gingen von den Mönchen des Berges Athos neue Impulse aus, und der Klerus brachte sich wieder verstärkt in politische Belange ein. Im Judentum ist ebenfalls ein neues Selbstverständnis festzustellen, z.B. anhand der öffentlichen Verteidigung des eigenen Glaubens in so genannten Disputationen mit christlichen Theologen. Auch im lateinischen Westen begannen zur Zeit des Ersten Kreuzzugs gerade neue Formen religiosen, d.h. gemeinschaftlichen, geregelten geistlichen Lebens, das Gesicht der lateinischen Christenheit grundlegend zu ändern.
Einige dieser neuen Bewegungen waren eremitisch geprägt, d.h., sie propagierten einen Rückzug aus der Welt zum Zwecke der Selbstheiligung. Die neuen Orden der Kartäuser und Grammontenser vertraten diese Richtung. Eine neue benediktinische Reformbewegung entstand in Burgund in den Jahren zwischen dem Aufruf zum Ersten Kreuzzug (1095) und der tatsächlichen Eroberung Jerusalems im Jahre 1099: diejenige der Zisterzienser. Diese Mönche wollten sich gegen den liturgischen Prunk der Cluniazenser absetzen und zu den einfachen, weltabgeschiedenen Idealen der Regel des hl. Benedikt von Nursia (* ca. 480, † ca. 560) zurückkehren. Im Jahre 1098 gründete Robert von Molesme (ca. 1028–1111) in einem einsam gelegenen Tal bei Dijon namens Cîteaux ein Kloster, das sich bald zum Mutterhaus und Namensgeber des allumspannenden, viele hundert Klöster umfassenden Ordens entwickeln sollte. Für die Geschichte des Ersten Kreuzzugs können die Zisterzienser keine Bedeutung beanspruchen, doch durch ihren berühmtesten Abt, Bernhard von Clairvaux, traten sie mit aller Wucht in die Geschichte der Kreuzzüge ein. Bernhard von Clairvaux war nicht nur ein außerordentlich tatkräftiger Abt, unter dem der Zisterzienserorden eine unglaubliche Ausdehnung erlebte, er war auch ein großer Theologe, Mystiker und begnadeter Prediger, der intensiv für den Kreuzzug von 1147–1149 warb (vgl. Kap. II., 2. a). Auch in der Folge sind Zisterziensermönche vielfach als Kreuzzugsprediger belegt, auch wenn ihr Orden in den „Kreuzfahrerstaaten“ selbst keine bedeutende Rolle spielen sollte.
Die Regularkanoniker
Dies taten hingegen die Regularkanoniker, und zwar vom Beginn des Ersten Kreuzzugs an. Unter ihnen hat man Kleriker – also keine Mönche – zu sehen, die in Gemeinschaft nach der Regel des hl. Augustinus leben, weshalb sie auch als Augustiner-Chorherren bezeichnet werden. Im Gegensatz zum so genannten Säkularkanoniker verstehen Regularkanoniker die augustinische Auflage zur so genannten vita communis dahingehend, dass sie nicht nur in einem Refektorium gemeinsam essen, sondern auch unter einem Dach schlafen. Vor allem aber verfügen sie über kein eigenes Vermögen, sie leben in persönlicher Armut. Diese Form des strengeren religiosen Lebens stellte im 11. Jahrhundert eine Neuerung, eine Reformbewegung dar, die gerade zur Zeit des Ersten Kreuzzugs viele Anhänger fand. Dies schlug sich, wie an anderer Stelle gezeigt wird, auch im kirchlichen Leben der Kreuzfahrerherrschaften nieder (vgl. Kap. III., 3. c). In unserem Zusammenhang sind die geistesgeschichtlichen und theologischen Grundlagen der Regularkanonikerbewegung wichtiger, da sie auf die einzelnen Kreuzfahrer einwirkten und deshalb als eine Vorbedingung bzw. Motivation der Kreuzzüge anzusehen sind. Die Regularkanonikerbewegung fußte nämlich auf einer allgemeinen Zeiterscheinung: dem Christozentrismus, einer Rückbesinnung auf Christus (s. Die Nachfolge Christi).
Auch die so genannten Wanderprediger beriefen sich auf die Nachfolge Christi. Unter ihnen versteht man Männer, die das Ideal der vita activa ganz im Sinne eines „Lebens in der Welt“ verfolgten: Sie predigten, sammelten Gläubige um sich und zogen mit ihnen übers Land. Die Kirche beobachtete ihre Aktivitäten mit einer gewissen Skepsis, und einige Wanderprediger gelangten tatsächlich mit ihr in Konflikt. Andere hingegen wurden mit ihren Gemeinschaften in die Kirche integriert oder schufen sogar eigene Orden wie Robert von Arbrissel († 1117), der Gründer des Ordens von Fontevrault, oder Norbert von Xanten († 1134), der Gründer des Prämonstratenserordens. Dass die Bewegung der Wanderprediger unmittelbar mit derjenigen der Kreuzzüge in Zusammenhang stand und das Ideal der Christusnachfolge eine starke Zugkraft besaß, wird auch daran erkennbar, dass im Sommer 1096 ganze Menschenmassen durch das Wirken von Wanderpredigern dazu bewogen wurden, sich den so genannten Volkskreuzzügen anzuschließen.
E
Die Nachfolge Christi (imitatio Christi)
Das 11. Jahrhundert ist vom Bestreben der Gläubigen gekennzeichnet, dem Vorbild Christi zu folgen; man spricht daher von der imitatio Christi. Ein apostelgleiches, aktives Leben (vita activa) in Armut und im Dienst am Nächsten war das Ziel vieler Laien und Kleriker. Die imitatio Christi dürfte den Entschluss mancher Männer oder Frauen ausgelöst haben, das Kreuz zu nehmen und damit Christus zu folgen. Sie konnten dabei auf eine Bibelstelle verweisen, Matthäus 16, 24: „Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.“ Diejenigen, die das Kreuz nahmen, ihre Habe zurückließen und die Stätten des Wirkens Christi eroberten, dürften vor dem Hintergrund dieser Worte davon überzeugt gewesen sein, den Willen des Herrn auszuführen.
Während manche der bislang angeführten Voraussetzungen und Motivationen, die zur Teilnahme am Kreuzzug führten (etwa die hohe Bedeutung der Ehre, des Besitzes oder der Vasallentreue), eher in der Vorstellungswelt des Ritterstands beheimatet waren, war die religiöse Unruhe, auf die viele Wander- und Kreuzzugsprediger aufbauten, ein Zeitphänomen, das breite Bevölkerungsschichten ergriffen hatte. Dies war keineswegs auf den Ersten Kreuzzug beschränkt: Der so genannte Kinderkreuzzug von 1212 wurde ganz wesentlich von Wanderpredigern initiiert und stellte eine Massenbewegung nicht nur Jugendlicher, sondern auch Mittelloser dar (vgl. Kap. II., 2. b).
Die Bettelorden
Auch Ordensgründungen des 13. Jahrhunderts sollten ihren Teil zur Geschichte der Kreuzzüge und der Kirche Palästinas beitragen. Jenes Jahrhundert war ohne jeden Zweifel das der Bettelorden (Mendikantenorden). Von den vielen Gruppen, die am Ende des 12. und im Verlauf des 13. Jahrhunderts nicht nur die persönliche, sondern auch die kollektive Armut auf ihre Fahnen schrieben und ihre Mitglieder zu einem Leben der Demut, des Bettels und damit der äußersten Nachfolge des armen Christus verpflichteten, sollten lediglich vier Aufnahme in die Kirche finden: die Dominikaner (ordo praedicatorum – OP), Franziskaner (ordo fratrum minorum – OFM), die Augustiner-Eremiten (ordo erimitarum Sancti Augustini – OESA) und die Karmeliter (ordo fratrum beatae Mariae virginis de Monte Carmelo – OCarm). Auf die Karmeliter, die im Königreich Jerusalem entstanden, soll an anderer Stelle eingegangen werden (Kap. III., 3. b). Hier gilt es, die Rolle zu betonen, die besonders die Dominikaner und Franziskaner im Spätmittelalter für die Kreuzzüge und die Kreuzfahrerherrschaften spielten: zum einen als Kreuzzugsprediger im Westen, zum anderen in Übersee für die Seelsorge der Christen und als Missionare. Bettelordensmönche oder einem Mendikantenorden assoziierte Männer riefen immer wieder zur Wiedererlangung des Heiligen Landes auf und entwarfen dazu Pläne für die Machtträger ihrer Zeit (vgl. Kap. II., 2. d). In nicht geringem Maße trugen die Bettelorden zum Fortleben der Kreuzzugsidee im Spätmittelalter bei. Dazu mussten die Geistlichen allerdings bei den Gläubigen auf Resonanz stoßen, oder anders formuliert: Die Option, an einem Kreuzzug teilzunehmen, musste einem elementaren Bedürfnis des Einzelnen entgegenkommen.