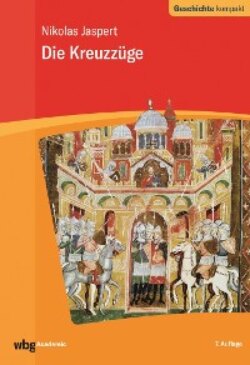Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 16
3. Papsttum, Frömmigkeit und Ablass a) Das Reformpapsttum
ОглавлениеEin bestimmendes Element der Kreuzzüge war das Papsttum, unter anderem deshalb, weil Kreuzzüge durch offizielle päpstliche Aufrufe initiiert wurden. Deren berühmtester ist die Rede Urbans II. am 27. November 1095 in Clermont. Darin benannte der Papst schon viele der „Vorbedingungen“ für die Kriegszüge, wie sie im Folgenden aus heutiger geschichtswissenschaftlicher Sicht verdeutlicht werden sollen. Papst Urban ging also mit seiner Rede auf Vorstellungen, Wünsche und Ängste ein, die bereits in der Bevölkerung vorhanden waren. Allerdings ist sein Aufruf in vier stark voneinander abweichenden Fassungen überliefert, die im nächsten Kapitel genauer vorgestellt werden.
E
Urban II. (* 1035, † 1099), Sohn eines Adligen aus der Champagne, war vor seiner Erhebung auf die Cathedra Petri Prior des berühmten benediktinischen Reformklosters von Cluny in Burgund gewesen. Als solcher kannte er bestens die ritterlich-adlige Welt, der er überdies selbst entstammte. Er hatte unmittelbar am Investiturstreit teilgenommen, indem er als Legat in Frankreich und Deutschland die Präsenz des Papsttums außerhalb Italiens zu stärken suchte. Noch zur Zeit des Ersten Kreuzzugs sah er sich den Ansprüchen eines Gegenpapstes, des kaiserlichen Kandidaten Clemens (III., † 1100), ausgesetzt. Auch wenn Urban nicht mehr vom Erfolg des von ihm ins Leben gerufenen Unternehmens erfahren sollte – er starb am 29. Juli 1099, bevor ihn die Nachricht von der Eroberung Jerusalems erreichen konnte –, blieb sein Name unlösbar mit dem Ersten Kreuzzug verknüpft. Darüber sind seine vielfältigen anderen Aktivitäten in der Erinnerung zurückgetreten: sein seit 1089 verfolgter Einsatz für einen Ausgleich mit Byzanz, mit dem er trotz fortbestehender theologischer Unstimmigkeiten einen einvernehmlichen Modus Vivendi fand, sein Bemühen um die Kirchenreform u.a.m.
Wie konnte der Papst und damit eine den Frieden predigende Kirche zum bewaffneten Kampf aufrufen? Schon im 4. Jahrhundert war die christliche Kirche fester Bestandteil des Römischen Reichs, was zu einer Identifikation zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft führte. Später, in karolingischer Zeit, wurde das Christentum durch Heidenkrieg und Heidenmission ausgeweitet, woran sich auch der Klerus beteiligte. Im 9. Jahrhundert lassen sich zum ersten Mal Belege dafür finden, dass Päpste den bei der Verteidigung der römischen Kirche Gefallenen die Aufnahme ins Paradies zusagten. Eine neue Stufe dieser Entwicklung wurde zwei Jahrhunderte später erreicht.
Papsttum und Krieg im 11. Jahrhundert
In der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts war die römische Kirche noch lange nicht die weltumspannende Korporation späterer Zeiten. In manchen Bereichen der lateinischen Christenheit wie z.B. Böhmen oder Teilen der Iberischen Halbinsel wurde eine eigene Liturgie anstelle der römischen befolgt, und auch in anderen Gegenden wurde die Autorität des Papsttums keineswegs vollständig anerkannt. Der römische Bischof selbst war von den Machtverhältnissen in Italien abhängig und nicht selten auch bedroht. Vom Süden gefährdeten die Normannen, vom Norden die mächtigen römisch-deutschen Könige seine Stellung, und in Rom selbst waren es die lokalen Adelsfaktionen, die ein Sicherheitsrisiko darstellten. Im Jahre 1053 sah sich Papst Leo IX. (1049–1054) dazu veranlasst, Krieger zum Kampf gegen die Normannen in Süditalien herbeizurufen. Er versprach ihnen für ihren Einsatz zur Verteidigung der Kirche auch spirituellen Lohn, nämlich den Erlass der Bußstrafen. Hier nun lässt sich mit aller Klarheit beobachten, wie der Papst den Kampf zum Wohle seiner Kirche als ein frommes Werk postulierte.
Zugleich vollzog sich im 11. Jahrhundert eine Expansion des lateinischen Christentums. Zwischen 1061 und 1091 vertrieben die Normannen die Muslime aus Sizilien. Weiter im Westen gelang es den Christen auf der Iberischen Halbinsel, nach Süden vorzustoßen und 1085 Toledo zu erobern. Päpste wie Nikolaus II. (1058–1061) und Alexander II. (1061–1073) begrüßten bzw. förderten diese Entwicklung. Sie söhnten sich mit den Normannen aus und lobten die Auseinandersetzung mit den Muslimen als religiös geprägte Kämpfe zum Wohle des Herrn. Manchmal gingen sie auch weiter: Im Jahre 1064 z.B. versprach Papst Alexander II. ausdrücklich französischen Rittern, die zur Eroberung der muslimischen Stadt Barbastro nach Aragón gezogen waren, Ablässe. Wichtig war in diesem Zusammenhang, dass es sich sowohl bei Sizilien als auch bei der Iberischen Halbinsel um ehemals christlich beherrschte Gebiete handelte, die von den Muslimen erobert worden waren und nun unter dem Schlagwort der liberatio (Befreiung) wieder an das Christentum zurückfallen sollten. Im Umkreis des päpstlichen Hofs sah man in den unterschiedlichen Auseinandersetzungen gegen die Muslime etwas Gemeinsames. Unter Papst Gregor VII. (1073–1085) ging die Unterstützung einen wesentlichen Schritt weiter: Nach der Niederlage der Byzantiner gegen die Seldschuken bei Mantzikert beabsichtigte er im Jahre 1074 sogar, selbst ein Heer zur Unterstützung der Mitchristen nach Byzanz zu führen, womit zum ersten Mal überhaupt ein Feldzug unter päpstlicher Führung ins östliche Mittelmeer propagiert wurde. Doch der Plan zerschlug sich bald, weil der Papst sich bald in einen anderen, größeren Konflikt eingebunden sah.
Die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts
Scheinbar paradoxerweise hatte eine kirchenreformerische Bewegung, welche gerade die Trennung von Weltlichem und Geistlichem forderte, entscheidenden Anteil an dem sich im 11. Jahrhundert wandelnden Verhältnis der Kirche zur Gewalt: Das Reformpapsttum und die nach seinem berühmtesten Vertreter, Papst Gregor VII. benannte „gregorianische Reformbewegung“ verfolgten insbesondere drei Anliegen: Zum einen wandten sie sich gegen die schon seit dem Frühmittelalter gepflegte Tradition, geistliche Stellen von Laien besetzen zu lassen, d.h. gegen die so genannte Simonie. Zum anderen forderten sie von den Klerikern den Zölibat, bekämpften also die Priesterehe. Zum Dritten setzten sie sich für die libertas ecclesiae im Allgemeinen ein. Darunter verstanden die Reformer die Freiheit der Kirche von Einflussnahme seitens der Laien, eine Rückkehr zu vermeintlich verloren gegangener Reinheit. Der Bewegung lag weniger der Wunsch nach Unabhängigkeit zugrunde als die Sorge um die rechte Form der ureigensten Aufgabe der Kirche, der Heilsvermittlung. Diese sahen die Reformer durch die Verflechtung mit dem Laienstand bedroht.
Darüber gerieten die Reformpäpste mit weltlichen Machthabern in Konflikt, zuerst und am schärfsten mit den römisch-deutschen Königen. Diese genossen gerade in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts einen starken Zugriff auf kirchliche Belange, setzten regelmäßig Bischöfe ein und in Ausnahmefällen sogar Päpste ab. So beseitigte z.B. im Jahre 1046 Kaiser Heinrich III. (1039–1056) ein Schisma (Kirchenspaltung) dadurch, dass er drei rivalisierende Anwärter auf die Papstwürde absetzte und einen weiteren an ihrer Stelle benannte. Auch unterhalb der königlichen Ebene griffen Laien direkt in kirchliche Belange ein, am deutlichsten durch das so genannte Eigenkirchenwesen. Damit wird die hoheitliche Verfügung über Kirchen durch Laien bezeichnet. Gegen diese und andere Formen der Einflussnahme erhob sich im Klerus und auch in Teilen der Laienschaft Widerstand. Besonders umstritten war das vom Herrscher beanspruchte Recht, Bischöfe und Äbte symbolisch in ihr Amt einzusetzen, zu investieren – daher die Bezeichnung Investiturstreit. Den Höhe- oder vielleicht besser: Tiefpunkt dieser Entwicklung bildete der Streit zwischen Papst Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. (1056–1106), in dessen Verlauf es zu gegenseitigen Absetzungen und dem berühmten Gang nach Canossa (1077) kam. Hier kann nicht die Geschichte dieser Auseinandersetzung geschildert werden. Es reicht aus, für unseren Zusammenhang drei Punkte zu unterstreichen.
Erstens handelte es sich beim Investiturstreit um einen Konflikt, der in unterschiedlicher Schärfe und zeitlich versetzt in verschiedenen Reichen des lateinischen Westens ausgetragen wurde. Dies bedeutet, dass manche Machthaber aufgrund dieses oder eines anderen Konflikts mit dem Papsttum als Adressaten eines Kreuzzugsaufrufs nicht in Frage kamen. So war z.B. zur Zeit des Ersten Kreuzzugs Kaiser Heinrich IV. wegen der Investiturfrage exkommuniziert, der englische König Wilhelm II. Rufus (1087–1100) war mit dem Erzbischof von Canterbury zerstritten, und König Philipp I. von Frankreich (1060–1108) stand wegen einer eherechtlichen Kontroverse unter päpstlichem Bann. Ihre Teilnahme am Zug kam daher nicht in Frage. Ähnliche Umstände sollten in der Folge immer wieder Machtträger von einer möglichen Koalition der Kreuzfahrerfürsten fern halten. Der Zug Friedrichs II. (1212–1250) in den Jahren 1227–1229 z.B. wurde nicht zuletzt wegen des Konflikts zwischen Kaiser und Papst zu einem militärisch reduzierten Unternehmen.
Festigung der kirchlichen Organisation
Zweitens führte die Reformbewegung zu einer verschärften Einflussnahme des Papstes auf die Kirchenstruktur entfernter Gebiete. Die Reformpäpste deuteten das Prinzip einer aktiven Heilsvermittlung und das neue Fürsorgeverständnis dahingehend, auch entlegene Kirchenprovinzen zu besuchen. Waren sie selbst dazu nicht in der Lage, so wurden Vertreter päpstlicher Interessen, so genannte Legaten, entsandt. Auch diese trieben die Reformen voran und saßen den Synoden, regionalen Versammlungen hoher kirchlicher Würdenträger, vor. Die hier gefällten Entscheidungen (canones) wurden gesammelt und zu einer wesentlichen Grundlage des Kirchenrechts (Kanonistik). Sie hatte ihrerseits entscheidenden Anteil daran, die auf das Papsttum zentrierte Kirche in eine rechtlich geschlossene Körperschaft zu verwandeln. Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Zentralisierung und Ordnung der Kirche wird verständlich, warum der Erste Kreuzzug außerhalb Italiens und auf einer besonders umfassenden Kirchenversammlung, dem Konzil von Clermont, ausgerufen wurde. Die neuen kirchlichen Kommunikationsstrukturen wiederum gewährleisteten, dass die Botschaft vom Aufruf verteilt wurde und Menschen erfasste, die nicht in Clermont zugegen gewesen waren. Das Kreuz wurde von Geistlichen gepredigt, päpstliche Briefe verbreiteten die Kenntnis vom Aufruf und von der Haltung der Kirche. Die Festigung der kirchlichen Organisation im Innern war allerdings noch nicht mit dem Gedanken der Mission nach außen verknüpft: Weder für die Päpste noch die Kreuzfahrer des Ersten Kreuzzugs spielte der Gedanke einer Missionierung der Muslime eine wesentliche Rolle.
Die Kreuzfahrer als Volk Gottes
Drittens schließlich beschränkte sich die verstärkte Einflussnahme nicht allein auf kirchliche Angelegenheiten. Die Reformpäpste riefen auch zu militärischen Aktionen auf oder gaben diesen ihre ausdrückliche Unterstützung: So forderten sie die Einwohner Mailands auf, sich gegen die „Simonisten“ zu erheben, und der Angriff des normannischen Herzogs Wilhelm auf England im Jahre 1066 erfolgte mit ausdrücklicher Billigung Alexanders II., weil der angelsächsische König Harald einen heiligen Schwur gebrochen hatte. Der Papst ließ dem Herzog eine Petersfahne (vexillum sancti Petri) zukommen, unter der die Eroberung vonstatten ging. Der Investiturstreit wiederum bedingte eine Distanzierung des Papsttums von seinem traditionellen Beschützer, dem Kaiser. Die Päpste sahen sich daher veranlasst, die Sache des Krieges in die eigene Hand zu nehmen, sich selbst zu Schutzherren der Kirche zu machen. Die höchste geistliche Instanz, ja der Nachfolger Petri selbst autorisierte damit explizit den Krieg – hier war die augustinische Bedingung für einen gerechten Krieg Deo auctoritate gegeben. Dass die Kreuzfahrer den im Zuge des Investiturstreits gewachsenen päpstlichen Autoritätsanspruch allgemein anerkannten, geht aus den Briefen und Urkunden unzweifelhaft hervor. Daraus wird verständlich, warum sich die Kreuzfahrer in Analogie zu einer anderen Gruppe sahen, die sie aus der Bibel kannten: dem Volk Israel. Tatsächlich sahen und bezeichneten sie sich in ihren Briefen und Urkunden in Anlehnung an den Aufbruch Abrahams aus Ur und des Volkes Israel aus Ägypten selbst als das Neue Volk Israels, als das Heer Gottes (exercitus Dei), angeführt von einem Vertreter des Papstes, den sie als alter Moses (zweiten Moses) sahen. Das Konzept des Kreuzzugs konnte also am Grundwissen des mittelalterlichen Menschen, der Bibel, anknüpfen und dessen Handeln unmittelbar als Element des Heilsgeschehens definieren. Aus dem gerechten Krieg wurde hierdurch vollends ein Krieg für Gott, ein heiliger Krieg.