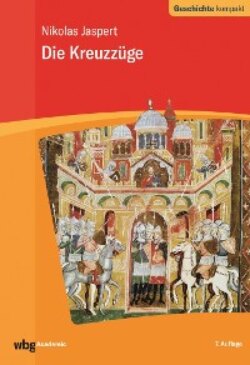Читать книгу Die Kreuzzüge - Nikolas Jaspert - Страница 13
2. Heiliger Krieg, Rittertum und Pilgerfahrt a) Gerechter Krieg – heiliger Krieg
ОглавлениеDer Kreuzzugs gedanke
Der Erste Kreuzzug wurde zu Recht sowohl von Zeitgenossen als auch von den Nachlebenden als etwas Neues wahrgenommen. Gleichwohl beruhte er auf einer Reihe von Grundlagen, die oft weit zurückreichten. Sie waren häufig politischer und sozialer Natur oder gehörten in den Bereich der mittelalterlichen Vorstellungen und der Frömmigkeit. Sie gilt es in den folgenden beiden Kapiteln darzustellen. Dies ist umso nötiger, als sie den meisten modernen Menschen fremd sind. Diese Vorbedingungen brachten im Verbund das hervor, was man als „Kreuzzugsgedanken“ bezeichnen kann: die geistige bzw. ideologische Grundlage für die Expeditionen. Dieser Gedanke wirkte unterschiedlich stark auf die Kreuzzugsbewegung, ihre intellektuellen Anführer sowie auf den einzelnen Kreuzfahrer als Individuum. Eine große Anzahl von Quellen unterrichtet uns hiervon; die erhaltenen Urkunden und Briefe von Kreuzfahrern tun dies auf besonders direkte Weise.
Die Kreuzzüge werfen heute ebenso wie in früheren Zeiten die Frage nach der Berechtigung des Krieges auf. Das Christentum gründet wesentlich auf dem friedlichen Wirken Christi. Es hatte daher im Gegensatz zum Islam – dessen Prophet sowohl ein geistlicher als auch ein militärischer Führer war – einen großen Gegensatz zu lösen: Es musste die widersprüchlichen Äußerungen der Bibel über den Krieg miteinander vereinbaren. Dem fünften Gebot „Du sollst nicht töten“ oder den Friedensworten Jesu standen viele andere Stellen gerade des Alten Testaments entgegen. Die offizielle Übernahme des Christentums im Römischen Reich zu Beginn des 4. Jahrhunderts änderte nichts daran, dass dort weiterhin Krieg geführt wurde. Manche christlichen Krieger wurden „zur Ehre der Altäre erhoben“, d.h. heilig gesprochen. Bischöfe übernahmen im Frühmittelalter vielfach die Funktion von Stadtherren und mussten als solche die Sicherheit ihrer Herrschaften garantieren – auch mit Waffengewalt. Mit den daraus resultierenden theologischen Herausforderungen setzte sich auch der Klerus auseinander: Er stellte ein Gedankengebäude zur Verfügung, das als Grundlage für den Krieg im Mittelalter und darüber hinaus diente – die Theorie vom gerechten Krieg. Diese wurde in wesentlichem Maße von Augustinus geprägt.
E
Augustinus (354–430) war Bischof von Hippo Regius im heutigen Algerien. In der Auseinandersetzung mit der Häresie der Manichäer, die den Krieg als solchen und deshalb auch das Alte Testament verwarfen, benannte er in seinem Werk ›Contra Faustum Manicheum‹ Voraussetzungen für einen gerechten Krieg. Vier Kriterien mussten gegeben sein: die Kriegserklärung durch eine legitime Autorität, ein gerechtfertigter Kriegsgrund, das Fehlen einer anderen Lösungsmöglichkeit und eine angemessene Form der Kriegführung. Augustinus trennte die innere Einstellung des Kämpfenden von seinen Taten, sodass nunmehr die Legitimität des Kriegsgrunds zu einem Kriterium für die Gerechtigkeit oder das Unrecht eines Kriegs wurde. Weiterhin definierte er: Rechtmäßig handele derjenige, der Land, Gesetz oder Sitten gegen Aggression verteidige, ein Gerichtsurteil erzwinge, Unrecht bestrafe oder geraubtes Gut wiedererlange. Außerdem seien Kriege gerecht, die auf Veranlassung Gottes (Deo auctoritate) durch eine von ihm eingesetzte weltliche Autorität geführt würden. Doch sollte der Krieg nicht als Mittel zur Bekehrung oder zur Vernichtung von Heiden dienen. Im Kern war die augustinische Lehre vom gerechten Krieg (bellum iustum) denn auch gegen Glaubensfeinde im Inneren gerichtet. Die Wiederherstellung des gestörten Friedens war dabei das vordringliche Ziel, deshalb verstand der Bischof Kriegführung als einen Akt der Nächstenliebe. Christliches Handeln war damit auch im Kriege gewährleistet, Augustinus hatte eine neue Kriegsethik geschaffen.
Das augustinische Gedankengebäude ging im Frühmittelalter weitgehend verloren. Nicht die innere Haltung des Menschen und das Ziel seiner Handlungen, sondern allein deren Ausgang wurde für die Beurteilung entscheidend. Daher wurden auch dann noch Bußleistungen eingefordert, wenn ein Soldat auf Befehl eines legitimen Königs einen Friedensstörer oder sogar einen Aggressor getötet hatte. Das Konzept des gerechten Krieges wurde auch dann nicht reaktiviert, als im 7. Jahrhundert mit der muslimischen Expansion in der Tat die Situation einer Verteidigung gegen äußere Aggression eintrat.
Der „geheiligte Krieg“ auf der Iberischen Halbinsel
Seit dem 9. Jahrhundert trafen neue Bedrohungen das Christentum: Die Angriffe der heidnischen Wikinger und Normannen, Ungarn und Slawen im Norden und Osten sowie der Muslime im Süden und Westen ließen nicht nur im griechischen Osten, sondern auch im lateinischen Westen den von Augustinus angenommenen Fall immer wieder eintreten. Hier nun lässt sich in Einzelfällen sehr wohl eine theologische Auseinandersetzung mit dem Krieg feststellen – so auf der Iberischen Halbinsel, die zu Beginn des 8. Jahrhunderts von Muslimen erobert worden war. Im gebirgigen Norden (Asturien, León) verteidigten die Christen ihre Unabhängigkeit und begannen bald, ihr Herrschaftsgebiet allmählich nach Süden auszudehnen. Sie konnten darauf verweisen, dass es sich hierbei um ehemals christliche Territorien handelte, in denen obendrein noch Glaubensbrüder lebten. Dies allein reichte aus, um ihren Kampf zu rechtfertigen. In Asturien und León wurde ausdrücklich der Anspruch formuliert, einen gerechten Krieg, sogar einen Krieg Deo auctoritate gegen eine aggressiv auftretende Religion zu führen. Chroniken des 9. bis 11. Jahrhunderts zeichnen die Auseinandersetzung nicht nur als gerechten, sondern sogar als geheiligten Krieg: Die christlichen Herrscher werden in Parallele zu Königen des Alten Testaments gesetzt, die spanischen Christen so zum Volk Gottes, das zur Verwirklichung des göttlichen Heilsplans beiträgt.
Eine direkte Übernahme dieses Konzepts durch die Kreuzfahrer ist nicht zu belegen, aber aus Sicht der meisten christlichen Zeitgenossen waren auch die Kreuzzüge mehr als gerechte Kriege, mehr als eine Verteidigung gegen einen ungerechten Angriff. Auch sie waren geheiligt, denn hier kämpfte man nicht nur für die Verteidigung des Christentums, sondern unmittelbar für Gott. Man erfüllte seinen Willen, war Werkzeug des Herrn. Die Teilnahme an einem solchen Krieg war daher nicht mehr eine bußwürdige, sondern eine heilbringende Handlung, man kann in diesem Zusammenhang sogar von „verdienstvoller Gewaltanwendung“ sprechen. Nicht der Krieg an sich wurde also als heilig angesehen, sondern er wirkte heilbringend auf den Menschen. Diese Interpretation, die sich auch in zeitgenössischen Urkunden und Briefen findet, wurde durch die neuerliche Rezeption der augustinischen Schriften im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert gefördert und bildete eine wichtige Grundlage des Kreuzzugsgedankens. Zunehmend rückte das Vorhaben oder der innere Beweggrund, die intentio, ins Zentrum des Interesses, die Bedeutung der eigentlichen Handlung fiel dagegen zurück. Der Kreuzzug war an sich schon gerechtfertigt, aber erst die innere Einstellung machte die Teilnahme an ihm vor Gott verdienstvoll. Dies wurde ausdrücklich von Papst Urban II. (1088–1099) unterstrichen, als er ausschließlich demjenigen, der sola devotione, allein aus Gottergebenheit, ins Heilige Land aufbrach, einen Ablass (vgl. Kap. I., 3. c) in Aussicht stellte.
Krieg als Akt der Liebe oder der Rache
Schließlich wurde der Krieg gegen die Muslime dadurch in besonderem Maße gebilligt, dass er zugunsten bedrohter christlicher Mitbrüder geführt wurde. Hier kam der christliche Gedanke des Einsatzes – hier: des militärischen Einsatzes – für den Nächsten zum Tragen. Wurden die griechischen Christen nicht von den Muslimen bedroht? Mussten sie nicht um Leib und Leben fürchten? Gesandte aus dem Osten und der Papst führten den Zeitgenossen diese Bedrohung plastisch vor Augen. Manche Propagatoren des Kreuzzugs verstanden den Kampf – so ungewöhnlich diese Vorstellung heutigen Menschen erscheinen mag – als einen Akt der Liebe im Sinne des biblischen Liebesgebots, auch wenn diese Denkweise dem einfachen Kreuzfahrer eher fern stand. Eine andere, aus dem augustinischen Gedanken des gerechten Krieges abgeleitete Vorstellung fügte sich noch besser in die zeitgenössische Lebenswelt: diejenige vom Krieg zur Bestrafung des Friedensbrechers. Im 11. Jahrhundert wurde dieses Thema insbesondere für eine noch junge Gesellschaftsgruppe relevant: das Rittertum.