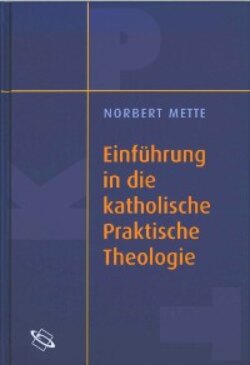Читать книгу Einführung in die katholische Praktische Theologie - Norbert Mette - Страница 10
1.1.4 Auf dem Weg zu einer kommunikativ handelnden Kirche – ein Beispiel
ОглавлениеFür eine Kirche, die sowohl in ihren eigenen Reihen als auch „nach außen“ konsequent auf die Prinzipien des Dialogs und der Kommunikation setzt, kann der 1994 von der katholischen Kirche in Frankreich in Gang gesetzte Dialogprozess unter dem Motto „Proposer la foi dans la societé actuelle – Den Glauben vorschlagen in der heutigen Gesellschaft“ (vgl. zum Folgenden 96 sowie 237, 238); als beispielhaft angeführt werden. Im Zentrum dieses Dialogprozesses steht die Frage nach einem für die heutige Zeit nachvollziehbaren Glaubensverständnis – in Anknüpfung und im Widerspruch zur „geistigen Situation der Zeit“ (K. Jaspers) – und nach dessen individueller und kollektiver Verlebendigung. Es gilt, so lautet die Devise, sich bewusst der heutigen Zeit zu stellen und nicht irgendwelchen für die Kirche vermeintlich besseren Zeiten nachzutrauern und diese womöglich repristinieren zu wollen – eine, wie eingestanden wird, lange unter den Verantwortlichen in der Kirche vorherrschende Einstellung, die ein positives und konstruktives Verhältnis zur Gegenwart zu finden hat verhindern lassen. Als vorbildlich für ein solches Auf-der-Höhe-der-Zeit-Sein ist der in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnene Weg der Arbeiterpriester in lebendiger Erinnerung der katholischen Kirche Frankreichs: Als Arbeiter haben sie sich in die Welt der Arbeiter begeben und sind völlig in deren Welt – in die Welt also, die die Kosten der modernen Gesellschaft mit ihren technischen und sonstigen Errungenschaften aufgebürdet bekommt – eingetaucht, um in ihrer praktisch gelebten Solidarität den rücksichtslos ausgebeuteten Menschen etwas von der Liebe Gottes zu ihnen erfahrbar werden zu lassen. Mittlerweile wird diese Form christlich-kirchlicher Präsenz im Sinne einer stummen bzw. verborgenen Anwesenheit problematisch, weil sie auf Christinnen und Christen angewiesen ist, die ihrerseits genügend bewusst im Glauben leben und auch von ihm wissen, um ihn ausschließlich durch ihr Mitleben mit anderen diesen zu bezeugen, genau diese Voraussetzungen aber immer weniger gegeben sind. Das heißt, dass es erforderlich ist, neben der praktisch gelebten Solidarität sich ausdrücklich des sie begründenden Glaubens zu vergewissern und ihn zu thematisieren.
Sollte es dabei allerdings nur darum gehen, überkommene Glaubensformeln zu repetieren oder aus dem Katechismus auswendig gelernte Lehrsätze weiterzugeben, wäre ein Dialogprozess überflüssig. Anders ist es, wenn der Glaube als das ernst genommen wird, was er – wirklich zu eigen geworden – ist, nämlich eine zutiefst persönliche Angelegenheit, mit der jeweils eigenen Lebensgeschichte und ihrem sozialen Kontext durch und durch verwoben. Dann wird der gemeinsame Austausch über solchen Glauben in der Tat enorm wichtig, und zwar im Sinne des Sich-gegenseitig-bereichern-Lassens von den Erfahrungen und Einsichten der anderen. Reden über den Glauben erfolgt dann so, dass es zurückgebunden bleibt an die von den Beteiligten mit ihm gemachten Erfahrungen, befreiende ebenso wie niederdrückende, freudige ebenso wie leidvolle, kreativ-schöpferische ebenso wie beklemmende, mystisch-kontemplative ebenso wie politisch-praktische. In diesem Sinne bekräftigen die französischen Bischöfe: „Wir müssen vermehrt den Gläubigen das Wort geben, damit sie in Freiheit sagen können, wie ihre Zustimmung zum Gott Jesu Christi und ihre Praxis des Evangeliums ihre Existenz auf dauerhafte Weise gestaltet, wie sie Vertrauen bewahren auch in schwierigen Lebensabschnitten, warum sie in sich den Wunsch spüren, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen und bei ihnen den Geschmack an Gott und die Liebe zur Kirche zu wecken.“5
Voraussetzung für einen Dialogprozess ist, dass sich alle – unbeschadet ihrer Position – auf ihn einlassen und nicht irgendwo über oder neben ihm stehen. Das gilt auch für die, die mit einem Amt in der Kirche betraut sind – bis hin zu den Bischöfen. Das französische „proposer la foi“ klingt in der deutschen Übersetzung „den Glauben vorschlagen“ ungewohnt und merkwürdig. Was gemeint ist, lässt sich an der Weise, wie die Bischöfe sich in den Dialogprozess eingebracht haben, modellhaft illustrieren: Auf der einen Seite positionieren sie sich. Das heißt: „Sie geben nicht vor, in dem, was sie vorschlagen, schon mit allen Katholikinnen und Katholiken oder gar mit aller Welt übereinzukommen. Vielmehr machen sie sich kenntlich, auch angreifbar. Z.B., indem sie sich absetzen von jeglichem Ressentiment gegenüber der gegenwärtigen, laizistischen französischen Gesellschaft oder indem sie dem Traum von der Rückkehr zu einer christlichen Gesellschaft eine Absage erteilen. Andererseits heißt Vorschlagen aber nicht weniger: lernen, lernen wollen. Der Vorschlag des Vorschlagens ist Resultat eines Lernprozesses, in dem die Bischöfe sich als lernbedürftig realisiert haben; und ihr Vorschlag zielt auf ein Voneinander-Lernen. Der Brief lässt nicht nur Reaktionen zu, sondern erfragt eine Antwort [von seinen Adressatinnen und Adressaten]“ (183, 4f.). Die Bischöfe geben so zu verstehen, dass sie dem gelebten Glauben und dem Unterscheidungsvermögen des „ganzen Volkes der Getauften“ (ver-)trauen. H. Müller bemerkt dazu: „Wenn sie (sc. die Bischöfe) die Katholiken dazu einladen, mit ihnen eine Kirche zu bilden, die in eigener Initiative zum Ausdruck bringt, welche Kraft zur Gestaltung und Erneuerung der Existenz der Glaube ist, so sagen sie damit, dass sie allein diese Kirche nicht bilden können, sie bekennen einen Mangel. Zusammen mit dem Bekenntnis ihres Mangels äußern die Bischöfe ihr Vertrauen, dass die von ihnen angesprochenen Katholiken Gaben haben, die ihrem Mangel abhelfen können. Sie wissen und achten dabei die Freiheit der Angesprochenen, ihre Bitte anzunehmen oder ihr gegenüber gleichgültig zu bleiben. Sie setzen sich Unverständnis und Ablehnung aus“ (236, 15f.). Zugrunde liegen dem eine Wertschätzung der persönlichen Freiheit und der Respekt vor ihr, jedoch nicht aus einem vordergründigen Zugeständnis an den „Zeitgeist“ heraus, sondern in Wiederentdeckung und Ernstnahme des originären „Gesetzes des Evangeliums“ selbst – einer Wiederentdeckung, die sich zugegebenermaßen der lange Zeit kirchlicherseits bekämpften neuzeitlichen Freiheitsgeschichte maßgeblich verdankt. „Die Zustimmung zum Gott Jesu Christi“, so umreißt der den Dialogprozess koordinierende Bischof C. Dagens die diesen Prozess leitende Überzeugung, „zeigt sich vor allem als Akt der Freiheit, als eine persönlich verantwortete Stellungnahme, die Verschiedenheit bedeutet. Die Zustimmung zum Glauben darf nicht mit dem Eintritt in ein System verwechselt werden. Vielmehr ist sie ein freies Engagement“ (164, 85.)
Wovon die Pastoral des Vorschlagens sich strikt abgrenzt, ist das „Paradigma von Angebot und Nachfrage“, wie es vom ökonomischen Denken kommend auch in die pastorale Theorie und Praxis Einzug gehalten und weite Verbreitung gefunden hat. Es begegnet – wie der französische Religionssoziologe J.-M. Donegani erhellend aufzeigt (vgl. 495, 228f.) – in zwei Varianten: In der ersten versteht sich die Kirche im Besitz der Heilsgüter und als beauftragt, sie den Menschen anzubieten, damit sie ihr Heil erlangen können, und wonach sie ihrerseits entsprechend nachfragen, wenn sie sich nicht völlig durch das Böse von sich haben entfremden lassen. Wie stark dieses Denken nachwirkt, zeigt sich darin, dass etwa auch die Soziologie gemeint hat, an den Zahlen der wahrgenommenen Nachfrage ihrer gottesdienstlichen, sakramentalen u. a. „Angebote“ den Erfolg der Kirche messen zu können – was aufgrund der immer mehr sinkenden Zahlen eine allgemeine negative Stimmungslage innerhalb der Kirche begünstigte. Die religiös-moderne bzw. liberale Variante dieses Paradigmas besteht darin, dass die Kirche alles Mögliche unternimmt, bei den Menschen zu erkunden, was diese – wenn überhaupt – bei ihr nachfragen würden, um entsprechend ihre Angebote herzurichten. Während nach J.-M. Donegani die erste Variante sich darin irrt, dass sich die Kirche für die alleinige Inhaberin eines Heiles hält, das man ergreifen könne oder nicht, trägt die zweite schon allein nicht den einschlägigen empirischen Befunden Rechnung. Donegani schreibt: „Die Glaubenssätze sind nicht mit Marktgegenständen vergleichbar, weil sie zur Sinnfrage anregen und weil das gläubige Subjekt sich ihnen gegenüber niemals wie ein Verbraucher verhält, der die Qualität und den Preis der käuflichen Güter vergleicht. Die religiöse Suche entfaltet sich ausgehend von kognitiven, evaluierenden und affektiven Prozessen, bei denen das familiäre Erbe, soziale Verbindlichkeiten und psychische Dynamismen überwiegen. Die religiöse Suche mobilisiert Prozesse, in denen die Person und die Bezugnahme zu Gruppen sich aktiv aufbauen. Damit ist sie weit von jenen Haltungen entfernt, die bei einer Marktlogik ins Spiel kommen“ (ebd., 229).
Soll Kirche sich wesentlich als Dialogprozess vollziehen und vollziehen können, hat das Rückwirkungen auch auf ihre Sozialgestalt bis hin zu ihrer strukturellen Organisationsform. Denn nicht zuletzt davon ist abhängig, ob die Freiheit des Einzelnen und dialogische Prozesse wirklich gefördert statt, wie es in der Vergangenheit vielfach der Fall war, behindert werden. Die überkommene monolithische Struktur gerade der katholischen Kirche entspricht einem monologisch-autoritären Verständnis des Glaubens. Dem Dialogprozess kommt es demgegenüber darauf an – und er fördert es auch zugleich –, die faktische Pluralität der Verständnisweisen und Ausdrucksformen des Glaubens zutage treten zu lassen. Indem diese zueinander gebracht werden, ohne zwanghaft auf eine Linie gebracht zu werden, wird ernst genommen, dass die Einheit des Glaubens nicht etwas ist, was vorgegeben werden kann, sondern was gerade in seiner gegenseitig sich bereichernden Verschiedenheit zum Vorschein kommt. So sehr somit die Meinung und Entscheidung des je Einzelnen unbedingt zu respektieren sind, so heißt das nicht schon, dass den Meinungen und Entscheidungen einer Mehrheit innerhalb der Kirche zugleich normative Kraft zukäme. Gerade hier ist Unterscheidungsarbeit notwendig; diese wiederum kann allerdings nicht von einer übergeordneten Instanz her vorgenommen werden, sondern ist wiederum von allen Beteiligten in gemeinsamer Auseinandersetzung zu leisten. Indem man sich auf dieses bisweilen durchaus mühsame Unterfangen einlässt, wird allererst und überzeugend beherzigt, dass die Wahrheit des christlichen Glaubens – wie J. M. Donegani es treffend formuliert hat – relational, d. h. beziehungsreich und somit alles anderes als relativ ist (vgl. ebd., 234f.).
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang nochmals, dass der Dialogprozess über den Glauben kein kircheninterner Vorgang ist und bleibt, sondern dass er sich als Einladung an alle Menschen richtet – einerseits in der Zuversicht, dass das Evangelium eine für ihr Leben bedeutsame Botschaft beinhaltet, andererseits verbunden mit der Offenheit, dass die Begegnung mit den Anderen auf Lesarten dieses Evangeliums aufmerksam werden lassen kann, die man so bislang nicht wahrgenommen hat und von denen man neu in seinem Glauben lernen kann.
In solchem gemeinsamen Suchen und Ergründen der Bedeutung des Geheimnisses des Glaubens für die heutigen Menschen erwächst nicht zuletzt für die Kirche die Chance, ihr eigentliches Wesen neu sehen zu lernen. Deutlicher kommt zum Vorschein, was es heißt, dass – so wie es die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzil bestimmt hat – ihre Identität eine sakramentale ist: Abgehoben wird damit zum einen auf ihre für sie konstitutive Verwurzelung im Geheimnis, die es ihr verbietet, ihr Zentrum in sich selber zu suchen. Ebenso unzulässig ist zum anderen eine Spiritualisierung von Kirche, nimmt sie doch unweigerlich eine Sozial- und Organisationsgestalt an. Die entscheidende Frage ist, ob diese ihre gesellschaftlich erkennbare Verfassung auch ihrem sakramentalen Charakter entspricht. Um das am Fall der Auf- und Zuteilung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Kirche zu veranschaulichen: Ausdrücklich werden in dem programmatischen Schreiben der Bischöfe dafür folgende zwei Kriterien in Anschlag gebracht (vgl. 27, bes. 57 – 63). Erstens darf – negativ betrachtet – keine utilitaristische bzw. funktionelle Logik Platz greifen, die Personen allein über ihre Funktionen identifiziert und danach ihre Leistungen evaluiert. Zweitens soll – positiv akzentuiert – jede und jeder in ihrem bzw. seinem Charisma zur Auferbauung des Ganzen anerkannt, geachtet und gefördert werden. In weiten Teilen der französischen katholischen Kirche ist als Konsequenz dessen eine Synodalisierung kirchlicher Beratungs- und Entscheidungsprozesse sowie eine weit gehende Beteiligung von Laien an den kirchlichen Aufgaben mit Übertragung der dazugehörigen Verantwortlichkeiten vorgenommen worden.6