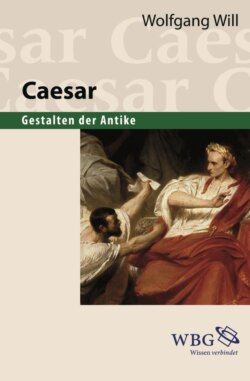Читать книгу Caesar - Wolfgang Will - Страница 12
Vom Stadtstaat zum Weltreich
ОглавлениеDas Epochenjahr in der Geschichte der römischen Republik ist das Jahr 264, in dem der Stadtstaat Rom die italienische Halbinsel verließ. Ohne Konzept und ohne Plan begann Rom, in den Kriegen gegen Karthago zuerst das westliche und dann auch das östliche Mittelmeer zu erobern. Militärisch war die Stadt dieser selbstgestellten Aufgabe gewachsen, nicht aber administrativ. Die Republik und ihre Feldherren siegten sich zu Tode. Mit einer überlegenen Militärtechnologie, mit Vertragsbruch und mit einer selbst für die damalige Zeit ungewöhnlichen Grausamkeit eroberten und versklavten die Römer Land für Land. Was sie in den unterworfenen Gebieten vorfanden, betrachteten sie als ihr Eigentum, Menschen wie Dinge. Sie folgten einem Machtgesetz, von dem schon 150 Jahre zuvor der Historiker Thukydides in seiner Analyse des athenischen Imperialismus gesprochen hatte, gültig für Individuen wie Völker: Nach dem Zwang seiner Natur herrsche der Mensch allezeit über das, was er unter seine Macht bringen könne.2 Gleichzeitig erschien den neuen nobiles der Krieg als das Medium, über das sie ihre Leistung für den Staat am besten definieren und mit derjenigen der konkurrierenden Aristokraten vergleichen konnten.
Der Anlass für das Ausgreifen Roms nach Sizilien, ein Hilfsgesuch von Söldnern, die sich im sizilischen Messana festgesetzt hatten, war so nichtig wie die Folgen gravierend. Römer und Karthager, die bisher in nicht weniger als drei Verträgen ihre Einflusssphären abgegrenzt hatten, stießen nun direkt aufeinander. Vielleicht wollten die Römer nur billige Beute machen, vielleicht versuchten sie eine eingebildete karthagische Einkreisung aufzusprengen, vielleicht waren sie sich über die Konsequenzen der Einmischung im Unklaren. Jedenfalls entspann sich ein fast vierundzwanzigjähriger Krieg, an dessen Ende zunächst Sizilien und vier Jahre später auch Sardinien und Korsika in römische Hände fielen. Rom unterwarf sich sein Reich gleichsam auf den Spuren der Karthager. Zur Abwehr des in Italien unbesiegbaren Hannibal landeten die Römer in Spanien, dessen Ostküste die Karthager als Kompensation für die im ersten Krieg verlorenen Gebiete sich untertan gemacht hatten, und schließlich auch in Afrika selbst. Kaum war der zweite Krieg mit dem Frieden von Zama zu Ende gegangen, richtete Rom um 197 das Land südlich der Pyrenäen bis Neukarthago als Provinz Hispania Ulterior und das südliche Spanien als Hispania Citerior ein. In sechzigjährigen Kämpfen, die 133 mit der Eroberung Numantias ihren Abschluss fanden, schlugen römische Legionäre alle Aufstände nieder und besetzten weiteres Land. Die Kelten in Oberitalien, die es gewagt hatten, Hannibal zu unterstützen, wurden teilweise ausgerottet, teilweise deportiert, römische Kolonisten siedelten in den fruchtbaren Landstrichen. Hannibals Allianz mit Philipp V. von Makedonien wies, wenn auch mit Verzögerung, den Weg nach Osten. In mehreren Kriegen gegen die makedonischen Herrscher und den Seleukidenkönig Antiochos schob Rom sein Herrschaftsgebiet bis Kleinasien vor. Makedonien wurde zuerst in vier Zonen zerschnitten und später zusammen mit Illyrien und Epirus als Provinz organisiert. Die Griechen, die an die Freiheitsproklamationen Roms geglaubt hatten, wurden bald eines Besseren belehrt. Die Römer duldeten nicht zweierlei Untertanen, und was sie von der griechischen Kultur hielten, demonstrierten sie spätestens 146, als sie das reiche Korinth zerstörten und die Kunstwerke, die sie nicht schon vandalierend zertrümmert hatten, raubten und in ihren Vorgärten aufstellten.
Im selben Jahr ebneten sie auch das inzwischen militärisch bedeutungslose, aber wirtschaftlich mächtige Karthago ein und verschleppten die Überlebenden. Das ehemals karthagische Gebiet verwandelte sich in die Provinz Africa. Den Legionären folgten stets die Verwaltungsbeamten und Steuereinnehmer. Die Einrichtung von Provinzen dokumentiert einen beispiellosen Siegeszug: 242 Sizilien, 227 Sardinien und Korsika, 197 Hispania Ulterior und Citerior, 148 Makedonien, 146 Achaia und Africa, 129 Asia, 121 Gallia Narbonensis, 102 Kilikien, etwa 81 Gallia Cisalpina, 74 Kyrene, 64 Kreta, 63 Pontos und Syrien, 58 Zypern, 46 Numidien, 30 Ägypten, 25 Galatien, 16 Aquitanien, Gallia Lugdunensis und Belgien, 15 Noricum und Rätien. Soldaten, die für Sold, Beute und Altersversorgung in den Krieg zogen, fanden sich seit der Heeresreform des Marius leicht. Feldherren wurden nur temporär gebraucht, auch wenn sich ihre Kommanden immer weiter verlängerten. Ihnen winkte ein Triumphzug, für den sie, wie Crassus, ausnahmsweise auch den eigenen Kopf riskierten. Das Problem blieb die Verwaltung der Provinzen, namentlich derjenigen, die weit von Rom entfernt lagen. Cicero, einer der wenigen, die um eine redliche Amtszeit bemüht waren, wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, als Statthalter nach Kilikien zu gehen. Es half nichts, der Personalmangel war systembedingt.
Ein Weltreich zu erobern war leichter, als es zu beherrschen. Roms aristokratische Elite zeigte sich schon rein numerisch dieser Aufgabe nicht gewachsen. Bereits 287 hatte sich der enge Kreis derer geschlossen, die die Macht in Rom unter sich aufteilten. Seit dem Ende der Ständekämpfe gab es keine Erweiterung der Regierungselite mehr. Sie wurde von den alten patrizischen Familien und seit der Mitte des vierten Jahrhunderts auch von den aufgestiegenen plebejischen Familien gestellt, die einen Konsul in ihrer Familie besaßen und damit nobiles waren. Nicht viel mehr als zwei Dutzend Familien mit ihren Verzweigungen dominierten die Republik, in dem Jahrhundert nach Hannibals Alpenübergang 218 kamen nicht weniger als 83 Konsuln aus nur acht Familien. 300 Senatoren, seit Sulla 600 und unter Caesar kurzfristig 900, berieten die Magistrate und gaben ihnen mit dem Senatsbeschluss Empfehlungen. Rechtlich mussten sich diese nicht daran halten, politisch blieb ihnen aber keine andere Möglichkeit. Das Gros der Senatoren, zumindest bis 45 v. Chr. allesamt Großgrundbesitzer, besaß Einfluss in diesem Gremium jedoch nur dem Scheine nach. Die wenigsten brachten es auch nur bis zur Prätur, dem zweithöchsten Amt; die meisten waren pedarii, Hinterbänkler, die im Senat nicht viel mehr taten, als sich bei Abstimmungen des Senats (per pedes) zu dem Konsular zu gesellen, dessen Meinung sie teilten – freiwillig oder erzwungen.
Tatsächlich hatten im Senat nur wenige eine eigene Meinung, und noch weniger äußerten sie. Dazu bedurfte es Ansehen und gelegentlich auch Mut. Die Reihenfolge, in der bei der Beratung über einen magistratischen Antrag abgestimmt wurde, war genau festgelegt. Als princeps senatus leitete sie meist ein Patrizier, der bereits die Zensur bekleidet hatte. Wenn die ehemaligen Konsuln, die Konsulare, sich geäußert hatten, war es mit der Meinungsbildung meist schon vorbei, bevor noch die ehemaligen Inhaber anderer Ämter sprechen konnten, die Prätorier, Ädilizier, Tribunizier und Quästorier. Letztlich war der Senat ein Instrument der – allerdings selten geschlossen auftretenden – Nobilität. Aus dem Ritterstand in diesen Zirkel vorzudringen, gelang nur äußerst wenigen: Cato der Ältere, Marius und schließlich Cicero sind die bekannten homines novi, Emporkömmlinge also, die als erste ihrer Familien Senatssitz und schließlich Konsulat erreichten.