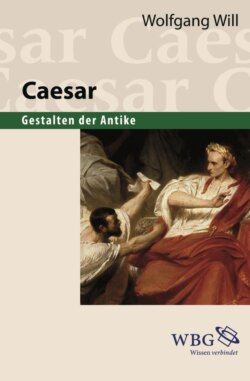Читать книгу Caesar - Wolfgang Will - Страница 13
Magistrate und Promagistrate
ОглавлениеDer kleinen Zahl der Kandidaten entsprach die der Ämter. Sie waren auf ein Stadtregiment ausgerichtet, nicht auf die Führung eines Weltreiches. Bis zu Sulla wählten die Komitien lediglich dreißig Magistrate pro Jahr: zwei Konsuln, sechs Prätoren, vier Ädilen, acht Quästoren, zehn Volkstribunen. Davon war die Mehrzahl an Aufgaben in der Stadt Rom gebunden, in die Provinzen wurden, je nachdem, ob dort Krieg oder Frieden herrschte, allenfalls zwölf entsandt. Die Aristokratie behalf sich zunächst mit Promagistraten, später machte Sulla die Regel daraus: Anstelle eines ordentlichen Magistrats (pro magistratu) gingen am Ende ihrer Tätigkeit in Rom die gewählten Konsuln als „Behelfsbeamte“ in die Provinz. Wo weiterhin Personalmangel herrschte, wurde die übliche einjährige Amtszeit verlängert. Dies genügte, um das Reich militärisch zu beherrschen, Aufstände zu unterdrücken oder niederzuwerfen. Darüber hinaus geschah selten mehr. Oft kümmerten sich die Statthalter nur in den Wintermonaten um ihre Provinz, da sie im Sommer Krieg führten, um neue Gebiete zu erobern oder sich zumindest mit der Kopfprämie für 5000 erlegte Feinde die Voraussetzung für einen Triumphzug zu schaffen.3 Andere betraten ihre Provinz erst gar nicht und überließen alle entsprechenden Aufgaben ihren Legaten. Auf keinen Fall aber sollte sich in den Provinzen eine Verwaltungsbürokratie etablieren, die mit ihrem angesammelten Herrschaftswissen den nur kurzzeitig tätigen aristokratischen Promagistraten überlegen sein würde.
Der politische Inzest der Nobilität ging – nach eigenem Verständnis – mit einem Verfall tradierter Werte einher. Sallusts Werk ist eine einzige Klage gegen die nobiles, die ihn, den Ritter, nicht in ihren Reihen sehen wollten, und stattdessen das Konsulat gleichsam „von Hand zu Hand“ weitergaben. „Denselben Männern, die Mühen, Gefahren, unsichere und bedrängte Lagen leicht gemeistert hatten, wurden nun politische Ruhe und Reichtum, sonst erstrebenswerte Dinge, zu einer leidigen Last. So wuchs zuerst die Geldgier, dann die Herrschgier; beide bildeten gleichsam den Grundstoff aller Übel. Denn die Habsucht unterhöhlte Vertrauen, Redlichkeit und die übrigen guten Eigenschaften; dafür lehrte sie Überheblichkeit und Rohheit, die Götter zu missachten und alles für käuflich zu halten.“4
Wie eine asiatische Grippe schleppten die von ihren Beutezügen zurückkehrenden Truppen die luxuria peregrina, das fremdländische Wohlleben, in das sittsame Rom.5 Zuerst steckten sich naturgemäß diejenigen an, die am meisten mit dem Luxusvirus in Kontakt kamen, Senatoren und Ritter. Der Historiker Livius zählt die Symptome einer schleichenden Krankheit auf: Speisesofas mit Bronzefüßen, kostbare Teppiche, Vorhänge und Gewebe, prächtiges Hausgerät, Prunktische und ähnliches. Die Mahlzeiten wurden üppiger, Harfen- und Zitherspielerinnen traten während des Essens auf. Von einer Dienstleistung sei Kochen zu einer Kunst geworden, klagt Livius; Krankheitskeime aus Asien hätten damals die gesunde Republik infiziert.
Die Republik diagnostizierte dies auch bald, suchte nach Heilmitteln und fand sie in Verbrauchs-, Aufwands- und Steuergesetzen, die Luxus, wenn nicht verbieten, so doch verteuern und zumindest in der Öffentlichkeit einschränken sollten. In ihrer ergebnislosen Abfolge dokumentieren diese Gesetze besser als moralinsaure Klagen die schleichende Zunahme einer Krankheit, die nur die, welche sie nicht hatten, als Leiden empfanden. Purpurgewänder, Goldgeschirr oder Perlenkolliers waren aber nur der schöne Schein, der dem Provinzhistoriker aus Padua ins Auge stach. Die großen Vermögen definierten sich über Ländereien. Cicero, von dem wir dank seiner Briefe etwas mehr wissen, besaß neben seinem Stadthaus Landgüter in Arpinum, Tusculum, Formiae, Caieta, Pompeii, Antium, Cumae, Astura, Puteoli, Lanuvium und Frusino, dazu „zeitweilige Wohnsitze“ im Albanergebiet, Anagnia, Sinuessa und Vescia. Dabei war der Redner, vergleichsweise gesehen, ein eher armer Mann; Fischteiche, in denen Meerbarben schwammen, konnte er sich nicht leisten. So war er sich der Kluft bewusst. Halb spöttisch, halb ängstlich nennt er die Reichsten der Reichen, den inneren Zirkel der nobiles, die beati homines oder nostri principes, schlicht piscinarii.6 Auf ihren nach und nach zusammengekauften Latifundien betrieben sie mit den billigen Arbeitskräften, die im Zuge der Massenversklavungen des zweiten Jahrhunderts nach Italien gekommen waren, Öl-, Wein- und Getreideanbau. Bauern mit kleinen und mittleren Gehöften konnten damit nicht konkurrieren. Ihre Felder waren im Hannibalzug verwüstet worden, sie selbst stellten das Fußheer in einer Zeit fast ununterbrochener Kriege. So wanderte der verarmte Teil der plebs rustica in die Städte ab, in erster Linie nach Rom, um dort Gelegenheitsarbeit zu suchen. Das römische Heer aber benötigte Bürger, die ihre Ausrüstung selbst stellen konnten. Die Kriege erforderten eine Stärkung des Bauernstandes und bewirkten seine Schwächung. Der Versuch, neues Siedlungsland in Italien bereit zu stellen, scheiterte. Der ager publicus, das Staatsland, das sich Rom im Zuge seiner italischen Expansion bis zum Ende des dritten Jahrhunderts mit der Annektion feindlicher Gebiete zusammengeraubt hatte, war verpachtet oder von aristokratischen Großgrundbesitzern okkupiert worden. Tiberius Gracchus forcierte – in seinem oder in anderer Namen – eine fällige Agrarreform, indem er auf der Basis eines älteren Gesetzes den Besitz an Staatsland für private Nutzung begrenzen wollte. Die senatorische Oberschicht, deren Interesse das Projekt diente, verhinderte es. Zur Lösung der Rekrutierungskrise bedurfte es eines anderen Weges: Durch die allmähliche Herabsetzung des Zensus erweiterte sich der Kreis der Wehrpflichtigen, bis Marius 107 sogar besitzlose Bürger heranzog. Das Agrarproblem kehrte so auf anderem Weg zurück. Die besitzlosen Soldaten, die sich in immer stärkerem Maße ihrem Feldherrn und nicht mehr der res publica verpflichtet fühlten, verlangten von diesem nach Ende der Dienstzeit Versorgung, und damit eben Land. Wer dieses nicht bekam oder mit ihm nicht zufrieden war, ging nach Rom. Dort sammelten sich Migranten aus dem gesamten Mittelmeerraum. Neben den abgewanderten Bauern vergrößerten Sklaven, die von ihren Herren freigelassen worden waren und römische Bürger wurden, die plebs urbana und die sozialen Probleme der Großstadt. Zwischen 700.000 und einer Million Einwohner zählte Rom zu Zeiten Caesars, darunter vielleicht 100.000 bis 200.000 Sklaven. Die Zahlen sind vage und Hochrechnungen schwer anzustellen. Mit der plebs urbana gab es jedenfalls im ersten Jahrhundert eine Kraft, die eine weitere Spaltung der Oberschicht nach sich zog, in optimates und populares. Hinter diesen Gruppierungen verbargen sich weder Parteien noch einheitliche politische Programme, sondern Senatoren, die mit unterschiedlichen Methoden nach Macht und Ansehen strebten: Die optimates wahrten die konservative Tradition und bedienten sich des Senats, den stärken zu wollen sie vorgaben. Die populares stützten sich auf die Volksversammlungen, die concilia plebis und die Tributkomitien, welche beschlossen, was die Magistrate beantragten: Wenn ein Gesetzesvorschlag bis zur Volksversammlung kam, wurde er auch immer angenommen. Mit „Nein“ votierte sie niemals. Je größer die Klientel war, deren Interessen der Patron vertrat, desto zuverlässiger war das gewünschte Ergebnis der Abstimmung. So sanktionierten die Komitien in Rom, die doch nur einen Bruchteil der Bevölkerung des Reiches repräsentierten, die Vorhaben der Popularen, die diese dann als „Volkswille“ ausgaben. Dafür mussten die populares kurzfristige Versprechungen auf dem Gebiet der Miet- und Schulden-, der Agrar- und Getreidegesetzgebung machen und gelegentlich sogar halten. Es waren in der Regel – aber, wie das Beispiel Caesar zeigt, keineswegs immer – Volkstribunen, die sich dieser Themen annahmen. Dabei verdienten sie ihren Namen selten: Sie hatten längst aufgehört, die Interessen des Volkes gegen Senat und Magistrate zu vertreten. Sie kümmerten sich um die Belange ihres Standes – sie alle kamen aus der Oberschicht – und um ihre eigenen. Sie nutzten die Möglichkeit, den Senat gegen die Volksversammlung auszuspielen und in dieser eventuell Anträge durchzusetzen, die im Senat zu scheitern drohten. Ein soziales Mäntelchen erleichterte die Sache. Bei Caesar folgte einem Ackergesetz dasjenige über seine Provinzen.
Karte 1: Das Römische Reich zur Zeit Caesars