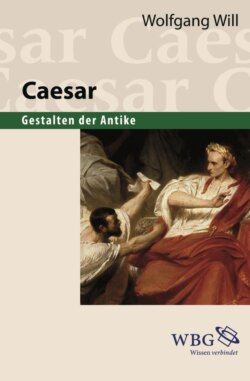Читать книгу Caesar - Wolfgang Will - Страница 14
Politik und Wirtschaft
ОглавлениеIm wirtschaftlichen Bereich sorgten die Statthalter nur dafür, dass Steuern und Abgaben ohne größere Zwistigkeiten eingetrieben werden konnten, ansonsten legten sie zu Beginn ihrer Amtszeit als eine Art Regierungsprogramm ein Edikt vor, das die Höhe des Zinses festschrieb, ohne dass sie sich – mit der Ausnahme Ciceros – dann auch daran halten zu müssen glaubten.
Die Wirtschaft lag sozusagen in privaten Händen, sie wurde von Leuten betrieben und gelenkt, die selbst nicht Teil des politischen Apparates waren, den sogenannten publicani, Angehörigen des Ritterstandes. Den Senatoren waren reine Geldgeschäfte verboten, sie stellten die politische Klasse. Diese Trennung wurzelte in einem Gesetz, das aus dem Jahr 218 stammte, also aus einer Zeit, in der die Konsequenzen und die Sprengkraft nicht voraussehbar waren, die sich aus der Expansion Roms ergeben sollten. Zu Beginn des Hannibalischen Krieges hatte der Volkstribun Quintus Claudius ein Gesetz beantragt, die lex Claudia de nave senatorum, das auf den ersten Blick keine allzu große Bedeutung zu haben schien. Niemand, der selbst oder dessen Vater Senator sei, dürfe ein Seeschiff ausrüsten, das eine Ladekapazität von 300 Amphoren überschreite.7 Die Eroberungen des ersten Punischen Krieges versprachen lukrative Geld- und Handelsgeschäfte, ein Dissens innerhalb des Senatorenstandes drohte. Mit dem Gesetz, das durchaus im Sinne der Senatoren war, wurden alle Mitglieder des Standes auf die Bewirtschaftung ihrer Landgüter beschränkt. Grundeigentum blieb die Basis von Macht und Ansehen. Geldgeschäfte und Fernhandel gingen zunehmend an die Ritter über, aus denen sich die Gruppe der publicani herausschälte, also Unternehmer, die mit Staatsdingen (publicum) zu tun hatten, namentlich mit Staatsaufträgen, -steuern und -pachten. Das erregte weder Aufsehen noch den Neid der Senatoren, denn auch die Ritter gehörten zur Aristokratie und zu den staatstragenden Grund- und Bodenbesitzern. Der Senatorenstand ergänzte sich aus dem Ritterstand, zwischen beiden Ständen waren die Grenzen offen, wenn auch nicht zu sehr. Noch Cicero träumte von der concordia ordinum, der Harmonie der beiden Stände. Doch mit dieser war es spätestens mit dem Jahr 129 vorbei. Ein Gesetz zwang jeden Aufsteiger in den Senat, sein vom Staat erhaltenes Pferd zurückzugeben. Diejenigen, die als Ritter zurückblieben, besaßen nun ein sichtbares Statussymbol. Später erhielten sie noch einen goldenen Ring, kleideten sich in eine Toga mit schmalem Purpurstreifen und belegten besondere Sitze im Theater. Die Äußerlichkeiten, um ein Standesbewusstsein zu entwickeln, waren gegeben. Jetzt bedurfte es noch besonderer Rechte. Die gab ihnen 123 zunächst ein Gesetz des Gaius Gracchus und wenig später eines des Volkstribunen Acilius Glabrio. Das erste befahl die Aufnahme von 300 Rittern in die Richterliste, auf der bisher nur senatorische Namen standen, das zweite, wichtigere, übergab ihnen den gerade geschaffenen ständigen Gerichtshof für Repetundenangelegenheiten. Nun saßen 50 nicht-senatorische Geschworene unter dem Vorsitz eines Prätors über Senatoren zu Gericht, die sich wegen rechtswidriger Aneignung von Vermögen, hauptsächlich mittels Erpressung in den Provinzen, zu verantworten hatten (res repetundae = wiederzuerstattende Gelder). Nach einem Zitat des römischen Gelehrten Varro hätte Gracchus einen doppelköpfigen Staat geschaffen, und Cicero behauptet, von Gracchus selbst stamme die Äußerung, er habe Dolche auf das Forum geworfen, damit sich die Bürger mit ihnen gegenseitig zerfleischten. Der Historiker Poseidonios analysierte die Folgen: Gracchus habe dem schlechteren Teil der Bürgerschaft die Vorherrschaft über den vornehmeren gegeben, die frühere Eintracht aufgehoben und das gewöhnliche Volk gegen beide Stände aufsässig gemacht. Cicero bestätigte, die res publica sei umgestürzt worden.8 Tatsächlich waren es aber in erster Linie die Senatoren, die zu den Dolchen griffen, deren Spitzen Gracchus angeblich gegen sie geschärft hatte. In den Verfolgungen unter Sulla verloren 1600 Ritter Besitz und Leben, ein Teil der Überlebenden wurde in den Senat integriert, der Rest war zu schwach, um erneut zum Problem zu werden. 123/22 war ihre Position jedoch zunächst gestärkt. Beispiele von Klassenjustiz sind in den nächsten Jahren nachweisbar. Es sind jedoch wenige, und sie wurden von den Historikern überschätzt. Dass Ritter über diejenigen zu Gericht sitzen konnten, die sie als Statthalter in der Provinz kontrollieren sollten, implizierte dennoch die Gefahr der Erpressung. Es war jedoch nicht die Angst, die die Promagistrate veranlasste, mit den publicani zu paktieren, sondern die Raffgier. Gracchus’ Idee, Politik und Wirtschaft zu trennen, besaß nur einen Fehler: Sie war nicht durchführbar. Schlimmer als der Zwist der Stände war ihre zeitweilige Zusammenarbeit. Wenn die römischen Historiker dies nicht so sahen, verwundert das nicht, denn es betraf die Bewohner der Provinzen. Welcher Hass sich dort gegen die römischen Besatzer und ihre Helfer aufstaute, zeigt das Blutbad in der Provinz Asia, als im Jahre 88 in einer einzigen, heimlich vorbereiteten Aktion 80.000 Italiker und Römer erschlagen, gesteinigt oder ertränkt worden sein sollen.9 Diejenigen, die die Wut vor allem auf sich zogen, waren die publicani und ihre örtlichen Angestellten, die kleinen Steuereintreiber, welche das Neue Testament als Zöllner kennt.
Das Übel hatte eine doppelte Wurzel, die Privatisierung des gesamten wirtschaftlichen Sektors und die mangelnde staatliche Kontrolle. „Wo ein publicanus ist, dort ist entweder das Recht des Staates ein leerer Begriff oder die Bundesgenossen besitzen keine Freiheit“, wurden schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts senatorische Klagen laut.10
Bereits die Griechen waren auf den Gedanken verfallen, staatlichen Besitz und staatliche Einkünfte zu verpachten. In der attischen Demokratie wurde allerdings jede Drachme, die eingenommen oder ausgegeben wurde, genau registriert, das Volk fühlte sich als Eigentümer. In Rom herrschte eine Oligarchie, die den Kreis der Elite aufs äußerste beschränkt wissen wollte und damit die Zahl der Jahresbeamten klein halten musste. In der Wirtschaft beschränkte sich der Staat auf Beamte, die Aufträge an Privatpersonen oder Gesellschaften vergaben, und solche, die die korrekte Ausführung überwachten. Dazwischen agierten die publicani. Sie ersteigerten Aufträge für die Versorgung und Ausrüstung der Legionäre, verschifften Waffen, Kleidung, Reittiere oder Verpflegung an alle Einsatzorte im Mittelmeer. Daneben errichteten sie Aquädukte, bauten Brücken, Straßen und Kloaken, renovierten Tempel und Heiligtümer, fütterten die Gänse auf dem Kapitol – und das alles in staatlichem Auftrag. Die Zensoren verpachteten den publicani Staatsland, kommunale Einrichtungen, Salz- und Eisenbergwerke oder Fischereirechte. Begehrt waren bei den Versteigerungen vor allem die Steuereinnahmen (tributa) aus der Provinz, ob Naturallieferungen (vectigalia) oder Zölle jeder Art (portoria). Der Zensor erteilte den Zuschlag gegen Höchstgebot. In der Regel belief sich der Pachtzeitraum auf fünf Jahre, in denen die publicani Zeit hatten, die gebotene Summe, die Kosten für ihren zum Teil aufwendigen Apparat an Zolleinnehmern und Helfern und darüber hinaus einen ansehnlichen Gewinn für ihre eigene Kasse zu erwirtschaften.11 Die Staatskasse erhielt einen Vorschuss, Bürgen garantierten die Restsumme. Damit konnte das Ärarium seine Ausgaben auf Jahre kalkulieren, ohne dass es eines größeren Stabes eigener Beamter bedurfte. Die publicani profitierten, indem sie mit der Bildung von Gesellschaften die Konkurrenzsituation unterliefen, die durch den Wettbewerb der Bieter Höchstpreise für den Staat garantieren sollte. Diese Sozietäten waren eine zwangsläufige Entwicklung, da die publicani einen teuren Personalapparat unterhalten mussten. Dazu konnten einzelne Unternehmer die Summen gar nicht aufbringen, die für Großaufträge wie die Pacht einer ganzen Provinz, deren Zölle, Steuern und Abgaben im Paket versteigert wurden, zu entrichten waren. So schlossen sie sich zusammen und ermöglichten anderen römischen Bürgern, an den Gewinnen und in seltenen Fällen an den Verlusten zu partizipieren. Mittels Anteilscheinen, einer Form der Aktie, konnten sie sich auch als Kleinkapitalisten oder aber im großen Stil an der Ausbeutung der Provinzen beteiligen.12 Aktienspekulation und -betrug durch Aushöhlung der politischen Kontrolle durch den Senat war die Folge. Caesar war an einem der größten Skandale federführend beteiligt.13
Das Versagen jeglicher Kontrollen, das zur Bereicherung jeder gegen jeden führte, der verzweifelte Run auf die letzten Reichtümer, welche die schon über 100 Jahre lang ausgepressten Provinzen des Ostens noch boten, verstärkte die Krise der Republik im ersten Jahrhundert. Sulla, Lucullus, Pompeius und Crassus hatten in einem letzten Anlauf zusammengerafft, was sich in Griechenland und Asien noch plündern ließ: Kriegstributionen in Milliardenhöhe, Gold- und Silberbarren, Edelsteine und Perlen, Kunstwerke und Bibliotheken. Steuern wurden erhöht, Zolleinkünfte vermehrt, Sklaven zu Bargeld gemacht. Wer konnte, beteiligte sich auch privat.14 Private Geschäftsleute reisten durch die Provinzen und boten den Gemeinden zu Wucherzinsen zwischen 12 und 48 Prozent das Geld, das diese den römischen Kriegsherren oder Zolleinnehmern zahlen mussten. Rom verdiente doppelt und halbierte die Zeit, bis die Ressourcen erschöpft waren. Der Schock kam Ende der sechziger Jahre, als die publicani einräumen mussten, für die asiatische Pacht wesentlich mehr geboten zu haben, als sie aus der Provinz noch herausholen konnten. Die Catilina-Affäre hatte kurz vorher schon die Verschuldung vieler Aristokraten enthüllt, Caesar selbst wurde wenig später von seinen Gläubigern so bedrängt, dass er die Abfahrt in seine prätorische Provinz verschieben musste. Ihm gelang es, sich dort zu sanieren, doch das war die Ausnahme.
Die Zeichen standen auf Neuverteilung von Macht und Umverteilung von Vermögen, wie sie schon unter Sulla stattgefunden hatte, und das hieß Proskriptionen und Bürgerkrieg. Je offenkundiger die Krise wurde, desto stärker wurden die Bemühungen, sie zu bemänteln. Senatoren und Magistrate beriefen sich auf das Herkommen, den Brauch der Väter, mos maiorum, beschworen die Geister der Ahnen, deren Taten eine gefällige Geschichtsschreibung zu Heldenepen verklärt hatte. Einer geklitterten Vergangenheit wurden Namen, Parolen und Kostüme entlehnt. Das Ende der Republik wurde so zur Farce. Caesar trat in seinen letzten Wochen in der entliehenen Purpurtracht der altrömischen Könige auf. Die Verschwörer beriefen sich auf eine Stadtchronik, in welcher Romulus vom Senat getötet wurde, weil er sich zum Tyrannen gemacht hatte. Der Attentäter Marcus Brutus verstand sich mit einer eigens konstruierten Ahnentafel als Nachfahre jenes Brutus,15 der nach Willen und Vorstellung der republikanischen Aristokratie die Herrschaft der Könige gestürzt und ihre eigene begründet hatte. So stand am Beginn der Republik eine Fälschung und an ihrem Ende ein Missverständnis.