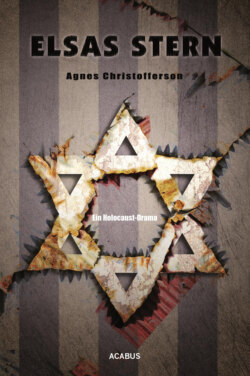Читать книгу Elsas Stern. Ein Holocaust-Drama - Agnes Christofferson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
New York, Frühjahr 1979 Samstag
Dem Mann, der unser Leben gänzlich erschüttern sollte, begegneten wir in einem Restaurant. Es geschah an einem jener Tage, an denen das Leben ruhig und in geregelten Bahnen verlief; ein gewöhnlicher Samstag mit einem gewöhnlichen Tagesablauf und den üblichen Pflichten. Ich war fünfundzwanzig Jahre alt, Single und verbrachte meinen freien Tag damit, meine Kleidung von der Reinigung abzuholen, mein Auto zu waschen und mit meiner älteren Schwester Salome zu telefonieren.
Am Abend führte ich meine Mum zum Essen aus. Das war zu unserem kleinen Ritual geworden.
Seitdem mein Vater vor zwei Jahren infolge eines Herzinfarktes verstorben war, ging meine Mum so gut wie nie aus. Ich wünschte mir so sehr, dass sie für eine Weile der Trauer entfliehen konnte, und lud sie hin und wieder zum Essen ein.
Ich kannte ihre Vorliebe für Salate, Meeresfrüchte und vollmundige Rotweine, daher hatte ich das Restaurant persönlich für sie ausgewählt.
Das Elektrics war ein modernes, italienisches Lokal mit einem gemütlichen Ambiente. Wir saßen an einem winzigen Zweiertisch und versuchten, eine angenehme Zeit miteinander zu verbringen. Das war nicht leicht, denn meine Mum war oft etwas forsch, was eine angenehme Unterhaltung mit ihr verkomplizierte.
Ich wurde in eine eigenartige Familie hineingeboren. Meine Mum war Jahrgang 1925 und wuchs im antisemitischen Deutschland auf. 1944 floh sie mit meiner neugeborenen Schwester Salome nach Amerika. Dabei verlor sie ihre Familie komplett aus den Augen. Ihr Schicksal blieb offen und ungeklärt. Die Vergangenheit meiner Mutter war für mich im Grunde ein einziges Geheimnis. Fakt war: alle hatten Oma, Opa, Onkel, Tanten. Nur wir hatten niemanden – jedenfalls fast niemanden.
Als ich noch ganz klein war, hatte ich angenommen, die Familienverhältnisse wären ganz normal. Als ich älter wurde, begann ich zu begreifen, dass unsere Familie etwas anders war. Wir waren eine Familie mit wenig Verwandtschaft, aber dafür mit vielen Familiengeheimnissen.
Meine Mum, Elsa Aronsohn, beobachtete, wie die Barkeeperin zwei große Biergläser vollzapfte und sie routiniert über die Theke schob. Dabei beugte sich die junge Frau so vor, dass die beiden Männer an der Bar einen Blick in den Ausschnitt ihrer Bluse erhaschen konnten.
„Das ist doch scheußlich. Die glaubt wohl, wenn man ein bisschen Fleisch zeigt, kriegt man mehr Trinkgeld“, entrüstete sich meine Mum provokativ laut.
Ich spürte, wie die Röte von meinen Wangen sich bis hin zu meiner Stirn und über meinen Nacken zog, und war froh, dass der Raum nur schwach beleuchtet war.
Das war typisch meine Mutter. Sie war seit jeher Hausfrau, Mutter und die Ehefrau eines erfolgreichen Anwalts gewesen. Ein wenig weltfremd in meinen Augen. Sie lebte in ihrem eigenen kleinen Kokon, aus dem sie voller Misstrauen und übertriebener Wachsamkeit auf die Welt schauen konnte. Mum und Dad hatten 1947 geheiratet, zu einer Zeit, da Frauen keine anderen Interessen hatten, als den besten Braten herzurichten und die beste Methode zu finden, Flecken aus Polstern und Kleidung zu entfernen.
Falls meine Mutter mein nervöses Lächeln bemerkt hatte, zeigte sie es nicht. Stattdessen griff sie nach ihrem Weinglas. In ihrem eleganten Kostüm und mit ihrer kupferroten, perfekt sitzenden Elizabeth-Taylor–Frisur wirkte sie ein wenig fehl am Platz in dem neuen In-Restaurant. Es wurde vorwiegend von jüngeren Leuten besucht. Von Leuten, die nicht so viel Wert auf Etikette legten wie meine Mum. Selbst in der Art, wie sie das Weinglas hielt, erkannte ich noch etwas von der Eleganz, zu der ihre Eltern sie erzogen hatten.
„Lass gut sein, Mum. Du kannst die Welt eh nicht verbessern“, sagte ich. „Achte gar nicht auf sie. Lass uns einfach den Abend genießen.“
Mum wandte den Blick ab und ließ ihn über die dunklen Bodendielen gleiten. „Ach Liebes, du hast ja so recht“, sagte sie, stieß ein gepresstes Lachen hervor und griff nach der Speisekarte. Aus ihrer Handtasche klaubte sie ihre Lesebrille und setzte sie auf. Während sie die Speisekarte las, überlegte ich, wie ich ihr beibringen sollte, dass Laura, meine bisherige Mitbewohnerin, ausgezogen war und ich nun die große, übertrieben teure Wohnung gegen ein winziges, schäbiges Einzimmerapartment tauschen musste.
Ich promovierte in amerikanischer Literatur und arbeitete als Bibliothekarin, doch die Bezahlung war nicht die beste. Seit Lauras Umzug waren schon zwei Wochen vergangen, und irgendwann würde ich meiner Mum reinen Wein einschenken müssen. Spätestens dann, wenn der Umzug anstand. Sie hatte meine Flucht aus dem Elternhaus von Anfang an mit Skepsis betrachtet. Ich hatte ja ein gut ausgestattetes Kinderzimmer im Dachgeschoss meines Elternhauses auf Long Island. Meine Mutter würde sich jetzt noch mehr Sorgen machen, wenn sie hörte, dass ich nun allein in der Wohnung lebte. Ich glaubte, ihr wäre wohler, wenn ich mehr von meiner Halbschwester hätte.
Salome war zehn Jahre älter als ich und lebte bis zu ihrer Heirat in unserem Elternhaus. Sie war fast dreiundzwanzig, als sie heiratete. Ihren Mann Anton hatte sie an der Uni kennengelernt. Anton war zwei Jahre älter und stammte aus einem guten Elternhaus. Er führte sie in vornehme Restaurants und fuhr mit ihr in den Urlaub. Kurz nach ihrem Abschluss war sie schwanger, dann verheiratet. Nun verheiratet verwandelte sich Salome bereits nach kurzer Zeit in einen völlig anderen Menschen. Scheinbar über Nacht mutierte sie zu unserer Mum: zu einer geradlinigen, gut organisierten Familienmanagerin. Anton war mittlerweile ein sehr erfolgreicher Schönheitschirurg und die beiden lebten in Saus und Braus.
„Was willst du bestellen?“, fragte ich.
Meine Mutter schaute nachdenklich drein. „Ich weiß noch nicht“, murmelte sie.
„Lass dir ruhig Zeit.“ Ich hatte es nicht eilig und wollte den Abend mit ihr in Ruhe genießen.
Ein älterer Herr drängte sich zwischen den Gästen an die Theke. Er war Mitte sechzig, sehr groß, ein wenig zu dünn, mit halblangem meliertem Haar. Da er mit dem Rücken zu mir stand, konnte ich seine Gesichtszüge nur schwer erkennen. Er trug einen teuer aussehenden Anzug und hatte eine junge Blondine an seiner Seite. Die junge Frau strich eine Haarsträhne hinter ihr linkes Ohr, sodass man einen teuren Diamantohrring und ihr hübsches Profil erkennen konnte. Ich überlegte, ob die Blondine seine Tochter oder seine Geliebte war. Beides wäre möglich gewesen.
Meine Mum legte die Speisekarte auf den Tisch. „Sieht so aus, als hätte ich mich entschieden“, verkündete sie, als wäre sie die große Gewinnerin des Abends.
„Was hast du ausgewählt?“, fragte ich neugierig.
„Ich nehme den großen Salat.“
„Nur einen Salat?“
„Findest du das nicht richtig?“ Sie sah mich stirnrunzelnd an.
„Wenn du schon so fragst, nein“, räumte ich ein. „Bestell dir etwas Richtiges zu essen.“
„Ab einem bestimmten Alter muss man auf seine Figur achten, Schätzchen.“ Sie beäugte mich ernst, doch sie schien es nicht ernst zu meinen. Meine Mutter war Mitte fünfzig, eine dynamische und attraktive Frau. Sie musste sich ganz sicher keine Probleme um ihre Figur machen. Ich lächelte und schwieg. Manchmal war Schweigen die bessere Antwort.
„Ich mochte deine Haare lang“, sagte sie plötzlich aus dem Kontext gegriffen. Sie spielte auf meine neue Frisur an.
Ich strich mir ein paar kastanienbraune Wellen hinters Ohr. Vor ein paar Tagen ließ ich meine hüftlangen, aalglatten Haare schulterlang schneiden und föhnte sie nun zu einer wundervollen Außenrolle. „Meine Haare sind doch nicht kurz!“, wandte ich ein. „Außerdem ist die Frisur momentan todschick. Mit der Zeit gehen ist immer gut.“
Mum verzog die Lippen zu einem kleinen, kühlen Lächeln. „Nun ja, irgendwann ist es wohl Zeit für eine Veränderung. Auch wenn die Veränderung einem nicht schmeichelt.“
Ich beschloss, diese Anspielung zu überhören. So war meine Mutter eben. Nicht böse. Sie konnte ihre Gefühle noch nie besonders gut ausdrücken. Ich war mir sicher, dass ihr die neue Frisur super gefiel. Sie wusste es nur noch nicht.
Im hinteren Bereich des Lokals saß eine Gruppe junger Leute, die sich scheinbar Witze erzählte. Jeweils nach einer kurzen Pause folgte eine laute Lachsalve. Die Art, wie sie lachten, war durchaus typisch für jemanden, der sich über etwas Lustiges amüsierte. Einer der jungen Leute gab der Kellnerin das Zeichen, eine neue Runde zu bringen.
„Zu meiner Zeit hatten wir noch Manieren“, murmelte meine Mutter, der die feuchtfröhliche Gruppe bereits aufgefallen war. Das war wieder ganz typisch meine Mum. Während die anderen lachten und sich unterhielten, zog sie sich in ihren Kokon zurück. Eine richtige Spaßbremse konnte sie sein.
„Willst du mir erzählen, dass die Jugend früher anders war?“, fragte ich mit hochgezogenen Augenbrauen. „Gab es damals keine Frauen mit tiefen Ausschnitten? Waren die Leute nicht lustig?“ Meine Güte, man konnte sich aber auch anstellen!
Mum lächelte. Ein verschmitztes, angedeutetes Grinsen umspielte ihre Mundwinkel. „Gab es schon“, sagte sie. „Die hatten aber bessere Manieren.“
Wieder erfüllte ein kräftiges Lachen den Raum. „Sie haben doch nur etwas Spaß“, meinte ich.
Meine Mutter setzte ihre Lesebrille wieder ab und steckte sie in die Handtasche. „Sie könnten sich aber auch etwas leiser amüsieren. Ich meine, wir sind schließlich nicht auf einer Studentenparty.“
„Auf einer Beerdigung sind wir aber auch nicht. Wir sind bald in den achtziger Jahren. Man muss mit der Zeit gehen.“
Mums spitzer Blick blieb an meinem Gesicht hängen. „Hast du dich auch schon entschieden, Liebes? Weißt du, was du essen möchtest? Ich habe schrecklichen Hunger. Tut mir leid, dass ich ein solcher Plagegeist bin, aber ich habe seit heute Mittag nichts gegessen. Du weißt doch, wie ich bin, wenn ich hungrig bin.“ Sie sagte es mit einem derart süßen Lächeln, dass ich nur mit Mühe entscheiden konnte, ob sie ernsthaft verärgert war oder nicht.
„Unausstehlich?“, fragte ich. Ich trank einen großen Schluck Wein und spürte, wie er in der Kehle brannte. Seitdem ich denken konnte, war unser Kühlschrank vollgepackt mit Essen. Ich kannte ihre Reaktion auf Hunger nur zu gut.
„Unausstehlich, misslaunig und brummig“, fügte meine Mum hinzu.
„Bösartig?“, hörte ich mich sagen, so zaghaft, dass ich meine eigene Stimme kaum erkannte.
„Moment mal!“, rief Mum und hob protestierend die Hände. „Jetzt übertreibst du aber! Ich kann Hunger einfach nicht leiden. Mein Blutzucker sinkt und …“
Ich schenkte ihr ein Lächeln. „Ich wollte dich bloß ärgern, denn du magst meine Frisur nicht.“
„So ist das auch nicht. Ich finde sie ganz in Ordnung. Ich mochte deine Haare lang einfach lieber. Was nimmst du nun?“
„Ich nehme die Pizza.“
„Pizza? Ist ja kein Wunder, dass du an meinem Salat etwas auszusetzen hast.“ Meine Mum drehte sich nach der Kellnerin um. „Hast du das gesehen? Die hat uns gesehen und ist sofort weitergelaufen.“
Ich rollte mit den Augen. Dieses extreme Misstrauen ging mir gehörig auf den Geist. Ich grinste ein wenig boshaft. „Ja genau“, murmelte ich. „Sie hat uns gesehen und ist sofort weitergelaufen. Das ist bestimmt eine Verschwörung.“
„Jetzt spinnst du aber!“, meinte meine Mum. Sie ließ den Blick durch den Raum gleiten, ohne irgendwo zu verharren, bis sie schließlich an dem älteren Mann mit der jungen Blondine hängen blieb. Er hatte sich umgedreht, um nach einem leeren Tisch Ausschau zu halten. Mir fielen sofort seine beinahe stechend blauen Augen auf, die sich kurz mit dem Blick meiner Mutter kreuzten. Er hatte ein aristokratisches, gut geschnittenes Gesicht. Für sein Alter sah er noch sehr gut aus. Er wirkte wie ein reicher Unternehmer und so malte ich mir aus, dass die Blondine an seiner Seite seine Frau war. Eine Tochter aus gutem Hause oder eine reiche Erbin mit Vaterkomplex. Solchen Paaren begegnete ich häufig.
Am Tisch wurde es auf einmal bedrückend still und ich merkte, dass Mum den Atem anhielt. Ihr war die Farbe aus dem Gesicht gewichen und ihre Hände zitterten.
„Mum?“, fragte ich erschrocken. Aber sie antwortete nicht. Statt einer Antwort hörte ich nur einen erstickten Laut. Ihr Gesicht war vollkommen versteinert, während sie den älteren Mann anstarrte, der sich inzwischen wieder der Blondine zugewandt hatte. „Mum?“ Wieder keine Antwort. Während der Raum sich mit neuen Gästen füllte, schaute ich mich Hilfe suchend nach einer Bedienung um. „Alles in Ordnung?“
Wie in Trance wies sie mit dem Kopf auf den Mann. Inzwischen hatte er einen leeren Tisch für seine Begleitung und sich entdeckt. Die Blondine hakte sich bei ihm ein, dann verließen sie die Theke.
„Mum, was hast du bloß?“ Der Gesichtsausdruck meiner Mum verriet, dass sie gedanklich weit abgeschweift war. Sie nahm mich überhaupt nicht mehr wahr. Ihr Geist schien in einer anderen Sphäre zu weilen. Sie hatte scheinbar Probleme zu verstehen, was genau ich eigentlich von ihr wollte. Sie klimperte ein paarmal mehr als üblich mit den Wimpern. Dann, nachdem sie mich wirr angeschaut hatte, verdrehte sie die Augen, sank in sich zusammen und rutschte vom Stuhl. Erst nach ein paar Sekunden begriff ich, dass sie zusammengebrochen war.