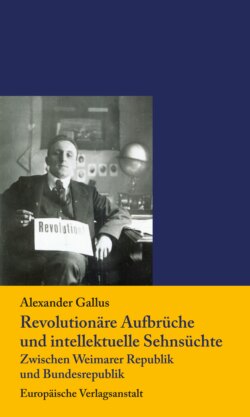Читать книгу Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte - Alexander Gallus - Страница 12
2. Zum historischen Ort der deutschen Revolution von 1918/19 Ein Wendepunkt in der Gewaltgeschichte? I. Einleitung: eine Revolution zwischen Debatte, Desinteresse – und neuer Deutung?
ОглавлениеJahrzehntelang war es in der öffentlichen Erinnerung still geworden rund um das Thema der Novemberrevolution, und auch die Forschung über die Umbrüche von 1918/19 schien ins Stocken geraten zu sein. Eine Erklärung für diese Aufmerksamkeitsflaute bot der Spiegel anlässlich des Hundertjahresjubiläums der Ereignisse im Herbst 2018: die Scheu der Deutschen vor Revolutionen ganz allgemein. Sie litten an einer regelrechten Revolutionsaversion. Das Hamburger Wochenmagazin setzte dieses Thema an prominente Stelle und widmete ihm die Titelgeschichte „Revolution. Warum die Deutschen so oft scheitern“.1 In gewisser Weise knüpfte es damit an eine Würdigung an, die Joachim C. Fest schon fünfzig Jahre zuvor an derselben Stelle in einem ebenfalls sehr grundsätzlichen Bericht über die revolutionären Misserfolge der Deutschen formuliert hatte: „Das deutsche Gedächtnis kennt weder geköpfte Könige noch erschlagene Gauleiter, keine Straßenschlachten, keinen Bastillesturm oder siegreich durchgestandenen Verfassungskonflikt. Eher geniert bewahrt es die Erinnerung an einige halbherzige Erhebungen und einen selbstquälerisch wankelmütigen Widerstand, alles in Jammer und Bitternis endend. Nicht einmal der Rückblick auf große Niederlagen ist ihm vergönnt, es kennt nur den Katzenjammer kläglichen Scheiterns.“2
Gerade im Epochenjahr 1968 präsentierte sich die Streitgeschichte rund um die seit jeher „umkämpfte Revolution“ von 1918/19 besonders vital.3 Das historische Szenario traf im Verlauf der dynamischen 1960er Jahre auf ein gewandeltes Meinungsklima, das Räteideen und der Suche nach Alternativen zwischen den großen gesellschaftlich-politischen Systemblöcken bis in die 1970er Jahre hinein eine vermehrte Aufmerksamkeit sichern sollte. Der „Republikanische Club Westberlin“, der führende Köpfe der Außerparlamentarischen Opposition versammelte, beschäftigte sich besonders intensiv mit der „revolutionären Situation 1918“ und erörterte die Möglichkeit, ein halbes Jahrhundert später daran anzuknüpfen. Es galt, so hieß es damals, die „Ausgangslage der Novemberrevolution“ genau zu studieren, um daraus Lehren für eine erneut in Aufruhr geratene Gegenwart zu ziehen und nicht „alle grundlegenden strategischen und konzeptionellen Fragen kurzfristigen Tagesstrategien unterzuordnen oder ganz zu opfern“.4 Dieses Bestreben fügte sich 1968 gut in die „Winterkampagne“ des Clubs ein: „50 Jahre Konterrevolution sind genug“.5 Ernst Fraenkel, der große Pluralismus-Theoretiker und nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil an der Freien Universität Berlin lehrende Politikwissenschaftler, war angesichts solcher Tendenzen beunruhigt und warnte vor einem neuen „Rätemythos“ – auch deswegen, weil er wieder in Mode geratenen Ideen eines Dritten Wegs zwischen Kapitalismus und Kommunismus und einer alternativen sozialistischen Demokratie nichts abgewinnen konnte, sie sogar für demokratiegefährdend hielt.6
Wie wir wissen – dies mochte auch Fraenkels Sorge um den Bestand des westlich-pluralistischen Demokratiemodells abmildern – blieb es bei Gedankenspielen. Sie fügten sich in die Debatte rund um die Novemberrevolution, wie sie bis in die 1980er Jahre hinein geführt wurde: als Geschichte im Optativ. Mehr Demokratisierung und weniger verpasste Chancen seien in einer Zeit möglich gewesen, als führende Politiker ihre Handlungsmöglichkeiten nur unzureichend genutzt hätten, so lautete eine der regelmäßig vorgetragenen Thesen.7 Zudem gelangte der Verratsvorwurf gegenüber der Mehrheitssozialdemokratie zu großer Prominenz, verfocht diese These publikumswirksam doch der wortgewandte, geschickt argumentierende historische Publizist Sebastian Haffner. Sein 1969 erstmals erschienenes Buch Die verratene Revolution, das sich zu einem Langzeitbestseller (später unter dem nicht mehr thesenhaften, einen nüchternen Tatsachenbericht suggerierenden Titel Die Deutsche Revolution 1918/19) entwickelte, war eine fulminante Abrechnung mit Friedrich Ebert und den führenden Mehrheitssozialdemokraten, die – statt sie zum Erfolg zu führen – die Revolution niedergeschlagen hätten.8
Der Streit über den historischen Ort der Novemberrevolution orientierte sich zunehmend weniger an neuen Quellen und Erkenntnissen als an miteinander konkurrierenden normativen Grundannahmen. Zu dieser Form des historischen Wunschkonzerts bemerkte Conan Fischer später leicht süffisant, es sei 1918/19 vor allem nicht jene Revolution gewesen, die sich nachgeborene Historiker gewünscht hätten.9 Bald jedoch waren auch solche Wunschvorstellungen kaum noch vernehmbar. Über die Novemberrevolution wurde nicht länger gestritten. Im Laufe der 1980er Jahre verlor das Thema an Bedeutung, weder die breite Öffentlichkeit noch die Historiker schienen sich fortan dafür zu interessieren. Angesichts der Nichtpräsenz zu ihrem 90. Jubiläum im Jahr 2008 mochte es sogar angebracht erscheinen, in ihr eine „vergessene Revolution“ zu erkennen.10
Dieses Desinteresse an einem über Jahrzehnte hinweg geschichtspolitisch polarisierenden Thema ist nicht leicht zu erklären. Ein Grund dürfte in der Entwicklung der Bundesrepublik selbst auszumachen sein. Die während der ausgedehnten Nachkriegszeit vorherrschende Sorge darüber, wie stabil das neue Staatswesen sein werde, schwand allmählich. Die Bundesrepublik verabschiedete sich im Laufe der 1980er Jahre von ihrem Provisoriumscharakter und damit auch von „Weimar“ als Gegenwartsargument mit identitätsstiftender Kraft.11 An diesem Trend änderte nicht einmal die friedliche Revolution von 1989 etwas Grundlegendes. Anders als man hätte erwarten können, belebte diese neue Novemberrevolution nicht das Interesse an der alten Novemberrevolution. Es traf sogar das Gegenteil zu, zumal bei jenen, die im Wandel von 1989/90 nur eine „nachholende Revolution“12 erkannten und damit eher einen End- als einen Anfangszustand begrifflich fassten. Dies korrespondierte mit der viel zitierten Annahme, es sei nunmehr ein „Ende der Geschichte“13 erreicht. In der Konsequenz gerieten Revolutionen schlechthin aus der Mode.
Seit einigen Jahren wandelt sich dieser Trend und die Beachtung der Novemberrevolution von 1918/19 nimmt wieder zu. Das liegt zum einen an dem mächtigen Sog einer Hundertjahrfeier, zum anderen an gewandelten Zeitläuften. Aufgrund aktueller zeitdiagnostischer Impulse und eines Gefühls neuer Verunsicherung stoßen revolutionäre Auf- und Umbrüche wieder auf stärkere Resonanz. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. und der damit einhergehenden Globalisierungs- respektive Kapitalismuskritik rücken Fragen nach grundsätzlichen Alternativen politisch-gesellschaftlicher Ordnung stärker in den Fokus: Sie spiegeln sich in institutionellen Legitimations- und Repräsentationskrisen wie in den Herausforderungen eines neuen Populismus. Auch die Rede von einer Rückkehr der Geschichte und von „Weimarer Verhältnissen“ ist wieder häufiger zu vernehmen.14 Vor diesem Panorama kann das gewachsene Interesse an den dynamischen, bisweilen chaotisch erscheinenden Zeiten nach dem Weltkriegsende 1918 kaum verwundern. Es ist das Interesse an einer am Anfang stehenden Geschichte, die gerade erst begonnen hat, neue Wege zu beschreiten, ohne dass ihr Ausgang von vornherein gewiss erscheint.
Diese kräftigen Gegenwartimpulse dürften mit dazu beigetragen haben, dass die Revolutionsforschung mittlerweile aus ihrem ausgedehnten Dornröschenschlaf erwacht ist.15 In gewisser Weise stehen die Geschichtsschreiber vor einem einst schockgefrosteten, nun durch die Jubiläumswärme des 100. Geburtstags und durch das erhitzte Klima der Gegenwartskrisis wieder aufgetauten Forschungsstand. Originäre Forschungen zu dieser nunmehr nicht länger vergessenen, ausgeblendeten oder „verdrängten“ Revolution16 kommen erst wieder in Gang. Es gilt neue Perspektiven und Fluchtpunkte der Geschichtsdeutung zu fixieren, während weiterhin Reflexe der alten Schlachten auftreten. Die Politik- und Arbeiterbewegungsgeschichte rund um die Zentren Berlin und München dominiert nach wie vor die Darstellungen. Sichtweisen der Kultur-, Medien- oder Intellektuellengeschichte, der Alltagsund Mentalitätsgeschichte melden Nachholbedarf an und werden die komplexe Lage des „langen Novembers“ der Revolution weiter entschlüsseln helfen.17
Nicht nur der Mangel an Detailforschungen wurde indes wiederholt kritisiert, sondern vor allem das Fehlen aktueller Gesamtdarstellungen zu einem so außerordentlichen Vorgang wie der Revolution von 1918/19.18 Mehr als dreißig Jahre nach Ulrich Kluges Synthese-Schrift in Hans-Ulrich Wehlers Reihe „Neue Historische Bibliothek“19 sind nun gleich mehrere neue Studien erschienen, die eine umfassende Würdigung der Novemberrevolution beanspruchen.20 Sie zielen mehr oder weniger explizit auf eine Neu- oder Umdeutung der Ereignisse von 1918/19 und – damit verknüpft – des Charakters der Weimarer Republik sowie auf eine je unterschiedliche Lokalisierung des Knotenpunkts der Novemberrevolution innerhalb der Kontinuität der modernen deutschen Geschichte. Ein demokratiegeschichtliches konkurriert dabei insbesondere mit einem gewaltgeschichtlichen, auf Willkürherrschaft und Diktatur zielenden Paradigma. Daraus entspringen unterschiedliche Narrative über den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert.21
Dieser Aufsatz skizziert beide Interpretationslinien, problematisiert aber vor allem die These von der Gründung der Weimarer Republik als Wendepunkt der Gewalt. Begrifflichtypologische Überlegungen werden dabei ebenso in den Blick genommen wie Fragen nach dem Charakter der soldatischen Formationen und dem zivil-militärischen Kräfteverhältnis während der Revolution und der Frühphase der Republik. Paradoxien der zeitgenössischen Wahrnehmung zwischen Eskalation und Deeskalation, Erwartung und Erfahrung im liberal-bürgerlichen Spektrum, das häufig weniger Aufmerksamkeit erhält als Positionen der verschiedenen Gruppierungen der Arbeiterbewegung, finden sich in einem nächsten Schritt erfasst. Abschließend werden regionale Abweichungen (von den Zentren Berlin und München) und transnationale Gewichtungen innerhalb des Tableaus der Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs zumindest knapp und kursorisch erörtert.
Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Marginalisierung von Kontexten und Motivlagen in aktuellen „Political-Violence“-Studien, deren Stärke in der dichten Beschreibung spezifischer Gewaltexzesse besteht. Entscheidende Rahmenbedingungen wie der Zusammenbruch der staatlichen Autorität am Ende des Ersten Weltkriegs und einander widerstreitende multiple Herrschaftsansprüche bleiben als übergeordnete Probleme dagegen unscharf. Abschließend gilt es ein Fazit zu formulieren, ob und in welcher Weise das Szenario 1918/19 eine wegweisende Zäsur der Gewaltgeschichte darstellte, von der aus sich eine quer durch die Weimarer Republik hindurchlaufende Transversale hin zur Diktatur zeichnen lässt.