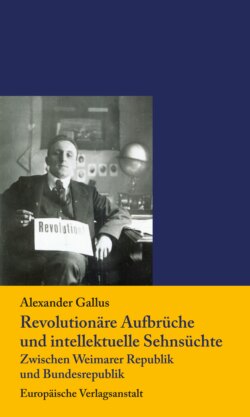Читать книгу Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte - Alexander Gallus - Страница 18
4. Interregionale und transnationale Vergleichsüberlegungen
ОглавлениеEin weiterer Kritikpunkt gegenüber der These, es habe sich bei der Novemberrevolution um einen Wendepunkt der Gewalt gehandelt, ergibt sich aus dem interregionalen und transnationalen Vergleich. Im Kern orientieren sich die gewaltgeschichtlichen Studien zur Revolutionszeit an den Szenarien in Berlin und München, darüber hinaus auch an den Industrieregionen in Mitteldeutschland und im Ruhrgebiet. Aus vergleichend regionalgeschichtlicher Sicht besteht noch großer Forschungsbedarf.113
Insbesondere Dirk Schumanns Habilitationsschrift Politische Gewalt in der Weimarer Republik setzte in dieser Hinsicht schon im Jahr 2001 einen wichtigen Markstein.114 Seine Studie ist insgesamt ein Beleg für die Militarisierung und Gewaltaffinität der politischen Kultur Weimars, und doch argumentierte Schumann insofern in eine ähnliche Richtung wie später Bergien und Keller, als er quellengestützte Befunde zu einem insgesamt „maßvollen Verhalten des Landesjägerkorps, der Einwohnerwehren, der Reichswehr und der Schutzpolizei zwischen 1919 und 1921“ zusammentrug.115 Damit wies er auch die häufig den Einwohnerwehren „zugeschriebene Schlüsselrolle“ zurück, „weite Teile des Bürgertums an die Anwendung auch extralegaler Gewalt gegen die Linke“ gewöhnt zu haben.116 Schumanns empirische Analyse stützte sich vorrangig auf Material mit Aussagekraft für die preußische Provinz Sachsen, die von weniger politischer Gewalt als Berlin, München oder das Ruhrgebiet geprägt war. Diese Vergleichskonstellation sensibilisiert zugleich dafür, nicht leichtfertig einen Teil (eine regionale Ausprägung) für das Ganze (das gesamte Deutsche Reich) zu nehmen.
Schumann strich zudem heraus, dass für die Gräueltaten Anfang der 1920er Jahre vor allem zurückgekehrte ehemalige Baltikumkämpfer die Verantwortung trugen.117 Es ist unstrittig, dass es am Ende des Ersten Weltkriegs in den Randbereichen der alten Reiche der Hohenzollern, Habsburger und Romanovs – beispielsweise im Baltikum – zu besonders vielen und besonders heftigen Gewaltexzessen kam. Staatliche Kontrolle und das Gewaltmonopol existierten dort kaum noch, multi-ethnisches Zusammenleben, das zu imperialer Zeit durchaus funktionierte, galt nunmehr als Bedrohung. Nationale „Reinheit“ kam gleichsam als Kehrseite des Drangs nach „Selbstbestimmung“ und als düster in die Zukunft weisende Losung auf.118
Das Wirken der marodierenden Freischärler im Baltikum war von blutiger Brutalität und Unbedingtheit gekennzeichnet.119 Eine andere Frage ist indes, ob sich die Erkenntnisse über Gewalthandlungen in den Bruchzonen des alten Imperiums ohne weiteres auf die Verhältnisse in den Zentren des Deutschen Reichs während der Revolutionsperiode 1918/19 übertragen lassen. „Eine bewusst brutale und regellose Kriegführung, wie sie vor allem im Baltikum nicht selten anzutreffen war“, taxiert Keller das Verhältnis skeptisch, „konkurrierte insbesondere im Reichsgebiet oftmals mit einer Strategie der kontrollierten militärischen Abschreckung, durch die Gewaltanwendung möglichst vollständig vermieden werden sollte.“120
Diese interregionalen Überlegungen leiten unmittelbar zu transnational vergleichenden Betrachtungen über.121 Sie rücken die deutsche Entwicklung in ein milderes Licht: Die Auswüchse brutaler physischer Gewalt erscheinen verglichen mit anderen Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs gering ausgeprägt. Auch widerstand die Weimarer Demokratie trotz des Versailles-Traumas besonders lange einer autoritären Kehre, die sich in vielen Ländern früher vollziehen sollte.122 Wer über die Binnenperspektive der insoweit gemäßigten deutschen Revolution hinausblickt, wird ihre Errungenschaften deutlicher sehen und ihre Versäumnisse weniger stark ins Gewicht fallen lassen.123
Aus dieser vergleichenden Sicht lässt sich ein deutscher Sonderweg der Gewalt von 1918/19 hinein ins „Dritte Reich“ kaum überzeugend konstruieren – einerseits. Andererseits eröffneten sich – auf der Transfer- und Verflechtungsebene – für das länderübergreifende Agieren nationalistischer Paramilitärs neue Möglichkeiten. So paradox dies auf den ersten Blick anmutet, strebten sie nach grenzüberschreitenden Gewaltgemeinschaften mit internationalistischem Anspruch. Dies zeigte sich in besonders eindrücklicher Weise am berühmtesten deutschen Gewaltexekutor der Novemberrevolution: Waldemar Pabst.124 Nach dem Mord an Luxemburg-Liebknecht und dem gescheiterten Kapp-Lüttwitz-Putsch führte ihn sein Weg ins aufgelöste Habsburgerreich zur Stärkung der österreichischen „Heimwehrbewegung“, bevor er Pläne für eine von Antisemitismus und Antibolschewismus angetriebene „Weiße Internationale“ schmiedete.125 Pabsts Erfahrung der Niederlage im Ersten Weltkrieg wirkte als Auslöser einer politischen Radikalisierung, die zunehmend in einer expansiven, nationale Grenzen überwölbenden Erwartungshaltung mündete. Sie verband letztlich eine ganze Reihe deutscher, österreichischer und ungarischer Nationalsozialisten miteinander. Hierin lässt sich in der Tat ein Traditionsstrang erkennen, der von den Freikorps zum Faschismus reichte.126