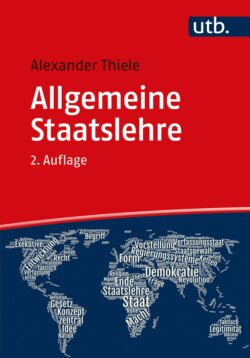Читать книгу Allgemeine Staatslehre - Alexander Thiele - Страница 27
5. Weitere Staatsbegriffe
ОглавлениеOriginäres Terrain der Allgemeinen Staatslehre wird allerdings dort betreten, wo es um die Entwicklung allgemeiner Staatsbegriffe geht, also versucht wird, das Wesen des modernen Staates konkret und losgelöst von den historischen Wesensmerkmalen und den völkerrechtlichen Notwendigkeiten zu fassen. Aus einer historisch-theoretischen Perspektive wird man in Anlehnung an die Dissertation von Christoph Möllers[316] die folgenden fünf Konzepte zu dem Kanon zählen können, zu dem sich auch eine moderne Allgemeine Staatslehre weiterhin verhalten sollte:
Zwei-Seiten-Theorie (Georg Jellinek). Jellinek, als Person einer der „Klassiker der Allgemeinen Staatslehre“,[317] unterschied einen Rechts- von einem Sozialbegriff des Staates, mithin eine sozial-faktischen von einer juristisch-normativen Beschreibungsebene von Staatlichkeit:[318] „Die erste hat zum Gegenstand den Staat als soziale Erscheinung. Sie wendet sich den realen, subjektiven und objektiven Vorgängen zu, aus denen das konkrete Leben der Staaten besteht […]. Die zweite hat zum Gegenstand die rechtliche Seite des Staates […]. Die juristische Erkenntnisweise des Staates hat die soziale daher zu ergänzen, ist aber in keiner Weise mit ihr zu vermengen.“[319] Damit konnte der Staat nach Jellinek zwar aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden, beide Perspektiven waren aber stets sauber voneinander zu scheiden: „Eine Vermischung des Rechtlichen mit dem, was vor dem Rechte liegt, soll in einer wissenschaftlichen Darstellung der Staatslehre nicht stattfinden.“[320] Damit ging Jellinek das Methodenproblem auf innovative Weise an, er versuchte gewissermaßen zwischen sozialer und normativer Staatslehre zu vermitteln: „Dass es Jellinek |55|in seinen zentralen Positionen und Begriffen vor allem auf die Vermittlung von Faktizität und Normativität ankam, zeigt bereits ein erster Blick in seine Allgemeine Staatslehre.“[321] Überzeugend zu lösen vermochte er das Methodenproblem damit freilich nicht. Mit Christoph Möllers: „Der Anstaltsstaat des staatsrechtlichen Positivismus wird der Wirklichkeit gegenüber gleichzeitig geöffnet und juristisch immunisiert.“[322] Gleichwohl vermag dieser vermittelnde Ansatz erklären, warum Jellinek bis heute besonders rezeptionsfähig erscheint, da jede positive Rechtsordnung weiterhin vor ähnlichen Vermittlungsproblemen steht: Sein Vermittlungsversuch „lässt Georg Jellinek als Klassiker für solche Juristen erscheinen, die für die Vermittlung von Faktizität und Normativität nach historischen Referenztexten suchen, um die normative Argumentation für sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zu öffnen, ohne gleichzeitig ihren juristischen Methodenanspruch aufzugeben.“[323]
Der Staat als Rechtsordnung (Hans Kelsen).[324] Nach dieser Vorstellung ist das Recht die einzige Ausdrucksform des Staates: Der Staat ist das Recht und das Recht ist der Staat; außerhalb des Rechts gibt es keine Form von Staatlichkeit, kein faktisches Staatswesen, das wie bei Jellinek durch das Recht aufgenommen und geformt werden könnte. In seiner Allgemeinen Staatslehre, die Matthias Jestaedt treffend als die erste Gesamtdarstellung der Reinen Rechtslehre einordnet,[325] führt Kelsen gegen Jellineks „Zwei-Seiten-Theorie“ des Staates gerichtet aus: „Ist erkannt, dass die Existenzsphäre des Staates normative Geltung und nicht kausale Wirksamkeit, dass jene spezifische Einheit, die wir in dem Begriff des Staates setzen nicht in der Welt der Naturwirklichkeit, sondern in jener der Normen oder des Wertes liegt, dass der Staat seinem Wesen nach ein System von Normen oder der Ausdruck für die Einheit eines solchen Systems ist, dann ist damit die Erkenntnis, dass der Staat als Ordnung nur die Rechtsordnung oder der Ausdruck ihrer Einheit sein kann, eigentlich schon erreicht […]. Ist der Staat ein Normensystem, kann er nur die positive Rechtsordnung sein, weil neben dieser die Geltung einer anderen Ordnung ausgeschlossen sein muss.“[326] Es ging bei Kelsen insofern nicht nur darum, den juristischen Staatsbegriff noch stärker in den Fokus zu rücken. Vielmehr behauptete |56|er die Unmöglichkeit eines außerrechtlichen Staatsbegriffs (auch für andere Disziplinen):[327] „Von jenem Gegensatz zwischen Staat und Recht, der die heutige Theorie beherrscht, kann jedenfalls keine Rede sein.“[328] Horst Dreier fasst diese Gedanken folgendermaßen zusammen: „Für Kelsen steht der Staat weder vor noch hinter und schon gar nicht über der Rechtsordnung, für ihn ist der Staat die Rechtsordnung; Staat und Recht sind identisch.“[329] Eine Erkenntnis, die Kelsen schließlich „zu der fragwürdigen, rein begrifflichen und deshalb auch bloß tautologischen Schlussfolgerung führt: ‚Jeder Staat ist Rechtsstaat.‘“[330] Auch deshalb dürfte sich Kelsens Staatsverständnis in der Folge nicht durchgesetzt haben;[331] die Indifferenz bezüglich unterschiedlicher Staatsformen[332] (Demokratie oder Diktatur) spielte demgegenüber wohl eher eine geringere Rolle. Die Lektüre seiner von brillanten Gedanken durchzogenen Allgemeinen Staatslehre sei im Übrigen gleichwohl wärmstens empfohlen.
Der faktische Staatsbegriff (Carl Schmitt). Gewissermaßen das Gegenmodell zu Kelsen bildete das Staatsverständnis Carl Schmitts, indem nicht die normative, sondern die faktische Seite des Staates in den Vordergrund gerückt wurde (wenngleich stets auf die konkrete Verfassung bezogen). Der Staat war damit für Schmitt bereits vorrechtlich existent und zwar als politische Einheit eines Volkes, das durch diese Einheit erst in die Lage versetzt wurde, sich und damit den Staat (in einer Verfassung) zu verrechtlichen. Diese vorrechtliche Einheit wirkte aber auch nach der Verrechtlichung als politische Seite des Staates fort und konnte Abweichungen von der Rechtsordnung legitimieren – etwa, wenn andernfalls die politische Einheit in Gefahr geriete. Hierin wurzelt denn auch der berühmte Ausspruch Schmitts wonach souverän derjenige ist, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Schmitt plädierte daher für eine strikte Trennung von dem die Einheit repräsentierenden Staat und der Gesellschaft/Wirtschaft und sah mit deren zunehmender Vermischung (vor allem durch die Parlamentarisierung und die Ausweitung des Sozialstaats) konsequenterweise bereits das Ende der (beziehungsweise jedenfalls seiner Vorstellung von) Staatlichkeit angebrochen.
|57|Wirklichkeitswissenschaftliches Staatsverständnis (Hermann Heller). Für Hermann Heller war vor allem die politische Wirklichkeit entscheidend, wenn es darum ging, den Staat zu definieren. Zentral waren für ihn daher die wirklichkeitsbezogenen Wissenschaften (Sozialwissenschaften). Er wandte sich damit nicht zuletzt gegen Kelsens positivistische (und entpolitisierende) Verrechtlichung, sah aber auch Jellinek insgesamt als zu unpolitisch an. Die verfasste politische Einheit (Schmitt) war für Heller zwar durchaus relevant, allerdings nicht in Form einer unveränderlichen und vorrechtlichen oder vorstaatlichen Einheit. Vielmehr beschrieb Heller das Volk als vielfältig, dass sich daher nur punktuell und situationsbezogen zu einer Einheit zusammenfinden kann, die vom Staat immer wieder hergestellt werden muss. Der Staat war für Heller daher eine organisierte Entscheidungs- und Wirkungseinheit, die sich von anderen (gesellschaftlichen) Einheiten dieser Art durch sein Gewaltmonopol unterschied, das zugleich die besondere Stellung des Staates ausmacht. Gerade diese letzte Prämisse wird in letzter Zeit vor dem Hintergrund der Globalisierung immer wieder (allerdings zu Unrecht) in Frage gestellt.
Staat als prozesshafte Integration (Rudolf Smend). Anders als Schmitt ging Smend nicht davon aus, dass dem Staat eine dauerhafte gefestigte politische Einheit voranging.[333] Die zunehmende Differenzierung der Gesellschaft führe vielmehr dazu, dass auch der Staat nicht mehr als etwas Dauerhaftes, sondern als etwas stets Wandelbares, als eine dynamische Einheit angesehen werden müsse, in der der erforderliche Zusammenhalt immer wieder neu hergestellt und realisiert werden muss: „Aus diesem Grund ist der Staat in der Integrationslehre keine an sich bestehende Person, die mit technischen und mit Machtmitteln bestimmte Aufgaben zu erfüllen sucht und dadurch in einen Gegensatz zum Einzelmenschen tritt. Das Problem der Fremdheit zwischen Staat und einzelnem kann gelöst werden, wenn der Staat nicht als reine Zweckschöpfung, sondern als eine Existenzweise und geistige Lebensgemeinschaft von Menschen erkannt wird. Die Integrationslehre unternimmt es, die Spannung zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft zu überwinden, indem der Staat als wesensnotwendige Lebensform des menschlichen Geistes betrachtet wird.“[334] Der Staat war für Smend eine konstante (geistige) Integrationsgemeinschaft. Er basierte auf dem „Sinnprinzip der Integration“ und überlebte allein dank eines gedachten Plebiszits, das sich jeden Tag aufs Neue wiederholte und mit dem die Bevölkerung ihre Zugehörigkeit zum Staat zum Ausdruck brachte: „[Der Staat] ist überhaupt nur vorhanden in |58|diesen einzelnen Lebensäußerungen, sofern sie Betätigungen eines geistigen Gesamtzusammenhangs sind, und in den noch wichtigeren Erneuerungen und Fortbildungen, die lediglich diesen Zusammenhang selbst zum Gegenstande haben […]. Es ist dieser Kernvorgang staatlichen Lebens […], für den ich […] die Bezeichnung Integration vorgeschlagen habe.“[335] Dass der moderne Staat auf die Integration seiner BürgerInnen angewiesen ist, wird heute nicht mehr bestritten. Smends Integrationslehre wird daher auch heute noch vielfach – nicht zuletzt im europäischen Integrationsprozess – rezipiert, was auch aufgrund ihrer inhaltlichen Offenheit gut möglich ist.[336] Wie Integration gelingen kann und wie unter anderem die (staatlich geförderte) Kultur dazu beitragen kann (etwa die Kunst) bleibt eine zentrale Frage im demokratischen Verfassungsstaat.
Für eine moderne Allgemeine Staatslehre können diese historisch-theoretischen Staatsbegriffe nicht den Endpunkt der Debatte darstellen. Das gilt schon deshalb, weil es sich um ausschließlich deutsche Konzepte handelt, die zudem allesamt aus vordemokratischen Zeiten stammen (zumindest aus deutscher Sicht), den Wandel zum Wohlfahrtsstaat damit ebenso wenig erfassen, wie die aktuellen Herausforderungen. Sie haben insofern vor allem historisch-theoretischen Wert, teilweise sind sie – wie der Schmitt’sche Begriff – für die Beschreibung des demokratischen Verfassungsstaates als pluralistischem Sozialstaat von vornherein unpassend und allenfalls als Kontrastfolie nutzbar. Das heißt selbstverständlich nicht, dass sie für die Entwicklung neuer Staatsbegriffe keine Grundlage darstellen könnten oder sollten. Sie müssen auch keineswegs umfassend verworfen werden, jedoch auf ihre fortbestehende Tauglichkeit für die Beschreibung und Bestimmung moderner Staatlichkeit immer wieder untersucht und gegebenenfalls angepasst werden. Dass aber etwa die Integrationslehre Rudolf Smends, die Verrechtlichungsthese Hans Kelsens und auch die Jellinek’sche Zwei-Seiten-Lehre weiterhin wissenschaftlich wertvolle, ja grundlegende Beiträge darstellen – gerade auch im Hinblick auf die europäische Integration[337] –, an denen keine Allgemeine Staatslehre vorbeikommt, wird niemand bestreiten. Gleichwohl überrascht der Befund, dass es in den letzten Jahrzehnten nur vergleichsweise wenige Versuche gegeben hat, aktuellere Staatsbegriffe zu entwickeln, die die Wandlungen von Staatlichkeit in Zeiten von Globalisierung aber auch Digitalisierung angemessen zu erfassen vermögen. Seinen Grund findet das |59|gewiss nicht zuletzt in der zunehmenden Ablösung des Staatsbegriffs als wissenschaftliche Beschreibungskategorie, die sich bereits in der Weimarer Zeit abzeichnete, als die klassische Allgemeine Staatslehre ihre Hochzeit bereits überschritten hatte. An die Stelle des Staates trat vielmehr die Verfassung, an die Stelle der Allgemeinen Staatslehre die Verfassungslehre oder schlicht das Verfassungsrecht. Als Vertreter, die sich für eine solche Aufwertung des Verfassungsbegriffs stark machten, wird man in der früheren Bundesrepublik vor allem Peter Häberle und Konrad Hesse nennen können. Die mit dieser Aufwertung bisweilen suggerierte „Reinigung“ von sozialwissenschaftlichen, politischen oder (subjektiven) staatstheoretischen Einflüssen war freilich nur eine scheinbare[338] (was allerdings nur selten zu stören schien). Der „reaktionäre“ Versuch den Staatsbegriff als Reaktion auf diese Entwicklungen wiederzubeleben und dem klassischen souveränen Einheitsstaat neben oder vor der Verfassung einen eigenständigen Wert oder gar die Funktion einer Verfassungsvoraussetzung zuzuweisen wird man mittlerweile zwar als im Kern gescheitert ansehen müssen – auch weil dieser Versuch auf interdisziplinäre Verständigung praktisch vollständig verzichtete. Indes lieferte auch die „Neue Staatswissenschaft“ mit ihrem ausdrücklichen interdisziplinären und pluralistischen Ansatz keine mit wenigen Worten zu beschreibende eingängige neue Definition von Staatlichkeit für das 21. Jahrhundert. Gunnar Folke Schupperts Vorstellung der steten Veränderung des modernen Staates, des „Staat[es] als Prozess“[339] weist zwar treffend auf die Dauerhaftigkeit des Wandels moderner Staatlichkeit hin und betont damit die Notwendigkeit einer dynamischen und nicht-statischen Betrachtung des modernen Staates gerade auch durch die Allgemeine Staatslehre. Für das, was der moderne Staat in seiner gegenwärtigen Form „ist“ – auch wenn er sich kontinuierlich wandelt, hat er zu jedem Zeitpunkt auch einen aktuellen Status, der beschrieben und definiert werden kann – liefert diese Perspektive mit ihrer Betonung der „Steuerung“ und der „Governance“ im Ergebnis keine wirklich befriedigende, zumindest aber eine allzu weitgefasste Antwort. Für die Allgemeine Staatslehre ist das kein zufriedenstellender Befund. Zwar tun sich auch andere Disziplinen mit der Definition ihres zentralen Forschungsgegenstands schwer, was nicht per se als problematisch angesehen werden muss. Zu nennen wäre die Politikwissenschaft und ihr Begriff des Politischen. Hier gilt insofern das, was Elif Özmen unlängst auch für die politische Philosophie festgehalten hat: „Positiv gewendet erscheinen dieser Pluralismus und die damit verbundene methodische und inhaltliche Offenheit als der |60|angemessene Ausdruck der Komplexität und Wichtigkeit des Gegenstandes.“[340] Gleichwohl dürfte es für die jeweilige Disziplin zentral sein, dass diese Grundlagendebatte dauerhaft geführt und mit neuen Ideen und Lösungen bereichert und an die Zeitumstände angepasst wird. Das gilt auch für die Allgemeine Staatslehre, die aufgerufen ist, neue und realitätsnahe Konzepte von Staatlichkeit zu entwickeln und zur Diskussion zu stellen. Diese sollten neben normativen auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen (Individualisierung, Digitalisierung, soziale Medien etc.) aufnehmen und verarbeiten – eine Forderung, die interessanterweise bereits Ernst Forsthoff Anfang der 70er Jahre formuliert hat (wenn auch vor allem im nostalgischen Blick zurück auf den klassisch-modernen, und von der Gesellschaft getrennten souveränen Staat).[341] Anders gewendet: Wer nicht mehr über den Staat spricht, muss sich nicht wundern, wenn die Allgemeine Staatslehre aufhört.[342]
Ein Beispiel für ein solches Konzept stellt der von Thomas Vesting in Anlehnung an, aber auch in Abgrenzung von Karl-Heinz Ladeur[343] präsentierte und zudem die Gedanken des Schuppert’schen Gewährleistungsstaats[344] aufnehmende „Netzwerkstaat“ dar.[345] Mit diesem Modell versucht Vesting die Folgen der Algorithmisierung und die darin begründete Fragmentierung der Gesellschaft in spontane Ordnungen[346] und Schwarmbildungen („Schwarmdemokratie“[347]) zu erfassen. Ergänzend wird es auch darum gehen müssen, die nicht nur, aber auch mit der Digitalisierung zusammenhängenden Verluste kommunaler und regionaler Zusammengehörigkeitsnarrative für den Begriff der und den Fortbestand von Staatlichkeit analytisch zu durchdringen. Diese Staatsdefinition oder Staatsbeschreibung, deren Anfänge nach Vesting bereits in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreichen, könnte den Ausgangs- und Reibepunkt einer modernen Allgemeinen Staatslehre bilden, die |61|sich ihrer historisch-theoretischen Fundierung ebenso wie ihrer aktuellen Beschreibungs-, Einordnungs- und normativen Konstruktionsaufgabe bewusst ist. Das bedeutet nicht, diesen Beschreibungsversuch übernehmen oder ihn gar zum neuen Referenzmodell erklären zu müssen. Dass er im Ausgangspunkt aktuelle Phänomene der (zunehmend digitalisierten) Postmoderne treffend beschreibt und im Staatsbegriff spiegelt, wird man jedoch nicht bestreiten können. Ohnehin tritt der Netzwerkstaat in Vestings Konzeption weder an die Stelle des Verfassungs- noch des Wohlfahrtsstaates, sondern ergänzt diese lediglich um eine dritte Ebene.