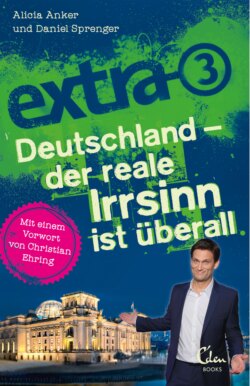Читать книгу extra 3. Deutschland - Der reale Irrsinn ist überall - Alicia Anker - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Grüne C
Köln hat seinen Dom, Düsseldorf die Kö und Bonn den Charme der etwas provinziellen ehemaligen Hauptstadt. Da die Stadt nicht allein vom Ruf der Vergangenheit leben kann, hat sie sich einem zukunftsträchtigen Projekt angeschlossen, an dem so namhafte Städte und Gemeinden wie Alfter, Bornheim, Niederkassel, Sankt Augustin und Troisdorf teilhaben. Bei der Erklärung des Projekts gerät Rainer Gleß, Erster Beigeordneter der Stadt Sankt Augustin, ins Schwärmen. »Es verbindet Landschaftsräume und es erschließt Landschaftsräume für Erholungssuchende«, sagt Gleß, während er im Regen auf einem geteerten Weg durch die Hangelarer Heide spaziert. Diese liegt im mittleren Bereich des insgesamt 17 Kilometer breiten Projekts, das sich über den Rhein hinweg erstreckt. »Es soll die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger der Region mit ihrem Lebensraum, mit ihrer Landschaft stärker erhöhen, als es bisher der Fall ist.«
»Sieben Millionen Euro hat der Spaß gekostet! Da ist dann aber hoffentlich auch das Koks mit dabei für die Werbefuzzis, die sich das ausgedacht haben.«
Wo jahrzehntelang nur ein stinknormales Netz aus Rad- und Spazierwegen die Städte verband, ist im Zuge des Strukturprogramms Regionale 2010 das »Grüne C« entstanden. So heißt das wegweisende Konzept. »Die Grundform des Grünen C, also des Landschaftsraumes, der miteinander verbunden wird, ist – mit etwas Fantasie – ein auf den Kopf gedrehtes C«, erklärt Gleß und zeigt auf einem Plan die sechs umkreisten Landschaftsräume. Um das C zu erkennen, benötigt man in der Tat recht viel Fantasie.
Wer sich darauf einlässt, dem wird schnell klar, dass die Möblierung der Landschaft im C das A und O ist. Etwa mit den sogenannten Toren, das sind »naturnah gestaltete Orte, die den Übergang vom Wohngebiet in die Landschaft markieren«, wie es auf der Homepage des Grünen C heißt. Die Tore stünden vornehmlich an Engstellen, an denen der zunehmende Siedlungsdruck besonders deutlich werde. »Im eigentlichen Sinne handelt es sich bei den Engstellen um gegenüberliegende Ränder mit mehr oder weniger breitem Zwischenraum«, heißt es weiter. Alles klar? Noch nicht? Die Erklärung geht ja auch noch weiter: »Dieser Zwischenraum soll durch Stärkung der Ränder gesichert werden.« Wem das zu verquast klingt, der war noch nicht selbst vor Ort im Grünen C und hat nicht die pfiffigen Elemente gesehen, die die Planer sich ausgedacht und in der Landschaft platziert haben. Grün ist daran allerdings meist gar nicht so viel, denn die Elemente bestehen in der Regel aus Beton.
Sechs Landschaftsräume – ein Grünes C: Es ist ein Projekt voller wundervoller Orte wie diesem, durch den Rainer Gleß führt.
Beispielsweise die Tafeln im Boden, auf denen Ortsbezeichnungen stehen. Etwa »Rhein« und daneben ein Pfeil in die entsprechende Richtung. »Das weiß nun jeder, dass da hinten der Rhein fließt, dafür braucht man kein Schild«, bemerkt ein Spaziergänger. »Ich denke, es werden relativ wenig Ortsfremde hier spazieren und die Leute, die hier wohnen, wissen ohnehin, wo der Rhein liegt. Insofern hätte man sich das sparen können.«
Aber wieso sparen? Wenn man eh schon extra die alte Asphaltdecke des Fuß- und Radweges aufschneidet, um eine Betonplatte zu verlegen, kann man in die doch auch gleich noch einen Schriftzug hineinfräsen.
Es gibt im Grünen C jedoch auch weniger offensichtliche Gestaltungen. Hinter dem Rhein-Schild steht ein niedriges rechtwinkliges Konstrukt. Ob der Spaziergänger denn wohl auch weiß, was das sein soll? »Ich gehe mal davon aus, dass es Beton ist«, sagt er. So weit, so richtig. Aber was soll es darstellen? »So wie das aussieht, eine Bank. Ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte.«
Da springt ihm Rainer Gleß, der Experte fürs Grüne C, gern zur Seite. Für ihn ist völlig klar: Das, was aussieht wie eine Bank, ist definitiv »keine Bank! Das ist das sogenannte C-Signet.« Das sei ein immer wiederkehrendes Symbol für das Grüne C, erläutert Gleß. Ein aus Beton geformtes, rechtwinkliges C – darauf muss man erst mal kommen. Besser könnte man die Menschen nicht darauf hinweisen, dass sie sich im Bereich des Grünen C befinden. Und es funktioniert: »Das wird mittlerweile von den Menschen als solches durchaus wahrgenommen«, ist Gleß überzeugt.
Beeindruckende Betonelemente werten die Landschaft auf. Hier etwa das C-Signet, das eindeutig erkennbar auf das Grüne C hinweist.
»Das ist völliger Blödsinn. Das ist für mich eine Bank«, hält der renitente Spaziergänger dagegen. »Alle anderen Auslegungen wären also wirklich weit hergeholt. Also ich kann kein C daraus erkennen. Dafür muss man schon sehr viel Fantasie haben.« Da ist sie wieder, die Fantasie. Aber die Planer sind durchaus zu Zugeständnissen bereit: »Wenn jemand glaubt, sich auf das Grüne-C-Signet setzen zu wollen, dann bitte schön«, sagt Gleß.
Zum entspannten Sitzen sind jedoch eigentlich die »Stationen« vorgesehen, natürlich auch aus Waschbeton und natürlich auch in der ganz eigenen Form. »Die Seitenansicht der Sitzelemente soll an eine abstrahierte Form des Buchstaben C erinnern«, heißt es auf der Homepage des Grünen C. Die C-Form ist bei den Rastmöglichkeiten so konzipiert, dass eine Bodenplatte, eine leicht schräge Wand und ein Dach das C bilden.
Solch ausgetüftelte Landschaftsmöblierung kostet natürlich auch: 24,6 Millionen Euro, die vom Land, vom Bund und aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung kommen. Gleß hat die detaillierten Zahlen für Sankt Augustin: »Die Gesamtsumme beträgt etwa sieben Millionen Euro. Und die Platzelemente mit allem Drum und Dran kosten etwa zehn Prozent, das macht etwa 670.000 bis 680.000 Euro.«
Der Spaziergänger ist irritiert, als er hört, wie teuer die Platzelemente waren. »Dann fragt man sich natürlich, ob das in den Dimensionen hätte sein müssen«, sagt er, als er zusammen mit seiner Frau auf einem Weg aus Betonplatten zu einem Geländer geht. Die beiden steuern den C-Höhepunkt in Sankt Augustin, ja wenn nicht im gesamten Projekt, an. »Hier befinden Sie sich an einer der wichtigsten Stationen, die das Grüne C begleiten, und zwar der Station Hangelarer Heide«, erklärt Gleß. Das Tableau diene dazu, unmittelbar zur Kante zu gehen und von hier aus den Blick über die ganze Umgebung ein wenig schweifen zu lassen.
Das Besondere an dieser Station: die ausgeprägte Blickbeziehung über die Hangelarer Heide. Von neben der Plattform aus ist die nicht ansatzweise so möglich. Nur identisch.
»Von dieser Station aus hat man eine sehr ausgeprägte Blickbeziehung in Richtung Osten/Südosten«, doziert Gleß. Gegenüber befinde sich der Flugplatz Hangelar, der älteste noch in Betrieb befindliche Flugplatz Deutschlands, »eines der Alleinstellungsmerkmale der Stadt Sankt Augustin. Von daher haben wir, die Planer, uns überlegt, wir wollen das würdigen durch den Bau einer solchen Station.« Genau richtig entschieden, denn der Blick von direkt neben der Station ist zwar identisch, doch die Blickbeziehung sicher längst nicht so ausgeprägt ohne die Station.
»Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hätte, das hier müsste man haben und das ist ganz toll«, meint der Spaziergänger wenig beeindruckt. Aber nicht verzagen: Es braucht einfach seine Zeit, bis so ein visionäres Landschaftsmöblierungsprojekt in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Da müssen die Planer einfach C sein.
Anreise
Das Grüne C ist eine großflächige Landschaftsmöblierung mit eigener Internetseite: www.gruenes-c.de. Hier gibt es viele Infos zum Hintergrund, zu den umgesetzten Bauwerken und ihren Standorten. Ein Highlight des Grünen C, das Plateau Hangelarer Heide mit der ausgeprägten Blickbeziehung, befindet sich am Ende der Straße In den Hasenkaulen, 53757 Sankt Augustin.