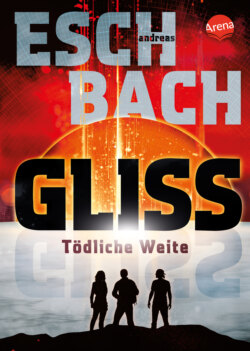Читать книгу Gliss. Tödliche Weite - Andreas Eschbach - Страница 11
Оглавление
Ich versuchte wirklich, mich in mein Schicksal zu fügen. Ich stand so früh auf wie immer, doch ich ging nicht mehr in die Schule, sondern zog meine Stiefel an, genau wie Vater, schulterte eine Hacke, nahm einen Eimer, und so marschierten wir zusammen hinauf zum Grat.
Die Sonne ließ uns jeden Morgen blinzeln, weil es von da oben aussah, als stünde der Horizont in Flammen. Dann ging es quer über die Wiesen hinab zum Loch, das so schwarz dalag, als hätte man es aus der Landschaft gestanzt. Die Felder ringsum sahen aus wie Kuchenstücke. Wir stiegen über den Zaun, der die Rentiere fernhalten sollte, und dann ging es los: Unkraut jäten, Wassergräben ziehen, Boden hacken, fein zerkrümeln, glatt streichen und aufbereiten.
Das Aufbereiten ist notwendig, weil der Boden unserer Welt für die Pflanzen, deren Früchte wir essen, fremd ist. Sie stammen von der Erde und damit aus einem völlig anderen biologischen Umfeld. Man denkt, Pflanzen holen mit ihren Wurzeln Nährstoffe aus dem Boden, aber so einfach ist es nicht: Tatsächlich sind es bestimmte Bodenbakterien, die diese Nährstoffe aus den Mineralien lösen, also dem Gestein, aus dem der Untergrund besteht. Die Pflanzenwurzeln bekommen die Nährstoffe von diesen Bakterien.
Unsere Vorfahren waren so schlau, außer Pflanzen und Tieren auch solche Bodenbakterien mit auf die Große Reise zu nehmen. Mit einem Substrat daraus müssen wir die Felder immer wieder auffrischen, weil die Überflutungen die Bakterien nach und nach auswaschen, und ohne sie wächst nichts mehr.
Substrat – das klingt großartig, aber tatsächlich ist es einfach nur schleimiges Zeug, das wir in Dosen aus einer Fabrik in Hope bekommen, wo man die Bakterien züchtet.
Dass sich Rentiere und Ziegen an das Leben auf Hope angepasst haben, war übrigens reines Glück. Die meisten anderen großen Tiere sind bald nach der Ankunft ausgestorben – Kühe, Pferde, Schweine und so weiter. Die kenne ich nur von Bildern.
Ach ja, Mäuse haben sich auch angepasst. Leider. Und, wie schon erwähnt, Katzen.
So plagte ich mich Tag für Tag auf den Feldern. Und es ging immer so weiter. Anfangs hatte ich das Gefühl, die Tage nicht durchzustehen, fiel abends ins Bett und schlief wie tot, manchmal sogar, ohne den Nachtvorhang zu schließen. Doch mit der Zeit gewöhnte ich mich an die harte Arbeit, wobei ich nicht wusste, ob ich das gut finden sollte oder beunruhigend. Immerhin hatte ich nun abends manchmal noch genug Energie, um mich mit Phil zu treffen. Das erste Mal saßen wir im Buschland am Wasserriss und jammerten. Er, weil er sich am Backofen verbrannt hatte, und ich, weil mir der Rücken wehtat.
Dann fing Mutter davon an, dass es Zeit für die Vorbereitungen zu meinem Sechshunderterfest sei. Jeden Abend nervte sie wieder, wen wir einladen müssten, was es zu essen geben solle und so weiter. Man müsse auch die Verwandtschaft meines Vaters einladen – dabei kannte ich die kaum. Mein Vater stammt aus dem Dunklen Land, und dort sind die Leute, ehrlich gesagt, etwas seltsam. Das Land ist natürlich nicht wirklich dunkel, es heißt nur so, weil es weiter nachtwärts liegt und weniger Sonne abkriegt als wir. Sie züchten dort hauptsächlich Ziegen und handeln mit deren Milch. Wer das nicht will, betreibt Bergbau, sprich: Er kratzt Eisenerz aus dem Boden und lässt es in Richtung der Hochöfen von Hope rutschen. Man kommt schwer hin, weil die Glisspfade dort den halben Tag von Erz blockiert sind.
Über Einladungen wollte ich schon deshalb nicht nachdenken, weil ich auch Nagendra würde einladen müssen.
Vor allem aber wollte ich nicht über mein Sechshunderterfest nachdenken, weil das so etwas Endgültiges hatte. Danach würde ich als erwachsen gelten, und ich fühlte mich kein bisschen so! Mein Sechshunderter kam mir vor wie ein großes schwarzes Tor, dem ich entgegenschlitterte und das mich einfach verschlingen würde.
Nach einer Weile schlief ich nicht mehr gut, wachte nachts auf, wälzte mich und konnte ewig nicht wieder einschlafen. Schließlich stand ich auf, knöpfte den Nachtvorhang beiseite und setzte mich ans Fenster, um zu lesen. Einmal versuchte ich mich an Großmutters altem Physikbuch, doch dabei überkam mich eine so schreckliche Wut, dass ich es am liebsten zerrissen hätte. Ich konnte mich gerade noch beherrschen und stopfte es, erschrocken über mich selbst, zurück in die Schublade.
Ich begann, nächtliche Spaziergänge zu unternehmen. Ganz leise, um niemand zu stören, schlich ich die Treppe hinab und zur Tür hinaus.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Nacht nicht sonderlich vom Tag. Es ist hell, der Wind weht, Insekten tanzen als kleine, schimmernde Pünktchen in der Luft, und die Windräder oben am Grat drehen sich mit leisem Rauschen. Alles andere aber ist – still.
Nachts hatte ich die Welt für mich allein. Wohin ich auch schaute, alle Fenster waren verhangen, und niemand außer mir war unterwegs. Niemand, der sprach oder lachte oder schimpfte, niemand, der hämmerte, klapperte oder Türen schlug. Es war, als könne ich spüren, wie sie alle schliefen, tief und fest, erschöpft von der Arbeit des Tages.
Unwillkürlich trat ich leiser auf, weil mir jeder meiner Schritte übermäßig laut vorkam. Wenn ich ein Steinchen anstieß und es davonkullerte, schien es das laut rumpelnd zu tun, und prallte es auf ein anderes, war mir, als müsse von dem Krach das ganze Dorf erzittern.
So schlich ich mehr, als zu spazieren, und ich ging nicht weit: Mein Lieblingsplatz wurde die Barrikade, wo ich mich setzte, die Beine baumeln ließ und mich dem eigenartig gruseligen Gefühl hingab, die Füße ohne den geringsten Halt über das Gliss gleiten zu spüren.
So ließ ich die Gedanken schweifen, bis sie irgendwann zur Ruhe kamen und die Müdigkeit zurückkehrte. Dann erhob ich mich leise, schlich nach Hause, ging wieder zu Bett und schlief friedlich bis zum Schlag der Morgenglocke, als wäre nichts geschehen.
Manchmal aber kamen sie auch nicht zur Ruhe, meine Gedanken. Dann grübelte ich über mein Leben nach und darüber, wie ich alle Chancen vertan hatte. Einen Träumer hatten sie mich immer genannt, einen Spinner, und wie es aussah, hatten sie recht behalten. Ich erkannte, dass ich viel zu spät angefangen hatte, mir Gedanken über das »Später« zu machen. Darüber, wie ich mir mein Leben vorstellte und was ich tun musste, damit es auch so werden konnte.
Und kaum hatte ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, hatte ich es auch gleich gründlich versiebt.
Ich dachte in diesen Nächten oft an Großmutter. Was sie mir wohl geraten hätte? Ich hätte mir so sehr gewünscht, sie fragen zu können. Ich versuchte, mich zu erinnern, wie ihre Stimme geklungen hatte, aber es gelang mir nicht. Ich rief mir ihre Geschichten ins Gedächtnis, doch die halfen mir auch nicht.
An einem dieser Abende, an denen ich wieder einmal auf der Brücke saß und in die Weite hinausstarrte, ohne dass die Müdigkeit kommen wollte, bemerkte ich plötzlich etwas. In dem formlosen silbernen Schimmern jenseits der Felsen, an denen unser Glisspfad endet, bewegte sich ein dunkler Punkt.
Das war an sich nichts Ungewöhnliches. Selten, das schon. Aber wenn man lange genug hinausschaute, sah man manchmal eine Bewegung dort draußen – oder konnte es sich zumindest einbilden. Man wusste natürlich nie genau, aber die wahrscheinlichste Erklärung war, dass einfach ein Stein oder etwas Ähnliches über das Gliss sauste.
Der Unterschied war, dass dieser Punkt auf mich zukam.
Ich ließ ihn nicht aus den Augen. Es war schwer zu sagen, wie weit entfernt er sein mochte und wie groß. Aber auf jeden Fall wurde er immer größer. Bald war es mehr als nur ein Punkt, der sich da näherte, sondern ein längliches Gebilde, das geradewegs in die Mündung unseres Pfads gerutscht kam.
Ich stand auf. Das Ding glitt immer noch auf mich zu oder besser gesagt, auf die Barriere. Es bewegte sich so langsam, dass man am Ufer bequem nebenher hätte laufen können. Ich reckte den Hals, ungeduldig.
Als ich erkannte, was es war, hätte ich beinahe aufgeschrien.
Es war ein Mensch. Ein Toter.