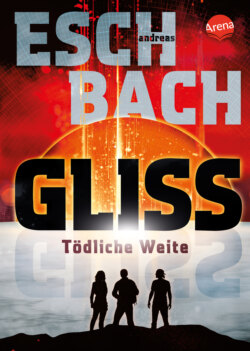Читать книгу Gliss. Tödliche Weite - Andreas Eschbach - Страница 8
Оглавление
Bei der Sache mit der Universität gab es nur ein Problem: Wenn ich dorthin wollte, brauchte ich bessere Noten. Viel bessere Noten. Ich würde richtig lernen müssen. Bisher hatte ich den Unterricht nur über mich ergehen lassen, und entsprechend sahen meine Noten aus.
Nagendra hatte den Vorteil gehabt, dass sein Vater zugleich unser Lehrer war. Zwar hatte Onkel Prabhu bei der Benotung seines Sohns bestimmt nicht geschummelt, aber Nagendra hatte sich alles so oft von ihm erklären lassen können, bis er es kapiert hatte.
Welchen Vorteil hatte ich?
Mir fiel das Physikbuch wieder ein, das mir Großmutter vermacht hatte. Ein Buch, das sonst niemand besaß! Wenn darin etwas stand, das sonst niemand wusste, würde ich einen gewaltigen Vorteil haben!
Mit zittrigen Fingern kramte ich es aus der Schublade, in der es seit Großmutters Tod lag. Ich hatte es seither nicht mehr angefasst, und jetzt, da ich es in Händen hielt, musste ich voller Wehmut an sie denken.
Was sie wohl gesagt hätte zu meinem Vorhaben? Ach, ich wusste es genau. »Mach das, Ajit«, hätte sie gesagt und mir die Wange getätschelt. »Du schaffst das!« Mir war fast, als hörte ich ihre Stimme.
Ich musste lächeln.
Zum ersten Mal sah ich mir das Buch genauer an. Es hatte einen harten Einband, auf dem allerlei mathematische Symbole abgebildet waren, Kugeln, die eine Schräge hinabrollten, und Zahnräder, die ineinandergriffen. Ich schlug es auf und begann zu lesen.
Doch meine Hoffnung erfüllte sich nicht. Es standen dieselben Formeln darin wie in unseren abgenutzten Schulbüchern, die so alt waren wie Letz selbst. Alles wurde ein bisschen besser erklärt, auch wenn die Farben der Zeichnungen verblasst waren. Und man erfuhr allerlei über das Leben und Werk großer Physiker, über Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein und so weiter.
Das Buch war toll, aber es würde mir das Lernen nicht ersparen.
Normalerweise hätte ich vor dieser Aussicht aufgegeben. Doch jeden Morgen, wenn ich zum Unterricht ins Gemeindehaus kam, begegnete ich Majala, und jedes Mal, wenn ich sie sah, musste ich daran denken, dass sie Nagendra geküsst hatte. Das ließ etwas in mir auflodern wie eine Flamme: eine wütende Entschlossenheit, auch auf die Universität zu gehen und es meinem widerlichen Cousin zu zeigen!
Und so setzte ich mich Tag für Tag an die Schulsachen. Las Großmutter Neelams Buch gründlich und konzentriert. Versuchte, es wirklich zu verstehen. Fragte Onkel Prabhu, bis ich es kapierte. Machte die Übungen. Alle.
Das blieb nicht unbemerkt. »Sag mal«, meinte Phil bald, »was ist mit dir los? Wirst du jetzt zum Streber?«
Streber, das war ein schlimmes Schimpfwort. In den Verdacht, ein Streber zu sein, durfte man nicht kommen. Nagendra hatte es geschafft, dass es bei ihm immer so aussah, als fiele ihm alles leicht. Wenn es einem leichtfiel, war man kein Streber, und wenn man einfach nur Glück hatte, auch nicht.
»Quatsch«, erwiderte ich also. »Es interessiert mich bloß.«
»Mathe interessiert dich?« Er sah angewidert aus.
»Das ist nicht einfach nur Mathe«, belehrte ich ihn. »Du musst das im großen Zusammenhang sehen.«
»Was für ein Zusammenhang?«
Da half nur eins: Ich begann, Geschichten zu erzählen.
Ich weiß nicht mehr, wie klein ich war, als ich zum ersten Mal hörte, wie jemand behauptete, dass wir von einer anderen Welt stammten. Einer Welt, die völlig anders gewesen sein sollte. Einer Welt, deren Himmel blau war. Mit einer Sonne, die sich über diesen blauen Himmel bewegte, um jeden Abend zu verschwinden und jeden Morgen wieder aufzutauchen. Ein Himmel, von dem manchmal Wasser herabfiel, das man Regen nannte, bisweilen so viel davon, dass es Dörfer und Städte überschwemmte und Menschen darin ertranken. Ja, so viel Wasser soll es auf dieser Welt gegeben haben, dass es riesige Seen, Meere, Ozeane bildete – Wasserlöcher, so groß, dass man nicht vom einen zum anderen Ende schauen konnte!
Das konnte ich mir anfangs überhaupt nicht vorstellen. Der Himmel, den ich kannte, war braun oder orange oder, vor den Flutnächten, golden. Die Sonne stand immer sonnwärts, der Wind kam immer von nachtwärts, und manchmal brachte er warmen, feuchten Nebel mit, der aus den unzugänglichen Wasserlöchern im Leeren Land aufstieg.
Ich glaubte kein Wort. Ich war überzeugt, dass das nur wieder so eine Geschichte war, wie Erwachsene sie Kindern erzählen, wie die vom Geschenkemann oder vom Zahngeist: Ich hatte sehr wohl bemerkt, wie Mutter meinen ersten Milchzahn unter dem Kopfkissen weggenommen und einen Eisentaler dafür hingelegt hatte!
Aber Großmutter sagte mir, dass das mit dieser Erde kein Märchen war, sondern die reine Wahrheit. Sie zeigte mir alte Fotos und versicherte mir, dass sie echt waren; dass es auf der Erde wirklich so große Meereswellen und so dichte Wälder gegeben hatte. »Wir sind tatsächlich erst seit kurzer Zeit auf diesem Planeten«, sagte sie ernst. »Vor wenig mehr als zwanzig Quart sind die Ersten von uns angekommen, von der Erde. In den alten Sternkarten hieß unsere Welt Ross-128b – das musst du dir nicht merken. Die Siedler haben gehofft, hier ein neues Leben aufbauen zu können, und deswegen den Planeten genauso genannt wie die erste Stadt, nämlich Hope, Hoffnung.«
Sie erzählte mir von der Großen Reise. Sie hat von der Erde fort ins tiefe All geführt, durch eine schier endlose Leere. Und sie hat so lange gedauert, dass die meisten von denen, die aufgebrochen sind, die Ankunft gar nicht mehr erlebt haben. Die meisten derer, die angekommen sind, wurden erst unterwegs geboren.
Eine Zeit lang konnte ich gar nicht genug kriegen von Geschichten über die Große Reise. Diese Geschichten erzählte ich nun Phil, und ich verband das, was wir in der Schule lernten, damit.
Das Große Schiff hatte nämlich ungefähr die Gestalt eines Zylinders. Man weiß, wie lang es gewesen ist und welchen Durchmesser es gehabt hat, also konnten wir ausrechnen, wie viel Platz darin gewesen ist. Es waren etwa viertausend Siedler an Bord gewesen, also konnten wir ausrechnen, wie viel Wasser und wie viel Sauerstoff sie pro Tag gebraucht haben. Wir wussten, welche Entfernung sie zurückgelegt hatten – fast zwölf Lichtjahre – und dass sie die in etwa sechs Quart bewältigt hatten, also konnten wir ausrechnen, wie schnell sie ungefähr geflogen sind. Und so weiter.
Mathematik und Physik waren auch nötig, um auszurechnen, wie man den Kurs setzen musste, um in die Umlaufbahn um einen Planeten zu kommen, doch wie man das genau machte, lernten wir nicht. Das sei viel zu kompliziert, meinte Onkel Prabhu, als ich danach fragte. Außerdem bräuchten wir das nicht zu können; jetzt seien wir ja am Ziel.
Phil begriff das im Prinzip schnell, aber die Details und die genauen Zahlen kümmerten ihn nicht. Was ihn interessierte, war das Abenteuerliche an diesem Vorhaben.
»Stell dir vor«, meinte er, »manche von denen, die die Große Reise gemacht haben, waren erst so alt wie wir, als es losgegangen ist. Wenn es heute wieder so eine Reise gäbe, könnten wir ohne Weiteres mitfliegen!« Dieser Gedanke faszinierte ihn am allermeisten.
Ich ließ mich von seiner Begeisterung anstecken. »Ja, wir würden mitfliegen.« Ich sah alles genau vor mir. »Wir würden an Bord gehen, und sie würden die Türen hinter uns schließen und luftdicht versiegeln. Dann würde der Raketenmotor starten und uns antreiben, immer schneller und schneller, pfeilgerade auf das Ziel zu!«
Damit streckte ich die Hand aus und reckte sie zum Himmel, der sich goldbraun über uns wölbte und hinter dem man die Sterne erahnte, ein Muster intensiver Lichtpunkte. Ich zeigte auf irgendeinen davon und fragte mich, wie es sein mochte, darauf zuzufliegen und ihn langsam, langsam immer größer werden zu sehen.
»Wir würden fliegen und fliegen«, fuhr ich versonnen fort. »Wir würden älter werden, erwachsen. Wir würden heiraten und Kinder kriegen … und wenn unser Schiff ankommt, würden wir alte Leute sein.«
Phil krümmte den Rücken wie ein alter Mann, humpelte herum und hustete dabei. »Ja genau. Wir würden gerade noch aussteigen und uns umsehen. Dann würden wir sterben.« Damit ließ er den Kopf hängen und streckte die Zunge heraus.
Wir kicherten und dachten uns noch mehr solcher Geschichten aus. Je öfter wir das taten, desto klarer wurde uns, dass das Große Schiff einerseits wirklich riesig gewesen sein muss, zugleich aber schrecklich winzig, verglichen mit dem All, das es durchquert hat.
Wir diskutierten auch über die Meuterei, zu der es am Ende der Großen Reise gekommen war, obwohl wir darüber nicht viel wussten. Niemand schien gern über dieses Thema zu reden. Es war passiert, als das Ziel in Sicht gekommen war. Aber warum? Das konnte uns keiner sagen. Jeder erzählte einem dazu nur, dass wir alle Captain Hordack unser Leben verdankten, dem ersten Captain, der mitten in Aufruhr und Chaos seine Getreuen um sich geschart hat, um die Shuttles zu erobern. Damit hatten sie sich abgesetzt, während die Übrigen, die Verblendeten, in ihr Verderben flogen. Deswegen waren wir heute auch schlechter dran, als wir sein müssten, denn mit ihnen waren viele wichtige Dinge und Geräte verloren gegangen. Der Captain hatte nur das Nötigste retten können.
»Wieso haben die gemeutert?«, wunderte sich Phil. »Ich meine, die waren alle so lange unterwegs – die müssen doch froh gewesen sein, endlich anzukommen?«
Ich versuchte, mir das vorzustellen. »Vielleicht«, meinte ich, »hatten sie Angst. Wenn du so lange eingesperrt bist, wenn du in so einem Schiff aufgewachsen bist und gar nichts anderes kennst, dann kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, da rauszugehen.«
Unsere Gespräche blieben nicht unbemerkt. Andere gesellten sich zu uns, neugierig, was wir da redeten. Nicht alle verstanden uns. Manche hörten zwar zu, nannten uns aber trotzdem Spinner, vor allem mich. Chao sagte, sie fände es gar nicht schlecht, wenn mal wieder ein paar Leute auf eine Große Reise gingen. »Dann wär man sie für alle Zeiten los«, schloss sie, und es war klar, dass sie uns damit meinte.
Und schließlich kassierten wir einen richtigen Anschiss.
Eines Morgens, bevor der Unterricht begann, reckte sich Onkel Prabhu, strich sich den grauen Kinnbart glatt und sagte streng: »Mir ist zu Ohren gekommen, dass … gewisse Subjekte viel über die Große Reise sprechen, und zwar so, als sei sie ein großartiges Abenteuer gewesen. Das war sie nicht! Das möchte ich in aller Deutlichkeit feststellen. Die Große Reise war eine Prüfung. Diejenigen, die auf die Reise gegangen sind, haben enorme Entbehrungen auf sich genommen. Sie haben ein Opfer gebracht, dessen Bedeutung kaum zu ermessen ist, um uns, ihren Kindeskindern, ein Leben in dieser Welt der Hoffnung zu ermöglichen. Ja, die Große Reise war eine ernste Prüfung, und bei Weitem nicht alle haben sie bestanden.«
Er sah grimmig in die Runde, bis sein Blick schließlich auf mir zum Stillstand kam. »Ich wünsche künftig keinerlei Frivolitäten in dieser Richtung mehr.«
Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Doch das passierte nicht. Ich musste den Unterricht durchstehen, der kein Ende zu nehmen schien.
Zu meiner unendlichen Verblüffung kam hinterher ausgerechnet Majala zu mir und meinte, ich solle mir nichts draus machen. »Ich träume auch oft von der Großen Reise«, gestand sie flüsternd. »Ich fand die Geschichten, die Phil und du erzählt habt, wunderbar!«
Ich wusste erst gar nicht, was ich darauf sagen sollte, aber irgendwie kam es dann so, dass wir uns von da an zu dritt trafen. Irgendwo, wo wir für uns waren. Phil, ich und … Majala!
Einerseits war das sensationell, denn ich war immer noch in sie verliebt und genoss jeden Augenblick, den ich mit ihr verbringen durfte. Andererseits war es aber auch schrecklich, denn ich wusste ja, dass sie Nagendra liebte – ausgerechnet Nagendra! – und dass ich mir besser keine Hoffnungen machte.
Wäre Phil nicht dabei gewesen, hätte ich vielleicht trotzdem versucht, sie zu küssen oder wenigstens nach ihrer Hand zu greifen, selbst um den Preis, mich lächerlich zu machen. Aber wir waren nie allein, und die Gelegenheit ergab sich nie.
Ein Felsvorsprung hinter der Barriere, den man den Buckel nennt, wurde unser Lieblingsplatz. An dieser Stelle wird der Glisspfad breiter, und man sieht, wie er in die Weite übergeht. Hier draußen mäht niemand, und die Rentiere lässt man ohnehin nicht so nah ans Gliss, also konnten wir ungestört im meterhohen Braungras hocken und fantasieren, wie wir uns ein eigenes Weltraumschiff bauen würden, um damit zu anderen Welten aufzubrechen.
Wir hatten allerdings keine Vorstellung, wie wir unser Weltraumschiff antreiben sollten. Wie funktionierte ein Raketenmotor? Davon stand nichts in den Schulbüchern und in meinem Physikbuch nur wenig. Wir wussten lediglich, dass es im Weltraum genügte, einmal einen kräftigen Schubs zu kriegen, dann flog man immer weiter und weiter, so ähnlich wie auf dem Gliss.
»Schon klar«, maulte Phil. »Aber wie kriegt man den Schubs?«
Ich erzählte vom Raketenprinzip, wie es mir meine Großmutter erklärt hatte: dass man etwas von sich wegschleudern musste, um sich in die andere Richtung zu bewegen, und dass man sich umso schneller bewegte, je schwerer das war, was man wegschleuderte, oder je schneller man es wegschleuderte oder beides.
»Ja gut, aber man kann ja nicht beliebig viel Zeug mitnehmen«, meinte Majala. »Irgendwann hat man nichts mehr zum Wegschleudern, und dann?«
»Dann ist man verloren«, bestätigte ich und musste daran denken, wie sich meine arme Katze auf dem Gliss abgestrampelt hatte. Das erinnerte mich an Nagendra und wie er Majala geküsst hatte, und dann hatte ich keine Lust mehr, über Raketenmotoren nachzudenken.
Um das Thema zu wechseln, fragte ich: »Sag mal, das mit den Schwungrädern, mit denen man Strom speichert, wenn die Windräder zu viel produzieren – was ist denn da das Problem? Ich meine, das ist doch eigentlich elegant gelöst?«
Majala nickte. »Im Prinzip schon. Aber wenn man die Dinger nicht ständig antreibt, verlieren sie schrecklich schnell an Schwung.«
»Wieso?«, fragte Phil, der nie Angst hatte, eine zu dumme Frage zu stellen.
Majala breitete die Arme aus. »Die Schwungräder, das sind dicke Scheiben aus Stahl, ja? Ungefähr so groß und mächtig schwer. In der Mitte haben sie eine Achse, um die sie sich drehen, und die steckt in einem Kugellager. Und diese Kugellager taugen nichts.«
»Wieso nicht?«, fragte ich, um zu zeigen, dass ich genauso wenig Angst hatte, dumme Fragen zu stellen, wie Phil.
»Weil wir sie nicht besser herstellen können.« Sie ließ die Arme wieder sinken. »Mein Vater hat, als er an der Universität war, ein Kugellager gesehen, das noch aus einem der Shuttles stammt. Also, von der Erde. Er sagt, das war überhaupt kein Vergleich. Das war mindestens zehnmal besser als unsere.«
Ich zögerte, mit meiner genialen Idee herauszurücken. Aber dann sagte ich mir, dass dies vielleicht genau der richtige Moment war.
»Warum«, fragte ich langsam, »macht man die Lager nicht aus Gliss? Wenn das Schwungrad in Gliss stecken würde, würde es sich ewig weiterdrehen!«
Majala sah mich an wie eine Erscheinung. »He! Die Idee ist super! Warum ist darauf noch niemand gekommen?«
»Frag ich mich auch«, behauptete ich, weil ich ja mitgekriegt hatte, dass Bescheidenheit gut ankam.
»Komm!«, sagte Majala und stand auf. »Das erzählen wir gleich meinem Vater!«
Wir fanden Majalas Vater in seiner Werkstatt. Er ist ein hagerer Mann mit blasser Haut, langem grauem Haar, das er im Nacken zusammenbindet, und schmalen, stets ölverschmierten Fingern. Er stand über ein zerlegtes Gerät gebeugt, einen Schraubenzieher in der einen und eine Zange in der anderen Hand.
»Oh, Papa«, rief Majala aus, »sag bloß, die Pumpe ist schon wieder kaputt!«
»Nein«, brummte er, ohne aufzusehen. »Ich bastle nur so zum Spaß daran herum.«
»So ist er immer«, raunte Majala uns zu. Dann trat sie neben ihn und sah sich an, was er da genau machte.
»Sie verliert Wasser«, erklärte ihr Vater. »Kein Wunder, so alt, wie die Dichtungen sind. Wäre auch kein Problem, Wasser gibt’s ja genug im Loch. Aber irgendwie führt das auslaufende Wasser dazu, dass die Pumpe blockiert, und das ist schlecht.«
Sie stierten beide in das Innere des Geräts und schienen Phil und mich völlig vergessen zu haben. Ich begriff, dass dies die Pumpe war, die aus dem Loch all das Wasser holte, das wir in den Häusern verbrauchten.
»Das Lager wackelt«, hörte ich Majala sagen. »Kein Wunder, dass das Zahnrad verkantet.«
»Deswegen hab ich die Lasche da angesetzt«, erwiderte ihr Vater. »Um es stabil zu halten.«
»Hmm.«
Sie starrten noch eine Weile in das metallene Gehäuse, dann sagte Herr Winter: »Ihr seid aber nicht gekommen, um mir beim Arbeiten zuzusehen, oder?«
»Nein«, gab Majala zu. »Wir wollten dir von einer genialen Idee erzählen, die Ajit hatte.«
»Eine geniale Idee? Sag bloß.« Er drehte sich um und musterte mich. »Erzähl.«
Also vertraute ich ihm an, was ich mir ausgedacht hatte, mehr oder weniger genau so, wie ich es Majala und Phil erklärt hatte. Ich fand meine Idee immer noch ziemlich gut, aber seine Begeisterung hielt sich merkwürdig in Grenzen.
»Hmm«, brummte er. »Das müsste man ausprobieren. Bringt mir ein Stück Gliss, dann schauen wir, was sich damit machen lässt.« Er deutete in eine der dunklen Ecken seiner Werkstatt. »Nehmt euch an Werkzeug, was ihr braucht. Ich repariere solange die Pumpe. Die muss nämlich wieder laufen, ehe unser Reservoir leer ist.«
Wir folgten Majala, die hier zu Hause war und sich auskannte. Was würden wir brauchen? »Hammer und Meißel«, entschied sie. »Die Säge da. Den Bohrer. Eine Zange, unbedingt.«
So ging es eine ganze Weile. Wir packten alles in zwei Eimer, und als wir uns auf den Weg machten, kam es mir vor, als trügen wir die halbe Werkstatt davon.
»Haut kein Loch in den Pfad, hört ihr?«, rief uns Herr Winter nach. »Nicht dass die Glisser hängen bleiben. Nehmt lieber ein Stück vom Rand.«
»Papa!«, maulte Majala. »Wir sind doch nicht blöd.«
»Ich sag’s ja nur.«
Schwer bepackt, zuckelten wir die Straße hinab, zurück zur Barriere. Das war die beste Stelle, fanden wir, denn dahinter gab es eine Menge kleine Ausbuchtungen, wo es niemanden stören würde, wenn ein Brocken Gliss fehlte.
Wir einigten uns auf einen Fleck, dessen Ende ungefähr so groß war wie zwei Handflächen; das würde ein geeignetes Stück für erste Versuche abgeben. Majala kniete sich hin, setzte den Meißel an, holte mit dem Hammer aus und schlug kräftig zu.
Zong! Der Meißel rutschte ab, schoss quer über das Gliss davon und blieb am Fuß der gegenüberliegenden Böschung stecken.
»Puh!«, ächzte Majala erschrocken. »Wenn der in der Weite verschwunden wäre, hätte mir Vater aber was erzählt …« Sie tastete über das rauchige Grau des Gliss. »Hat nicht mal ’ne Kerbe gemacht.«
Ich sah mich beunruhigt um. »Wir müssen gut aufpassen. Stell dir vor, der Meißel umrundet die ganze Welt und kommt irgendwann, in zwei Fluten oder in zwanzig, auf der anderen Seite wieder an … Da trifft er womöglich in den Ostpfad, rammt einen Glisser oder verletzt jemanden …«
Wir sahen einander erschauernd an.
»Ich geh ihn mal holen«, sagte Majala schließlich und stand auf, um die Brücke zu überqueren.
Während sie den Meißel wieder einsammelte, versuchte Phil sich mit der Säge am Gliss. Aber er erreichte auch nichts. »Die rutscht ständig ab!«, klagte er, als sei ich dran schuld.
Wir probierten es lange, aber vergebens. Kein Werkzeug hatte irgendeine Wirkung auf das Gliss. Der Bohrer rutschte ab, egal, was man machte. Die Zange griff nicht. Die Säge versagte, der Meißel hinterließ nicht mal eine Schramme, und ein Schlag mit dem Hammer zertrümmerte nichts, vielmehr hüpfte der Hammerkopf zurück, als sei er aus Gummi.
»Die Idee, Lager aus Gliss zu machen, ist gut, aber alt«, erklärte uns Majalas Vater schmunzelnd, als wir schließlich geschlagen wieder in seine Werkstatt kamen, ohne das kleinste Stückchen Gliss. »Die ersten Siedler, unsere Vorfahren, waren völlig begeistert von dem Material. Sie träumten von Maschinen, die ewig laufen, ohne dass man sie schmieren muss, von Uhrwerken, die man nur einmal im Quart aufzuziehen braucht, und so weiter. Bis sie feststellten, dass es unmöglich ist, auch nur ein winziges Stück Gliss abzutrennen. Die Pfade sind, wie sie sind. Man kann sie nicht das kleinste bisschen ändern.«
Ich war schwer enttäuscht. »Ich wollte nur, dass wir bessere Stromspeicher haben«, sagte ich.
»Das wollen wir alle«, meinte Herr Winter.
»Meine Großmutter hat mal was von, ähm, Batterien erzählt«, fuhr ich fort, obwohl das nicht stimmte; ich hatte in ihrem Physikbuch davon gelesen. Doch dieses Buch war mein Geheimnis. »Könnte man nicht so etwas bauen?«
Majalas Vater schüttelte den Kopf. »Dazu fehlen uns die notwendigen Metalle. Das einzige, was wir reichlich haben, ist Eisen – zum Glück! Aber für eine Batterie bräuchte man Blei oder Lithium … Falls es das auf unserem Planeten gibt, haben wir es noch nicht gefunden.«
»Womöglich liegt unter dem Gliss welches«, überlegte Phil. »Aber dann kämen wir nicht ran.«
So endete mein Plan, berühmt zu werden, indem ich die Stromversorgung verbesserte.
Je besser meine Noten wurden, desto mehr piesackte mich Onkel Prabhu. Ständig ließ er mich vorrechnen, erklären, wiederholen. Passte ich mal nicht auf, weil ich Phil etwas zuflüstern musste – zack, schon bekam ich eine Sonderaufgabe.
Ich hatte immer mehr den Verdacht, dass er einfach nicht wollte, dass ich seinem Sohn Konkurrenz machte. Doch das spornte mich nur noch mehr an. Ich lernte, büffelte, übte.
Als der Tag kam, an dem die Noten bekannt gegeben wurden, sagte er jedoch: »Ajit – na also! Du kannst es, wenn du willst! Du bist zu den Prüfungen in Captainsruh zugelassen und angemeldet. Viel Glück!«