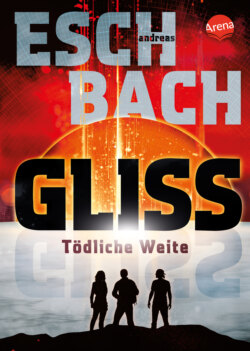Читать книгу Gliss. Tödliche Weite - Andreas Eschbach - Страница 7
Оглавление
Ich muss über Nagendra reden. Darüber, warum ich ihn nicht leiden kann und er mich auch nicht.
Alle denken, es liegt an mir. Denn er, er ist doch so ein netter Kerl!
Bloß weiß ich, dass er das nicht ist. Und ich schätze, weil ich das weiß, hasst er mich.
Als wir klein waren, war ich oft zum Spielen bei ihm. Anfangs war ich begeistert, denn Nagendra hatte die besten Spielsachen: einen Ball aus echtem Leder, Holzfiguren von unglaublichen Tieren der alten Welt – Elefanten, Giraffen, Dinosaurier –, dazu Bausteine aus Holz, genug, um ein ganzes Dorf zu bauen.
Bloß wollte Nagendra nie etwas bauen, er wollte immer nur Captain spielen. Und natürlich war er jedes Mal der Captain. Ich musste sein Adjutant sein, ihm etwas zu trinken bringen oder ihm Luft zufächeln, während er sich über Papiere auf dem Tisch beugte und Sachen sagte wie: »Es muss uns gelingen, die Meuterer zu stoppen, sonst verfehlen wir den Zielplaneten. Das wäre unser Untergang!« Daraufhin mussten wir irgendetwas machen, was ich nie richtig verstanden habe. Wir waren ja noch Kinder, und Nagendra war damals fast doppelt so alt wie ich; klar, dass ich mächtigen Respekt vor ihm hatte.
Wenn es ihm zu viel wurde, sich mit mir abzugeben, zwickte er mich, damit ich weinen musste, und sagte zu seiner Mutter: »Ich glaube, Ajit ist müde und möchte nach Hause gehen.«
Später hat er mir erklärt, warum ihn alle so toll finden: »Du musst jemandem nur das Gefühl geben, dass du ihn toll findest. Das ist der ganze Trick. Nimm Raùl. Der zieht mit den Rentieren über die Wiesen und klampft ihnen auf seiner Gitarre was vor. Aber die klatschen ja keinen Beifall, die gucken ihn nur doof an. Wenn ich komme und sage ›Bitte, Raùl, spiel was!‹, gefällt ihm das natürlich. Besonders wenn ich dann so tue, als hätte ich nie etwas Schöneres gehört. Das mach ich zwei, drei Mal, dann ist er überzeugt, dass ich ein prima Kerl bin.«
»Ehrlich?«, sagte ich. Seine Schlauheit beeindruckte mich – und widerte mich zugleich an.
»Frauen und Mädchen musst du einfach nur Komplimente machen«, fuhr er fort. »Je übertriebener, desto besser.«
Ich war nie dabei, wenn er Mädchen Komplimente machte, aber es entging mir nicht, dass er sie alle um den Finger wickelte. Auch, als eines Tages Majala und ihr Vater nach Letz kamen.
Sie stammten aus Zweiwasser im Ostarm, aus einer Gegend, die man die Getreidekammer nennt. Sie kamen, weil Majalas Vater Techniker ist und wir einen brauchten. Pedro, unser alter Techniker, war gestorben, und sie zogen in sein Haus, das letzte vor dem Grat, neben dem Haus der Witwe Guo.
Und sie kamen nur zu zweit, denn Majala, erfuhren wir, hatte keine Mutter mehr. Das beschäftigte uns alle mächtig, weil sich keiner vorstellen wollte, wie es wäre, keine Mutter mehr zu haben.
Majala gefiel mir auf den ersten Blick. Die anderen sahen in ihr in erster Linie ein tüchtiges Mädchen, das sich mit elektrischem Strom auskannte und Leitungen anschließen konnte. Aber ich mochte sie … nun, einfach so. Ich hätte sie am liebsten immerzu angeschaut, hätte gern einmal ihre Hand gehalten oder ihr Haar berührt.
Mit anderen Worten, ich hatte mich in sie verliebt. Ich war nur zu jung, um das zu verstehen, und zu scheu, um irgendetwas daraus zu machen. Im Gegenteil, ich behielt meine Gefühle für mich. Niemand sollte etwas davon merken, am allerwenigsten Majala selbst.
Doch dann ließ auch sie sich von Nagendra bezirzen. Das war ein schwerer Schlag.
Entscheidend aber war die Sache mit meiner Katze.
Großmutter hatte sie mir von einer Fahrt über Hope hinaus mitgebracht, von einem Besuch bei einer Freundin. Sie hat mir auch erzählt, warum man Katzen mit auf die Große Reise genommen hat. Es sind nämlich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Mäuse an Bord des Großen Schiffes gelangt, und man hat keinen anderen Weg gesehen, mit ihnen fertigzuwerden.
Meine Katze hieß Nova. Sie hatte schwarz-weiße Streifen und schlief bei mir im Bett. Von Devika ließ sie sich streicheln, mehr aber nicht, und Indira war noch zu klein und hatte Angst vor ihr – also war es meine Katze! Einmal verteidigte sie sogar mein Bett gegen meine Schwestern.
Nova fand nichts dabei, aus einem Fenster im Obergeschoss zu springen oder über Hausdächer zu wandern, aber vor dem Gliss hatte sie mächtige Angst – wie gesagt, sie war ganz und gar meine Katze. Ihr Fell sträubte sich, wenn sie auch nur in die Nähe des Gliss kam. Einmal versuchte ich, sie über die Brücke zu locken, doch sie machte nur einen Buckel und fauchte.
Eines Tages, als ich am offenen Fenster über meinen Schularbeiten saß, hörte ich Nova in der Ferne so jämmerlich maunzen wie noch nie. Ich rannte sofort hinaus, um nach ihr zu sehen – aber ich fand sie nicht! Ihre Schreie hallten zwischen den Häuserwänden, doch ich konnte nicht hören, woher sie kamen.
Hektisch raste ich die Straße auf und ab und malte mir dabei schreckliche Bilder aus, wie sie sich irgendwo verfangen hatte oder verletzt war.
Doch die Wahrheit war noch viel schrecklicher.
Irgendwann merkte ich, dass die Schreie aus Richtung der Barriere kamen, und lief dorthin. Unsere Barriere, muss man dazu erklären, ist leicht schräg gebaut. Dadurch kann man vom Ort aus nicht sehen, was sich in der äußersten Ecke auf der anderen Seite abspielt.
Genau in dieser Ecke fand ich Nagendra. Er hatte Nova auf das Gliss geschoben und lachte sich halb tot, wie sie sich abstrampelte und dabei in heller Panik kreischte, weil sie kein bisschen vom Fleck kam. Inzwischen klangen ihre Schreie gar nicht mehr nach ihr, und in ihren Augen schimmerte ein irrer Glanz.
»Was machst du da?«, schrie ich Nagendra an. »Was machst du mit meiner Katze?«
»Ich schau zu, wie sie verrückt wird!«, grölte er. »Ist das nicht lustig?«
Ich stieß ihn weg und holte Nova vom Gliss, aber sie war so außer sich, dass sie mir ihre Krallen in die Brust und den Hals schlug – die Narben sieht man heute noch. Vor Schreck ließ ich sie fallen, woraufhin sie davonraste wie der Blitz. Bevor ich mich auch nur umdrehen konnte, war sie im hohen Braungras verschwunden.
Ich habe sie nie wiedergesehen.
Deshalb verabscheue ich meinen Cousin.
Er hasst mich, weil er Angst hat, ich könnte ihn entlarven. Dabei wüsste ich gar nicht, wie. Niemand würde mir auch nur ein Wort glauben.
Schließlich brach der große Tag an. Phils Vater hatte den Gemeindesaal auf Hochglanz polieren müssen, Tante Disha hatte ihn eigenhändig dekoriert. Es würde ein Festessen geben, für das Raùl eins seiner Rentiere geschlachtet hatte. Meine Mutter backte Braunbeerenküchlein, eine Köstlichkeit, aber irre aufwendig.
Braunbeeren sind eigentlich orangefarben und wachsen überall wild. Sie sind die einzige Frucht, die auf diesem Planeten heimisch und für Menschen essbar ist, aber die Marmelade, die man daraus kocht, ist legendär zäh. Sie ist so klebrig, dass man Dachziegel damit ankleben könnte. Einen Spritzer Braunbeerenmus auf dem Hemd kriegt man nie mehr raus. Die Töpfe, Gläser und Löffel, die man beim Einkochen benutzt, muss man hinterher zehn Tage lang einweichen, ehe das Zeug wieder abgeht. Aber genau das macht Braunbeerenmus so köstlich: dass man den süßen, ganz eigenen Geschmack eine kleine Ewigkeit im Gaumen spürt.
Schließlich kam Nagendra an, kurz vor der Mittagszeit und mit einem gewöhnlichen Lastenglisser, der außer ihm noch fünfzehn Säcke Getreide, Schachteln mit Nägeln und Schrauben und andere Dinge anlieferte.
»Musste das sein?«, rügte ihn seine Mutter peinlich berührt. »Warum hast du keinen … besseren Glisser genommen?«
»Wenn ich meinen Abschluss habe, dann komme ich mit einem Luxusglisser, Mutter«, erwiderte Nagendra milde lächelnd. »Aber noch nicht jetzt, als gewöhnlicher Student.«
»Er ist so bescheiden«, hörte ich Phils Mutter zu ihrem Mann sagen. »Das bewundere ich an ihm.«
Alle, alle waren an der Anlegestelle, sogar ich. Und alle außer mir bekamen glänzende Augen, als Nagendra sie der Reihe nach mit seinem Charme einsülzte, ihnen Komplimente machte oder sie mit lockeren Witzen zum Lachen brachte.
Zu mir sagte er nur: »Na, Cousin? Keine neue Erfindung heute?«
»Du klingst ja richtig enttäuscht«, gab ich zurück.
Er lachte nur.
Wie groß er war! Er sah schon aus wie ein richtiger Mann; ich war fast erschrocken, als ich ihn aus dem Glisser steigen sah. Er und ich waren nur etwa hundertfünfzig Fluten auseinander: Wenn er nun so erwachsen wirkte, hieß das, dass auch meine Kindheit bald vorüber sein würde.
Die Sonnenscheibe stand tief am Horizont, weil die nächste Flutnacht nahte. Deswegen lag der untere Teil des Orts im Schatten, und wir mussten das Licht im Gemeindesaal anmachen. Bevor die Vorspeisen verteilt wurden, hielt Nagendra eine Rede, was alle enorm beeindruckte, denn so etwas kannte man nur von den Offizieren in der Hauptstadt und ähnlich wichtigen Leuten.
Nagendra erzählte von seinem Leben in Hope, wie viel er lernen musste und wie schwer die ersten Prüfungen gewesen waren. Er hatte sie natürlich trotzdem bestanden.
»Mit Auszeichnung!«, rief Tante Disha dazwischen.
»Ja schon, aber da war ich nicht der Einzige«, fuhr mein Cousin weiter fort, den Bescheidenen zu spielen. Nur um sich gleich darauf damit zu brüsten, dass er mit einigen seiner Professoren inzwischen auch privat verkehrte, dass er mehrmals im Haus des Zweiten Offiziers zu Gast gewesen war und sogar den Captain schon einmal getroffen und ihm die Hand geschüttelt hatte.
»Und er hat dich einen vielversprechenden jungen Mann genannt!«, unterbrach ihn seine Mutter wieder. »Das musst du nicht unterschlagen.«
»Also gut, ich unterschlage es nicht«, meinte Nagendra, und natürlich lachten alle.
Ich nicht. Aber ich hörte mir trotzdem an, was er erzählte, und mir wurde siedend heiß klar, dass ich viel zu lange so getan hatte, als gäbe es nur Letz und die nächsten beiden Orte – und als würde mein Leben für alle Zeit so weitergehen wie bisher. Doch das würde es nicht. Auch ich würde bald meinen Sechshunderter feiern, erwachsen sein und entscheiden müssen, was ich damit anfing.
Wobei die Antwort auf diese Frage ganz einfach war: Ich musste ebenfalls an die Universität gehen!
Ich betrachtete meinen so bestürzend erwachsen wirkenden Cousin und fragte mich, ob ich mich auch so verändert hatte, ohne es zu merken.
Im selben Moment flackerten die Lampen und erloschen.
»Oje«, hörte ich Phils Vater jammern. »Der Ofen! Wenn der jetzt kalt wird, fällt der Nachtisch in sich zusammen!«
Und Tante Disha schrie: »Cornelius! Was ist los?«
Cornelius Winter, das war Majalas Vater. Er sagte: »Ich habe so was befürchtet. Der Wind war die letzten Tage schwach. Heute gab’s richtige Aussetzer. Und die Küche braucht so viel Strom!«
»Aber wir haben doch die Schwungräder!«, wandte Nagendras Mutter ein. Sie klang panisch.
Zum Glück hatte ich diesmal nichts damit zu tun, ihr das Fest zu verderben.
»Die Schwungräder sind aber nur eine kleine Reserve«, meinte Herr Winter. »Ich nehme an, von denen haben wir schon seit Stunden gezehrt.«
Phil und ich sahen uns an. »Was für Schwungräder?«, fragte ich, aber er hob nur ratlos die Schultern.
Majala, die neben ihm saß, bekam es mit. Sie beugte sich zu uns herüber und erklärte leise: »Wenn die Windräder mehr Strom erzeugen, als wir brauchen, treiben wir damit drei Schwungräder an, um ihn zu speichern. Das sind die drei grauen Kästen oben am Grat. Wird der Wind zu schwach, treibt man mit den Schwungrädern einen Generator an, um den fehlenden Strom auszugleichen.«
»Und dadurch werden die Schwungräder wieder abgebremst«, sagte ich sofort, um ihr zu zeigen, dass ich keinesfalls schwer von Begriff war.
»Genau. Bloß werden die auch von selbst langsamer, das ist das Problem. Die letzten Tage war nicht genug Strom übrig, um sie anzutreiben, also stehen sie wahrscheinlich längst. Sonst wär das Licht nicht so plötzlich ausgegangen.«
Frau Taylor brachte Kerzen und verteilte sie auf den Tischen. Ihr Mann beriet sich mit jemandem, was sie machen konnten, um das Essen trotz des Stromausfalls warm zu servieren. Für Notfälle gab es einen Holzofen, aber nur einen kleinen. Holz war zu kostbar, um es einfach so zu verbrennen.
Ich war hin- und hergerissen. Einerseits empfand ich hämische Schadenfreude – andererseits hatte ich Hunger!
In diesem Moment hörten wir, wie das Kühlaggregat summend wieder ansprang. Gleich darauf kam das Licht zurück, und alle atmeten auf. Draußen quietschte ein Fensterladen, was er immer tat, wenn der Wind stark blies.
»Wir lassen die Kerzen trotzdem stehen«, entschied Tante Disha.
»Ich stell den Ofen eine Stufe runter«, meinte Phils Vater. »Das reicht allemal.«
Nagendra, der sich die ganze Zeit, in der es dunkel gewesen war, nicht gerührt hatte, sagte: »In Hope haben wir solche Probleme auch oft. Wir haben zwar wesentlich mehr Speicher und mehr Windräder, aber eben auch mehr Menschen, die Strom verbrauchen.«
»Es hat mit den Flutnächten zu tun, sagt man«, warf Belinda McGillis ein. »In den Tagen davor wird der Wind oft schwächer.«
Während alle anfingen, darüber zu diskutieren, ob das stimmte oder nur Einbildung war, fasste ich einen zweiten Entschluss: Ich wollte nicht nur studieren, ich wollte auch etwas erfinden, das von allgemeinem Nutzen sein würde – einen besseren Stromspeicher!
Ich hatte auch schon eine Idee.
Als es für Nagendra Zeit wurde, nach Hope zurückzufahren, wollte Tante Disha, dass wir ihn alle zur Anlegestelle begleiteten. Dazu hatte ich nun absolut keine Lust und stahl mich unter einem Vorwand davon. Es waren ja nur ein paar Schritte über die Straße zu uns nach Hause. Von dort spähte ich aus dem Fenster, um das Spektakel zu beobachten. Was ich besser gelassen hätte, denn so musste ich mit ansehen, wie Nagendra lange mit Majala redete – und sie schließlich küsste!
Der Schlag saß.
Doch er machte meinen Entschluss, an die Universität zu gehen, nur noch stärker.