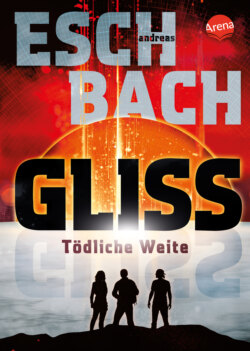Читать книгу Gliss. Tödliche Weite - Andreas Eschbach - Страница 6
Оглавление
Das Höllenloch, in dem mich Nagendra verschmachten lassen wollte, gibt es übrigens wirklich. Die meisten Leute halten es für ein Märchen, aber von meiner Großmutter weiß ich, dass es keins ist.
Und sie hat nie etwas gesagt, das nicht gestimmt hätte.
Im Grunde habe ich alles, was ich weiß, von ihr gelernt. Sie war die Einzige, die sich überhaupt mit mir abgegeben hat. Mein Vater arbeitet die ganze Zeit und ist jemand, dem man eh nichts recht machen kann. Bei meiner Mutter ist es ähnlich – kein Wunder bei vier Kindern und einem Haus. Außerdem hat sie ständig Streit mit ihrer Schwester.
Dass es das Höllenloch gibt, hat mit dem Gliss zu tun. Das Gliss bedeckt den größten Teil unserer Welt, und das Besondere ist, dass es völlig eben ist. Überall, an jeder Stelle, die wir kennen, ist es ganz genau gleich hoch. Deswegen ist es auch die Basis der Höhenmessung. Wenn wir zum Beispiel sagen, der Helle Brocken, der Berg hinter der Siedlung Steil, sei dreihundert Meter hoch, dann bedeutet das, dass seine höchste Erhebung dreihundert Meter über dem Gliss liegt.
Aber nun ist es so, dass unsere Welt der Sonne ja stets dieselbe Seite zuwendet. Die eine Hälfte des Planeten ist also immer beleuchtet, auf der anderen herrscht ewige Dunkelheit. Das Land, das wir bewohnen, liegt in dem schmalen Band dazwischen. Deswegen sehen wir die Sonne immer in derselben Richtung und nur die Hälfte von ihr, mal höher, mal niedriger über den Horizont ragend. Abgesehen von den Flutnächten natürlich, in denen sie ausnahmsweise ganz untergeht und es auch bei uns dunkel wird.
Das ist der größte Unterschied zur alten Welt, der Erde. Wenn die Überlieferungen stimmen, hat sich die Erde innerhalb von vierundzwanzig Stunden einmal um sich selbst gedreht, und man brauchte keine Abendglocke, um zu wissen, dass Nacht ist – man hat es gesehen, weil es einfach dunkel wurde.
»Daher stammen unsere Zeitbegriffe«, hat Großmutter mir einmal erklärt, als ich noch ziemlich klein war. »Die Drehung der Erde um sich selbst, das war ein Tag. Und der Umlauf der Erde um die Sonne, das war ein Jahr. Und ein Jahr hat 365 Tage gedauert.«
»Haben wir auch Jahre?«, fragte ich. Ich war damals nicht nur ziemlich klein, sondern auch noch ziemlich ahnungslos.
Sie wiegte den Kopf hin und her. »Wie man’s nimmt. Unser Planet umkreist unsere Sonne natürlich ebenfalls, aber nach den Zeitmaßen der Erde dauert ein Umlauf nur 9,9 Tage. Das ist zu kurz, um es ein Jahr zu nennen, findest du nicht?«
»Wie nennen wir es dann?«
»Na, überleg mal. Wenn du schlafen gehst, ziehst du den Vorhang vors Fenster, weil es draußen hell ist – außer in der Flutnacht. Und das ist immer die zehnte Nacht, nicht wahr?«
In meinem Kopf knisterte es, als ich anfing zu begreifen. »Eine Flut ist also ein Jahr bei uns?«
»Astronomisch gesehen, ja. Doch wenn wir den Begriff verwenden, meinen wir ein Erdjahr, das fast 37 Fluten entspräche. Eine unpraktische Zahl, finde ich.«
Ich dachte darüber nach. Ein bisschen rechnen konnte ich schon, aber mit 37 malnehmen oder durch 37 teilen, das konnte ich noch nicht. »Wie alt wäre ich denn in Erdjahren?«, fragte ich.
»Hmm«, meinte sie. »Du feierst bald deinen Dreihunderter, nicht wahr?«
»Ja«, sagte ich stolz. »In neunzehn Tagen.«
Sechshundert Fluten nach der Geburt feiert man die Mannbarkeit beziehungsweise bei Mädchen die Fraubarkeit, und dann ist man erwachsen. Die Hälfte davon wird auch gefeiert, bloß nicht so groß, und danach gilt man als halb erwachsen; man ist ein »Halber«, wie manche Leute sagen.
Großmutter zog ihr Notizbuch aus der Tasche und einen Stift und fing an zu rechnen. »Das bedeutet, seit deiner Geburt sind 297 Fluten gekommen. 297 mal 9,9, geteilt durch 365 …« Ihr Stift kratzte über das Papier. »Acht Jahre alt wärst du auf der Erde. Acht Jahre und ein bisschen.«
»Acht Jahre«, wiederholte ich.
Die Zahl kam mir seltsam vor. Das klang so alt! Über einen uralten Menschen sagte man, er lebe in seinem achten Quart.
»Was ist ein Quart eigentlich?«, fragte ich.
»Ein Quart ist ein Viertel von tausend Fluten«, erklärte Großmutter. »In Erdenzeit umgerechnet nicht ganz sieben Jahre.«
»Und du lebst in deinem neunten Quart? Wie alt wäre das in Erdjahren?«
Da tätschelte sie mir den Kopf und sagte: »Lass uns von etwas anderem reden.«
Auch ich wollte ja von etwas anderem reden, nämlich vom Höllenloch. Eigentlich, so hat es mir Großmutter bei einer anderen Gelegenheit erzählt, müssten auf unserem Planeten noch viel wildere Stürme toben, als wir sie erleben: Auf der Sonnenseite ist es ja immer schrecklich heiß und auf der Nachtseite dafür schrecklich kalt. Heiße Luft steigt nach oben, deswegen muss unten Luft nachströmen, und das kann nur kalte Luft von der Nachtseite sein. Doch auf der Sonnenseite wird es nicht ganz so heiß, wie es werden müsste, und auf der Nachtseite nicht ganz so kalt. Man vermutet, dass das am Gliss liegt. Auf alten Aufnahmen aus der Zeit, als sich das Große Schiff unserem Planeten genähert hat, sieht man, dass die gesamte Sonnenseite von Gliss bedeckt ist – damals wusste man natürlich noch nicht, womit man es zu tun hatte –, und es gibt Messungen, laut denen das Gliss an der Stelle, die der Sonne direkt zugewandt ist, tiefer liegt als anderswo.
»Und zwar wesentlich tiefer«, erklärte mir Großmutter. »Über hundert Meter. Das ist gravierend. Weißt du, wieso?«
Ich überlegte. »Weil man nicht mehr rauskäme?«
Sie lächelte dieses kleine, stolze Lächeln, das sie immer zeigte, wenn ich eine Antwort fand, die sie mir noch nicht zugetraut hätte. »So ist es. Stell dir vor, du rutschst über das Gliss, du rutschst und rutschst und wartest darauf, dass endlich wieder Land kommt – aber plötzlich gelangst du an eine Stelle, an der es abwärts geht! Du hast ja nichts, woran du dich festhalten kannst! Also gleitest du hinab und gerätst in eine Kreisbewegung, aus der du nie wieder herauskommst.« Um ihre Worte zu unterstreichen, malte sie mit der Hand Kreise in die Luft, viele Kreise, hörte gar nicht mehr auf. »Da saust du also herum und herum. Du kommst da nie wieder heraus, und du wirst auf dem Gliss auch niemals langsamer. Die Sonne steht über dir und brennt mit ihrer ganzen Kraft auf dich herunter, bis du vertrocknest!« Großmutter faltete die Hände. »Deshalb nennt man diese Stelle das Höllenloch.«
Als Großmutter in ihr zehntes Quart kam, starb sie.
Das war ein Schock. Klar, ich hatte gewusst, dass Menschen irgendwann sterben – aber doch nicht Großmutter Neelam! Doch nicht der einzige Mensch, der mich je ernst genommen hatte! Bei ihr hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass die Dinge, die ich mir ausdenke, einen Wert haben und nicht nur Spielerei sind oder, wie Vater es nennt, Spinnerei.
Sie war eines Tages krank geworden und hatte sich ins Bett gelegt. Belinda McGillis, unsere Medizinfrau, war gekommen und hatte ihr Säfte verordnet, und ich ging davon aus, dass Großmutter bald wieder gesund sein würde, wie immer.
Doch es kam anders. Ein paar Tage später ließ mich Großmutter zu sich rufen, schickte alle anderen hinaus, um mit mir allein zu reden. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie klein und grau im Gesicht in ihrem Bett lag, verschwitzt und mit einer Haut, die aussah wie dünnes Papier. Es roch seltsam in ihrer Kammer, und es war düster, weil der Nachtvorhang halb zugezogen war.
»Ajit«, flüsterte sie mit heiserer Stimme, »ich will dir etwas geben, aber das bleibt unser Geheimnis, ja?«
Ich nickte, worauf sie ein Buch hervorzog. »Das stammt noch von der Erde. Es ist eine Einführung in die Physik, vor allem in die Mechanik. Es hat meiner Urgroßmutter Purnima gehört, die auf dem Großen Schiff geboren wurde. Sie musste ihre Bücher hergeben, als die Universität gegründet wurde, doch das hier hat sie behalten.« Sie reichte es mir. »Es soll von nun an dir gehören.«
»Mir?« Ich nahm es, ziemlich verdattert. »Aber … brauchst du es denn nicht mehr?«
Sie lächelte wehmütig. »Nein, mein Kind. Ich brauche es nicht mehr.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. In meiner Verlegenheit schlug ich das Buch auf und blickte in das Gesicht eines streng dreinblickenden Mannes mit langen, wallenden Locken.
»Ah«, meinte Großmutter. »Sir Isaac Newton. Er hat vor über zweihundert Quart die Grundlagen der Mechanik geschaffen. Ohne ihn wären wir nicht hier.«
Zweihundert Quart! Diese Zahl verschlug mir den Atem.
Großmutter ergriff meine Hand, drückte sie schwach. »Lass es dir niemals wegnehmen, Ajit, hörst du? Versteck es. Lies darin. Versuch zu verstehen.« Sie keuchte. »Vor allem lass dir nicht einreden, dass Träume etwas Schlechtes sind. Du bist ein Träumer, das ist wahr, aber das bedeutet nur, dass du Fantasie hast. Und noch nie ist Großes ohne Fantasie entstanden. Auch die Große Reise war einst nur eine Fantasie.«
»Ja«, sagte ich und musste an meinen Vater denken, der mich wegen meiner Spinnerei, wie er es nannte, manchmal auf eine Weise ansah, dass ich das Gefühl hatte zu schrumpfen.
»Du musst lernen, deine Fantasie mit der Wirklichkeit zu verbinden, Ajit«, flüsterte Großmutter. »Dann wirst du Großes vollbringen, ganz bestimmt.«
Ich nickte. Bedrückt. Ohne zu wissen, warum. »Mach ich.«
»Gut.« Sie ließ meine Hand wieder los. »Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen schlafen.«
Ich verabschiedete mich und schob das Buch in mein Hemd. Später versteckte ich es in meinem Nachttisch unter den Schulsachen.
Am nächsten Morgen sagte uns Mutter, dass Großmutter gestorben sei, und ich sah Vater zum ersten Mal weinen.
Danach geriet ganz Letz in Aufruhr. Großmutter wurde in ein graues Tuch gewickelt, man hob droben auf dem Totenfeld eine Grube aus, und Onkel Prabhu, der in unserem Ort nicht nur der Lehrer, sondern auch der Prediger war, erzählte so einiges über Vergänglichkeit und Hoffnung. Dann legten sie Großmutter in das Loch und schütteten es zu. Ian McGillis, der als junger Mann im Steinbruch von Bleich gearbeitet hatte, schlug später eine Deckplatte mit einem vertieften Kreis und einem erhobenen Stern darin und ihrem Namen: Neelam Das, geb. Kramer.
All das durchlebte ich in einem Zustand äußerster Verstörung. Es kam mir vor wie ein böser Traum, aus dem ich einfach nicht aufwachte. Noch Fluten später brach ich in Tränen aus, wenn mich etwas an Großmutter denken ließ. Dass ich Großmutters Kammer bekam und mir nicht mehr ein Zimmer mit meinen beiden kleinen Schwestern teilen musste – Namrata war noch nicht geboren –, war nur ein schwacher Trost. Jeden Abend, wenn ich schlafen ging, dachte ich an unser letztes Gespräch und versuchte, ihren Rat zu befolgen. Zwar hielten mich immer noch alle für einen Spinner, aber ich gab nicht mehr viel darauf.
Und so ließ ich mich später auch nicht von der Idee abbringen, einen Glisser mit Propeller zu bauen. Ach, ich hätte Nagendra so gern gezeigt, wer von uns der schlauere Kopf war! Schade, dass es so in den Schlamm gegangen ist.
Nach Nagendras Abreise ging das Leben weiter wie zuvor. Ich hätte glatt vergessen können, dass es meinen Cousin überhaupt gab, wäre nicht seine Mutter ständig umhergewandert, um allen zu erzählen, wie prächtig sich Nagendra in Hope machte. Dass die Universität sich glücklich schätzte, einen derart begabten jungen Mann unter ihrem Dach zu haben, und so weiter und so fort. Bla, bla, bla.
Doch außer seiner Mutter redete bald niemand mehr von Nagendra. Auch ohne ihn wurde die Abendglocke geschlagen, wenn es Zeit war, schlafen zu gehen. Auch ohne ihn weckte uns die Morgenglocke. Und wir Kinder gingen zur Schule wie eh und je. Onkel Prabhu war unser Lehrer. Er unterrichtete uns im Gemeindesaal, die älteren Kinder vormittags, die jüngeren nachmittags, und mindestens einmal pro Flut schimpfte er über das schlechte Licht. Der Saal hatte nur schmale Fenster, und elektrische Lampen wurden nun mal dunkler, wenn der Wind, der die Windräder antrieb, nachließ.
Phil und ich saßen im Unterricht nebeneinander, ganz vorne, damit Onkel Prabhu uns im Auge behalten konnte. Majala und Sheena saßen hinten und hatten ständig was zu tuscheln. Chao Ma langweilte sich. Lylou Rojas lernte verbissen, hing an Onkel Prabhus Lippen und schrieb trotzdem schlechte Noten, weil sie vor jeder Prüfung viel zu nervös war.
Nachmittags mussten wir oft auf den Feldern rings um das sonnwärts der Siedlung gelegene Wasserloch mithelfen. Am Tag vor einer Flut steht das Wasser im Loch immer schon so hoch, dass es den flachen Rand bedeckt, und dann muss man die Kanäle sauber kratzen, die es auf die Felder leiten sollen. Dabei werden wir schrecklich staubig, deswegen dürfen wir hinterher ins Wasserloch springen. Natürlich nur unter der strengen Aufsicht der Erwachsenen, die darauf achten, dass die Jungs und die Mädchen auf getrennten Seiten bleiben und wir keinen Unfug anstellen. Viel zu früh scheuchen sie uns dann wieder raus, weil sie selbst ins Wasser wollen.
In der Flutnacht, der einzigen wirklichen Nacht, tritt das Wasser über den Rand und überschwemmt die Felder. Großmutter hat mir einmal erklärt, warum das so ist: Die Bahn, auf der unser Planet die Sonne umkreist, ist kein genauer Kreis. Er kommt ihr in der Flutnacht am nächsten, dabei quetscht sie ihn mit ihrer Schwerkraft ein bisschen – und deswegen läuft das Wasser aus den Wasserlöchern über.
In der Flutnacht ist der Himmel wirklich dunkel, alle schlafen besonders gut, und am nächsten Tag ist keine Schule, weil wir alle auf den schlammigen Feldern arbeiten. Wir graben Abflüsse auf, reparieren beschädigte Dämme und so weiter.
Es macht Spaß, durch den Schlamm zu waten, der bei jedem Schritt zwischen den Zehen hochquillt. Hinterher ist man total schmutzig, aber an ein Bad im Wasserloch ist nicht mehr zu denken: Das Wasser ist nach der Flut ganz trübe und aufgewühlt, außerdem sinkt der Wasserspiegel so schnell, dass man dabei zusehen kann. Es würde einen regelrecht hinabsaugen. Also reinigen wir uns an der Waschschüssel im Hof, und hinterher gibt es frische Kleidung.
Das ist unser Lebensrhythmus.
Die Felder sind rings um das Wasserloch angeordnet: Auf dem einen Feld wird gesät oder gepflanzt, auf dem daneben beginnt alles zu wachsen, auf dem nächsten wächst es schon höher, und das letzte Feld ist mehr oder weniger erntereif.
Jeder holt sich, was er braucht. Richtig geerntet wird nur, wenn eine Bestellung kommt, meistens aus Hope. Es gehört zu den Pflichten von Phils Vater als Dorfmeister, das Telefon zu beantworten, solche Bestellungen aufzunehmen und den Transport zu organisieren.
Das macht immer Spaß. Wir ernten, was bestellt wurde – Blaugurken etwa, Möhren, Sternkraut, Steinrüben, Frissa –, packen alles in Kisten und schaffen sie zur Anlegestelle. Währenddessen telefoniert Herr Taylor mit allen Dorfmeistern von hier bis Hope, wann der Glisspfad frei ist. Wenn das geregelt ist, geht es los. Wir legen ein Brett von der Barrikade aus schräg auf das Gliss und zielen – es muss genau auf Knick ausgerichtet sein, das am Horizont zu sehen ist. Dann klemmen wir es fest und setzen die erste Kiste drauf. Sie rutscht runter und gleitet schnurgerade über das Gliss, den ganzen Pfad entlang, immer weiter und weiter.
Die übrigen Kisten schicken wir sofort hinterher. Zack, zack, zack geht das!
In Knick schieben sie ein großes Rundholz raus, das die ankommenden Kisten in Richtung Sonnenblick umlenkt. Ich würde zu gern mal sehen, wie die Kisten die Keep überqueren, eine hinter der anderen – das muss lustig aussehen! In Felsbruch legen sie noch einmal ein Rundholz raus, ab da ist es dann ein gerader Weg bis Hope.
Sobald die letzte Kiste außer Sicht ist, warten wir gespannt auf den Anruf aus Hope, dass alles angekommen ist. Erst danach dürfen die Glisser wieder fahren.
Manchmal läuft es auch andersherum. Tante Disha hat beschlossen – wahrscheinlich weil sie ohne ihren Sohn nicht mehr ausgelastet war –, ihr Haus umbauen zu lassen. Die Steine dafür, die sie im Steinbruch von Steil bestellt hat, wurden auf dieselbe Weise geliefert. Wir standen alle an der Anlegestelle, als sie angesaust kamen, eine schier endlose Reihe, dicht an dicht. Blöderweise tobte gerade einer dieser Stürme, bei denen man das Gefühl hat, sie wehen allen Sand von der Nachtseite herüber. Aber das ist das Seltsame am Gliss: Der Wind geht irgendwie immer drüber weg. Die Steine ließen sich überhaupt nicht irritieren, blieben schnurgerade auf ihrer Linie.
Wir banden uns Tücher vor Mund und Nase, kniffen die Augen zusammen und klaubten die Steine auf, wie sie kamen. Zum Glück hatte jemand ein zusätzliches Brett vor die Barriere gelegt, sonst wären uns etliche in die Weite entwischt.
Die beiden Maurer, die Tante Disha bestellt hatte, kamen natürlich erst, als der Sturm vorbei war, mit einem dicken Glisser voller Werkzeug. Sie hatten fast zwei Wochen zu tun, ehe Tante Disha zufrieden war und sie wieder ziehen ließ.
Viele trauten sich auch ohne alles aufs Gliss. Wenn Phil von seiner Mutter auf die andere Seite des Pfads geschickt wurde, um Braunbeeren zu sammeln, war er oft zu faul, bis zur Brücke zu gehen; er sprang einfach mit dem Hosenboden aufs Gliss und rutschte ans andere Ufer hinüber, und das mit so viel Schwung, dass er drüben gleich wieder auf die Beine kam.
Oder der kleine Vincente Rojas, der mit einem Jungen in Dreibuchen befreundet war: Es gab zwar einen Fußweg dorthin, aber der war ihm zu lang, also hopste er von der Barrikade aufs Gliss und ließ sich einfach bis zur Anlegestelle tragen.
Die Allercoolste aber war Phils große Schwester Lynn. Ihr Verlobter lebte in Knick, und wenn sie ihn besuchen wollte, schwang sie sich einfach auf den Pfad und sauste über das Gliss davon, und weil es eine lange Strecke war, nahm sie meistens was zu lesen mit!
Ich konnte das alles kaum mit ansehen. Wenn Phil mit seinem Sammelkorb aufs Gliss hüpfte, stellten sich mir alle Haare am Körper auf, und wenn ich sah, wie Lynn, auf dem Rücken liegend und in ein Buch vertieft, durch die Enge bei Dreibuchen davonrutschte, musste ich wegschauen.
Ja, ich hatte Respekt vor dem Gliss. Nicht nur, weil mich Großmutter Neelam damals so erschreckt hatte. Aber irgendwie faszinierte mich das Gliss auch. Ich konnte endlos in die Weite hinausschauen, mich in ihrem geheimnisvollen Schimmer verlieren und mir ausmalen, wie es sein mochte, dort draußen unterwegs zu sein. Ich, der ich in meinem ganzen Leben gerade mal bis zum Markt von Sonnenblick gekommen war! Gerade weil ich das Gliss und sein physikalisches Rätsel nicht verstand, beschäftigte es mich und meine Fantasie.
Es war auch meine Fantasie, die mir half, das schrecklich öde Leben in Letz zu ertragen. Das und die Hoffnung, ich würde eines Tages etwas Unerhörtes entdecken oder eine aufsehenerregende Erfindung machen.
Das Leben ging also seinen gewohnten Gang – bis Tante Disha eines Tages mit seligem Lächeln verkündete, ihr Sohn, der unvergleichliche Nagendra, werde uns die Ehre eines Besuchs erweisen.