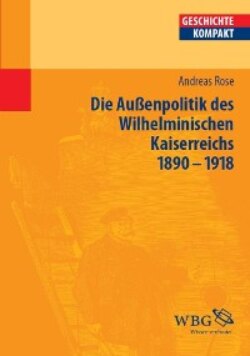Читать книгу Deutsche Außenpolitik des Wilhelminischen Kaiserreich 1890–1918 - Andreas Rose - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Staatskunst und/oder Kriegshandwerk?
ОглавлениеPolitischer oder militärischer Vorrang?
Neben dem in der politischen Praxis entscheidenden Verhältnis zwischen Monarch und Kanzler kennzeichnete das Kaiserreich zudem ein Dualismus zwischen politischer Leitung und militärischer Führung. Dabei hing die jeweilige Gewichtung in besonderem Maße von den verantwortlichen Persönlichkeiten ab. Zu bemerken ist deshalb der militärische Hintergrund politischer und diplomatischer Entscheidungsträger, denn nicht nur Caprivi war von Hause aus General. Auch eine ganze Reihe von Politikern und Diplomaten hatten eine Offizierslaufbahn vorzuweisen und dachten nicht selten in militärischen Kategorien. Der Botschafter in St. Petersburg bekleidete gleichzeitig sogar den Posten eines Militärbevollmächtigten. So existierte vielfach keine klare Trennungslinie zwischen zivilen und militärischen Fragen. Militärs dachten ebenso über politische Entscheidungen und Ziele nach, wie auch Diplomaten und Politiker Erwartungen militärischer Entscheidungen und Risiken in ihre Überlegungen mit einbezogen. Die Folge war eine gleich zweifache Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Zum einen entwickelte sich der Zweibund mit Österreich-Ungarn zunehmend zu einer alternativlosen, außenpolitisch wie militärisch wirkmächtigen Blockformation. Zum Zweiten war das außenpolitische Krisenverhalten und Krisenmanagement mehr und mehr von Maßnahmen direkter militärischer Vorbereitung, Mobilisierung und zusätzlichen Rüstungen begleitet gewesen. Gerade im Vorfeld des Ersten Weltkrieges wurde keine Krise lediglich am Verhandlungstisch gelöst, ohne gleichzeitig erfolgende militärische Drohgebärden, Rücksprachen mit der militärischen Kommandoebene oder möglichen Kriegsszenarien.
Für eine weitere Betonung des Militärischen sorgte der Kaiser nicht nur durch seine bekannte, öffentlich zur Schau gestellte und nicht selten kauzig wirkende Uniformverliebtheit, sondern insbesondere durch sein Verständnis als Oberbefehlshaber. Wilhelm II. achtete mit Nachdruck darauf, dass sich Politiker nicht in seine Kommandogewalt einmischten. Sowohl Militär als auch Marine besaßen daher ein Monopol, Kriegsszenarien an jeglicher politischer Einwirkung vorbei zu entwerfen. Politisch-militärische Überlagerungen in den Entscheidungsprozess waren deshalb unvermeidlich.
Staatskunst und Kriegshandwerk waren aber auch auf eine andere, geradezu philosophisch zu nennende Weise ineinander verwoben. Ohne eine verfassungsrechtliche Trennung standen sich insbesondere in außenpolitischen Fragen die militärischen Institutionen und die Wilhelmstraße, dem Sitz des Auswärtigen Amtes, wiederholt gegenüber. Jenseits institutioneller Konflikte und persönlicher Animositäten, die zu allen Zeiten in komplexen politischen Systemen anzutreffen sind, wurde die Frage nach dem rechten Verhältnis von Staatskunst und Kriegshandwerk im Kaiserreich nie beantwortet. Der Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz (1780–1831) hatte hierzu zwar eine klare Meinung geliefert, nämlich dass der Krieg letztlich ein politischer Akt sei und der Primat der Politik über der Kriegführung zu stehen habe. Der Krieg sei aber nicht nur ein Akt, sondern „ein wahres politisches Instrument, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs“. Die preußischen Militärs, allen voran Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke d.Ä. (1800–1891) schlossen daraus jedoch, nicht zuletzt auch um der eigenen Interessenwahrung willen, dass die Politik zwar den Kriegsbeginn und das Kriegsende bestimme. Im Krieg selbst aber habe ausschließlich die Strategie zu herrschen. Moltke bestritt damit ausdrücklich den Primat der politischen Führung. Für ihn bedeutete der Krieg, insbesondere nach den modernen technischen Entwicklungen und nationalistischen Stimmungen des 19. Jahrhunderts, Existenzkampf, der nur mit der Unterwerfung des Verlierers enden könne. Aus militärischer Sicht wünschenswert war die Hegemonie, die militärisch garantierte Überlegenheit oder anders ausgedrückt, die minimale Verletzbarkeit bei maximaler Verletzungsfähigkeit, nicht dagegen das diplomatische Wechselspiel des Gleichgewichts, des Interessenausgleichs und der Kompromisse. Das beschrieb den Hintergrund von Moltkes Auseinandersetzungen mit Bismarck während der Einigungskriege. Solange Bismarck Reichskanzler war, setzte er sich mit Deckung Wilhelms I. bei allen sachlichen Konfrontationen gegenüber Helmuth von Moltke durch.
Nach Bismarcks Entlassung kam es zunächst zu einer Bündelung der vollziehenden Gewalt. Zur Stärkung seiner Position ersetzte Wilhelm II. weitgehend eigenständige Persönlichkeiten durch ihm untertänig ergebene Männer. Dieser „Freundeskreis“ versuchte seinerseits, den keinesfalls unbegabten, aber unsteten und sprunghaften jungen Monarchen zu beeinflussen. Das führte insbesondere seit der Jahrhundertwende mit den zunehmend komplexer werdenden politischen Rahmenbedingungen zu immer problematischeren Beziehungsmustern. Diese endeten schließlich in einem „plutokratischen Chaos“, bei dem mehrere rivalisierende Machtzentren um den Kaiser, seine Berater, die jeweiligen Reichskanzler, das Auswärtige Amt, den Großen Generalstab und vor allem das Reichsmarineamt entstanden.
Die zunehmend ernster werdende außenpolitische Lage im Jahrzehnt vor dem Kriegsausbruch, die stetig steigende Verschuldung des Reiches, die wachsende Polarisierung der innenpolitischen Kräfte und die unversöhnliche Haltung gegenüber der Sozialdemokratie hätten es erfordert, die Macht auf eine breitere Basis zu stellen. Tatsächlich kam es, von einigen zaghaften Reformversuchen unter Theobald von Bethmann Hollweg abgesehen, zu einer „Militarisierung“ der kaiserlichen Umgebung wie auch der Außenpolitik. In der Julikrise schließlich, so wird noch zu sehen sein, dominierten ab einem gewissen Punkt nicht zuletzt vermeintliche militärische Sachzwänge den außenpolitischen Kurs.
Im Zweifel stand für Wilhelm II. fest, dass „im Krieg, die Politik den Mund zu halten“ habe. Unter seiner Regentschaft wurde die Außenpolitik zu einem ständigen Balanceakt zwischen den Forderungen der Armee- bzw. Marineführung und der jeweiligen politischen Führung um den Reichskanzler. Nur so konnte etwa der Schlieffen-Plan überhaupt die Bedeutung erlangen, die ihm in der Forschung gemeinhin zugesprochen wird. Für Bismarck wäre es geradezu undenkbar gewesen, sich von einem militärischen Plan politische Fesseln anlegen zu lassen. Für seine Nachfolger galt eben dies nicht mehr. Reichskanzler Bethmann Hollweg brachte es noch im Weltkrieg fertig, seinen Kritikern entgegenzuhalten, dass es sich ein militärischer Laie unmöglich anmaßen könne, militärische Möglichkeiten, geschweige denn militärische Maßnahmen zu beurteilen. Das bedeutete nichts anderes als die Abdankung der Politik, den Verzicht auf die politische Koordinationsaufgabe und die massive Einschränkung politischer Optionen. Im Ersten Weltkrieg wurde die Politik schließlich von der Obersten Heeresleitung (OHL), insbesondere der dritten OHL um Paul von Hindenburg (1847–1934) und Erich Ludendorff (1865–1937) nahezu vollständig marginalisiert.