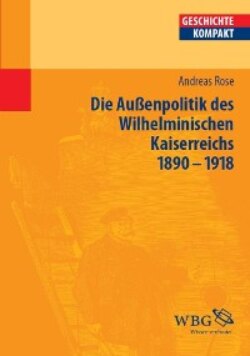Читать книгу Deutsche Außenpolitik des Wilhelminischen Kaiserreich 1890–1918 - Andreas Rose - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Q
ОглавлениеHeinrich von Treitschke in einer Vorlesung an der Berliner Universität 1890
Aus: Heinrich von Treitschke, Politik, Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Berlin, hrsg. von Max Cornelius, Bd. 1, 5. Aufl., Leipzig 1922, S. 42f.
Die Entwicklung unserer Staatengesellschaft geht […] unverkennbar darauf aus, die Staaten zweiten Ranges zurückzudrängen. […] Bei der Verteilung dieser nichteuropäischen Welt unter die europäischen Mächte ist Deutschland bisher immer zu kurz gekommen, und es handelt sich doch um unser Dasein als Großstaat bei der Frage, ob wir auch jenseits der Meere eine Macht werden können. Sonst eröffnet sich die gräßliche Aussicht, daß England und Rußland sich die Welt teilen, und da weiß man wirklich nicht, was unsittlicher und entsetzlicher ist, die russische Knute oder der englische Geldbeutel.
Das konnte, ja musste bedrohlich auf andere wirken, wenngleich solche Stimmen im internationalen Vergleich keineswegs unüblich waren. Auch französische, japanische, italienische, amerikanische und allen voran britische und russische Staatsmänner, Wissenschaftler und Publizisten sprachen selbstverständlich von ihrer nationalen Bestimmung, sich auszudehnen und die Welt an ihrem jeweiligen „Wesen genesen zu lassen“. Frankreich etwa betonte die Errungenschaften der Revolution, Russland den Panslawismus oder Großbritannien die puritanische Gesinnung.
„Germaniam esse delendam“
Im allgemeinen, international verbreiteten, sozialdarwinistischen Zeitverständnis schien die globale Mächtekonkurrenz unvermeidlich. Zur Jahrhundertwende sprach Max Weber von einem „unumgänglichen handelspolitischen Ausdehnungsbestreben aller bürgerlich organisierten Kulturvölker“. Der Imperialismus gehorche gar einem „Naturgesetz der Staatenwelt“ (1898). Auch das Ausland teilte diese Einschätzung. Die USA gingen zur Hochschutzzollpolitik über, während sie die europäischen Märkte mit ihren Produkten überschwemmten. Zwischen Deutschland und Russland kam es zum andauernden Zollkrieg. Ungeachtet dass die USA zur führenden Wirtschaftsmacht aufstiegen, nahm Großbritannien als alte „Werkbank der Welt“ aber vor allem den neuen Konkurrenzdruck aus Deutschland verstärkt wahr, der zu einem regelrechten Pressekrieg zwischen beiden Ländern führte. 1896 wurde von der Saturday Review sogar ein „Germaniam esse delendam“ gefordert und schließlich wurde das Label „Made in Germany“ eingeführt, um heimische Produkte zu schützen. In Deutschland glaubte die Publizistik deshalb, in England den wahren Feind ausgemacht zu haben, der den eigenen Aufstieg, wo es ging, behindere. Es waren nicht zuletzt ökonomische Gründe, die die europäischen Mächte an die Peripherie des Kontinents und in den Wettbewerb um Kolonien und Einflusssphären brachten. Rohstoffmangel sowie neue Absatzmärkte und gerade für Großbritannien neue Investitionsmöglichkeiten spielten eine ebenso große Rolle wie potentielle Siedlungsräume für die schnell wachsende Bevölkerung. Weitere wichtige Motive wie der Wunsch nach Missionierung und der Aufgabe der „Kulturarbeit“ gesellten sich hinzu und lieferten eine zusätzliche moralische Legitimation. Dass etwa im Zuge der Kolonialpolitik Bismarcks bereits sehr früh klar war, dass sich die deutschen Erwerbungen weder wirtschaftlich noch als Siedlungskolonien eigneten, aber dennoch daran festgehalten wurde, unterstreicht den ideologischen Charakter des Expansionsstrebens.
Als besonders bezeichnend für den deutschen Expansionismus wird für gewöhnlich das militärische Potenzial des Reiches angeführt. Gleichwohl führen die zumeist rein quantitativen Angaben zu Truppenstärken und Kriegsschifftonnage leicht in die Irre und verzerren mehr, als dass sie erhellen. Ein internationaler Vergleich der Truppenzahlen etwa belegt, dass sich die deutschen Rüstungen insgesamt voll im internationalen Rahmen bewegten.
Tabelle 4: Militärische Entwicklung Truppenzahlen (Heer und Flotte in Tsd.) im Verhältnis zur Bevölkerung
Tabelle 5: Militärausgaben im Verhältnis zum Nettoinlandsprodukt
Ausgerechnet zu Lande schien das vermeintlich so aggressive, gleichsam aber auch geopolitisch besonders verletzliche Kaiserreich sein Potenzial vor 1914 offenbar nicht auszuschöpfen.
Maßstab für die militärische Stärke eines Landes sind nicht allein die ökonomischen oder demographischen Wachstumsraten, sondern vielmehr das fiskalische Potential und die im politischen Prozess ausgehandelten relativen militärischen Ausgaben in Friedenszeiten. Ein genauerer Blick belegt, dass das Reich bei den relativen Ausgaben zumeist von Frankreich und Russland übertroffen wurde. Haupthindernis für größere Ausgaben und ein damit erhöhtes Sicherheitsempfinden war neben dem Budgetrecht des Reichstages (Art. 62) die föderale Struktur des Kaiserreiches. Das Reich blieb ein „Kostgänger“ seiner Einzelstaaten und von deren Matrikularbeiträgen abhängig. Hinzu kam, dass es anders als Großbritannien über keine feste Einnahmequelle aus Einkommenssteuern verfügte und auch nicht in dem Maße in der Lage war, wie Russland oder Frankreich große Anleihen auf dem internationalen Kapitalmarkt zu platzieren. Die wachsenden öffentlichen Ausgaben und der durchweg hohe Schuldendienst von durchschnittlich 60 % des Nettoinlandsproduktes musste anders als bei den zentralistisch organisierten Rivalen hauptsächlich über Konsumsteuern und Zölle bedient werden. Während das Machtpotenzial des Reiches auf diese Weise objektiv gebremst wurde, erhöhte sich das subjektiv empfundene Unsicherheitsgefühl. Den kostenintensiven internationalen Rüstungswettlauf konnte Deutschland deshalb nicht gewinnen. Aufgrund dieser strukturellen Gegebenheiten blieb es im Durchschnitt bei der in Artikel 60 der Verfassung erwähnten Friedenspräsenzstärke von ca. 1 % der Bevölkerung. Quantitativ blieb die kaiserliche Armee damit deutlich hinter Frankreich oder Russland zurück. Ob bei den Pro-Kopf-Ausgaben oder den Ausgaben im Vergleich zum Nationalprodukt, Deutschland stellte keine Ausnahme dar. Erst nachdem 1910 das Wettrüsten zu Wasser zugunsten Englands entschieden war, konzentrierte sich Berlin wieder auf die Heeresrüstung und versuchte Versäumnisse nachzuholen. Die reinen Zahlen verdecken jedoch, dass sich das deutsche Heer über den gesamten Zeitraum qualitativ von seinen Rivalen abhob. Neben der Friedenspräsenzstärke konnte das Reich Millionen von gut ausgebildeten Reservisten mobilisieren und ausrüsten. Die grundsätzlich bessere Ausbildung erlaubte es zudem, die Kräfte sofort an der Front einzusetzen. Frankreich und Russland, die beide über eine größere Friedensstärke verfügten, konnten das nicht. Der französische Generalstab traute seinen eigenen Rekruten nur wenig zu, und das Zarenreich besaß weder Waffen, Munition und Ausrüstung, um seine theoretisch millionenstarke Reservearmee auszustatten, geschweige denn, dass es über die Offiziere verfügte, diese zu führen. Da aber auch die Zeitgenossen nicht selten mit Zahlenwerken operierten, waren die realen Kräfteverhältnisse bis zum Krieg kaum abzuschätzen.
Ähnlich in die Irre führen die oft genutzten Tabellen zur Kriegstonnage als Indiz für die dynamisierende Wirkung des Flottenwettrüstens. Die quantitative Addition soll dabei die deutsche Gefährdung des englischen Zweimächtestandards belegen, der in vielen Darstellungen den Charakter eines geradezu natürlichen Normzustandes in den internationalen Kräfterelationen erhält. Tatsächlich haben jüngere Darstellungen jedoch belegen können, dass es sich bei dem „Two-Power-Standard“, nach dem die Royal Navy mindestens über die Stärke der beiden ihr nachfolgenden Seemächte verfügen sollte, viel mehr um ein propagandistisches Hilfsargument der Admiralität gegenüber der Öffentlichkeit und dem Parlament handelte, als um einen militärischen Richtwert. Ausgerechnet der englische Marineminister Lord Selborne (1859–1942) wie auch der erste Seelord John Arbuthnot Fisher (1841–1920) hielten Tonnageangaben gar für „völlig wertlose Parameter“ für die tatsächliche Stärke einer Flotte. Für viel wichtiger wurden hier Angaben zur gesamten Breite des Flottenbestandes, geostrategische sowie strukturelle Angaben zu Stützpunkten, Flottendistribution, Dockanlagen und Kapazitäten von Werftanlagen, Ausbildungsgrad von Mannschaften bzw. die Effizienz von einzelnen Schiffskategorien usw. erachtet. Überdies wurde beim Blick auf die deutsche Kriegsmarine zu lange von Bauprogrammen statt von tatsächlichen Bauten ausgegangen. So findet sich in zahlreichen Studien bis heute die Zahl von 26 Großkampfschiffen, obwohl die Kriegsmarine im Juli 1914 tatsächlich nur über die Hälfte, also 13 Schiffe dieser Art verfügte. Ein besonderes Augenmerk galt überdies nicht nur den Schlachtschiffen, sondern insbesondere den technischen Neuerungen wie Torpedo- und Unterseebooten. Gerade auch in diesen Bereichen war die deutsche Marine der Royal Navy weit unterlegen.
„Weiche Faktoren“
Neben den skizzierten ökonomischen und militärischen Leistungsparametern wirkte vor allem der schon angesprochene Zeitgeist auf die internationalen Beziehungen im Allgemeinen und die deutsche Außenpolitik im Besonderen. Dieser wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einem Bündel von Triebkräften getragen: erstens dem Sozialdarwinismus, Rassismus und Militarismus, zweitens dem mit dem Nationalismus untrennbar verbundenen Prestigedenken der Großmächte sowie drittens dem allgemein zu beobachtenden Raumdenken und Expansionsstreben. Dem Sozialdarwinismus begegnet man in dieser Epoche als ein „allgemeines Deutungsschema“, bei dem Charles Darwins (1809–1882) Evolutionstheorie von der Selektion und dem Kampf ums Dasein auf Individuen wie ganze Völker übertragen wurde. Um auch noch im 20. Jahrhundert zu den Weltmächten zu gehören, so die weitverbreitete Auffassung der Zeitgenossen und Entscheidungsträger aller Großmächte, müsse sich jede Nation mit einer „Politik der Stärke“ gegenüber den anderen behaupten. Konsens, Koexistenz, Stillstand würde danach einem machtpolitischen Untergang gleichkommen. „Weltmacht oder Untergang“ war das bipolare Interpretationsschema, mit dem sich die Ideologie des Sozialdarwinismus zusammenfassen ließe. Eng damit verbunden war der Glaube an die vermeintliche „Ungleichheit der Rassen“. Angelsachsen und germanische „Teutonen“ standen dabei den Slawen gegenüber. Die Romanen wurden dagegen aufgrund der sinkenden Geburtenzahlen als eine der „sterbenden Nationen“ wahrgenommen, während der hohe Geburtenüberschuss im Deutschen Reich als Vorbote zukünftiger Stärke zählte. Das zweite Grundelement des imperialistischen Zeitgeistes war das übersteigerte Prestigedenken, gepaart mit einem überschäumenden Nationalismus. Mit Argusaugen wachten die Großmächte und namentlich das Deutsche Reich darüber, von den anderen Großmächten auf Augenhöhe behandelt zu werden. Immer wieder kam es so zu übertriebenem und unnötigem Säbelgerassel und zu internationalen Verstimmungen wie beispielsweise in der Marokkofrage, in Südosteuropa oder bei Kompensations- oder Abrüstungsgesprächen. Als dritte Triebkraft sind um die Jahrhundertwende der Raumgedanke und das Expansionsstreben der Mächte anzuführen. Die Macht über große, zusammenhängende und abgeschlossene Räume wurde dabei von Geopolitikern wie Alfred Thayer Mahan (1840–1914), Halford J. Mackinder (1861–1947) oder Friedrich Ratzel (1844–1904) mit Ressourcenreichtum, Verteidigungsfähigkeit und militärischer Macht gleichgesetzt.
Innere Gemengelagen
Außer diesen staatenübergreifenden Triebkräften gab es zudem spezifische innenpolitische Gemengelagen, die das jeweilige Konkurrenzdenken und Expansionsstreben der einzelnen Großmächte förderten. Immer wieder kam es in den neuen Industriegesellschaften zu inneren Problemen, die diese nur allzu gern mithilfe ihrer äußeren Politik auszutarieren und abzulenken versuchten. Bernhard von Bülow beispielsweise erkannte in dem deutschen Verlangen nach einem „Platz an der Sonne“ z.B. ein geeignetes Mittel, um über innere gesellschaftliche Fragen etwa der Verfassung, des Wahlrechts, sozialpolitischer Reformen oder des demographischen Drucks hinwegzutäuschen und den Aufstieg der Sozialdemokratie zu stoppen. In England etwa wurde die militärische Abrüstung und die Wehrpflichtdebatte nach dem Burenkrieg nicht selten mit der Selbstbehauptung des Empire auch im 20. Jahrhundert verbunden, während Russland und Österreich-Ungarn ebenfalls ihre inneren Verfassungs- und Minderheitenprobleme mit äußerer Stärke zu kompensieren suchten. Insgesamt verbanden sich diese verschiedenen Bewegungsgesetze und Triebkräfte der Staatenwelt um 1900 zu einer allgemein verbreiteten „Weltreichslehre“. Diese Lehre wurde in Deutschland von einer breiten Publizistik sowie von Agitationsverbänden wie der Deutschen Kolonialgesellschaft, dem Alldeutschen Verband oder dem Flottenverein getragen. Darüber hinaus plädierten auch das Bildungsbürgertum und die Wissenschaft, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Max Weber, Heinrich von Treitschke, Hans Delbrück (1848–1929), Max Lenz (1850–1932), Erich Marcks (1861–1938) und viele andere für eine ambitionierte deutsche Weltpolitik. Sie alle erkannten in der Weltmachtpolitik nur die logische Fortsetzung der preußisch-deutschen Einigung. Weltmachtstreben, das gilt es zu betonen, war keine deutsche Spezialität, kein Teil eines „Sonderweges“. Dieses Streben unterschied sich nicht wesentlich von den Ambitionen anderer Mächte. Vielmehr hätte das Kaiserreich einen Sonderweg beschritten, wenn es sich aus dem imperialen Wettstreit der Jahrhundertwende herausgehalten hätte. Der neue Imperialismus war zweifellos ein globales Phänomen. Während die britische Weltpolitik in allen Teilen des Erdballs gewaltige Zuwächse erzielte, strebte Russland auf den Balkan, nach Zentralasien und Fernost. Frankreich stemmte sich gegen den eigenen Niedergang und versuchte, verlorenes Prestige in Europa in der Welt zurückzugewinnen. Japan stieß in die Pazifikregion und die USA reklamierten auf Basis der Monroe Doktrin (1823) die gesamte westliche Hemisphäre für sich. Selbst Italien versuchte, sich in Nordafrika schadlos zu halten. Die deutsche Weltpolitik, so scheint es, wird demgegenüber nicht deshalb besonders beachtet, weil sie exzeptionell aggressiv oder rücksichtslos war, sondern weil sie besonders spektakulär gescheitert ist. Die Beschäftigung mit ihr ist daher immer auch vorrangig eine Beschäftigung mit den Gründen des Scheiterns.
Will man das hegemoniale Potenzial des Reiches untersuchen, so gilt es die vorhandenen Fähigkeiten stets mit den inneren wie äußeren Möglichkeiten, Risiken und Wahlchancen in Relation zu setzen. Konkret: Welche Möglichkeiten besaß das Reich, anderen Mächten zu schaden, sie zu dominieren oder physisch wie politisch zu verletzen und wie verletzbar und widerstandsfähig empfand es und erwies es sich selbst gegenüber dem Druck von innen und außen?