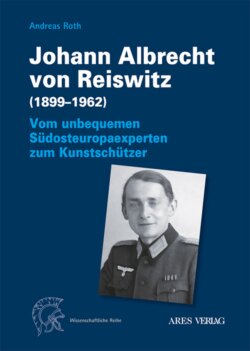Читать книгу Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962) - Andreas Roth - Страница 10
Aufbau der Arbeit
ОглавлениеDer Kunstschutz nimmt entsprechend der Schwerpunktsetzung den relativ breitesten Raum der Darstellung ein. Vier von insgesamt 63 Jahren des Lebens von Reiswitz beanspruchen darstellerisch rund zwei Fünftel des Textes. Doch Reiswitz legte schon im Anschluss an seine erste Jugoslawienreise 1924 konzeptionell den Grundstein für seine spätere Arbeit als Kunstschutzbeauftragter und arbeitete in gewisser Weise seither gezielt auf diese Beschäftigung hin.
Von daher wird die Zeit bis 1924 nur knapp referiert, unter besonderer Berücksichtigung von Reiswitz’ Sozialisation als Soldat und junger Intellektueller ohne parteipolitische Bindungen (Kapitel 1.1.). Die folgenden Kapitel (1.2.–2.1.) befassen sich mit der Ausformung seiner besonderen Zuneigung zu Südslawien, einer Leidenschaft, die, von einer persönlichen Liebesbeziehung ausgehend, zu einem wissenschaftlichen Programm wurde. Dieses Programm, das Reiswitz als seine drei „Einbruchstellen“ bezeichnete, wird in Kapitel 2.2. ausgefächert. Die beiden Folgekapitel (2.3.–3.1.) beinhalten eine vertiefte Untersuchung von Reiswitz’ Jugoslawienreisen in den Jahren 1928 und 1929, die seiner Suche nach wissenschaftlichen und politischen Ansprechpartnern dienten. Zudem widmete er sich ersten praktischen Umsetzungsversuchen seines an den drei „Einbruchstellen“ orientierten Programms einer deutsch-jugoslawischen Annäherung vermittels bilateralen Kulturaustausches. In Kapitel 3.2. wird am Beispiel der von Reiswitz unterstützten serbischen Gesellschaft zum Schutz der Altertümer ein exemplarischer Einblick gegeben in die potentielle Tragweite einer Implementierung seines Programms. Kapitel 3.3. und 3.4. dokumentieren im Kontext der multilateralen Kulturbeziehungen die von Reiswitz initiierten deutsch-jugoslawischen archäologischen Ausgrabungen am Ohridsee, die einerseits Ausfluss seiner persönlichen Forschungsinteressen waren, andererseits aber auch einen Schritt hin zum von Reiswitz erstrebten rapprochement der ehemaligen Kriegsgegner darstellten.
Die Kapitel 4.1–4.3. richten das Augenmerk auf Reiswitz’ akademischen Werdegang im nationalsozialistischen Deutschland und die damit verbundenen wissenschaftlichen, politischen und finanziellen Kalamitäten. Kapitel 4.4. widmet sich einem exemplarischen Exkurs, um am Beispiel seiner Beziehung zu dem Historiker Wilhelm Treue deutlich zu machen, mit welchen Strategien Reiswitz seiner politischen und akademischen Isolierung begegnete, aus der er durch seine Habilitationsschrift, deren Rezeption in Kapitel 4.5. thematisiert wird, auszubrechen versuchte. Nachdem Reiswitz durch die Publikation seiner Habilitationsschrift auf sich aufmerksam gemacht hatte, versuchte er dieses akademische Kapital in politisches umzumünzen, stets mit Blick auf die deutsch-jugoslawische Annäherung. Diesem Unterfangen ist Kapitel 5. gewidmet.
Insgesamt sind die ersten fünf Hauptkapitel dieser Arbeit von ihrer Grundstruktur her vornehmlich chronologisch ausgerichtet, obgleich die jeweilige thematische Schwerpunktsetzung es auch gelegentich erfordert, dass Rückblenden und zeitliche Vorgriffe erfolgen.
Kapitel 6.1.1. beschäftigt sich mit Reiswitz’ schwieriger Lage zu Beginn des Jahres 1941, als der Kriegsausbruch mit Jugoslawien zunächst sein bisheriges wissenschaftliches Lebenswerk zum Einsturz zu bringen drohte, ihm dann aber in nahezu paradoxer Weise gerade durch die Zerstörung Jugoslawiens die Möglichkeit eröffnet wurde, seine jahrelangen Planungen in die Tat umzusetzen.
Die Kunstschutzarbeit in Serbien selbst wird auf zwei Ebenen analysiert. Zunächst geht es in Kapitel 6.1.2. um die Hinüberrettung seiner persönlichen Netzwerkbildung in Jugoslawien aus dem Vorkriegsjahren in die bittere Realität eines militärischen Kunstschutzes in Restserbien unter deutscher Besatzung. In Kapitel 6.1.3. tritt das Programmatische anstelle des Persönlichen in den Vordergrund, indem Reiswitz’ Versuch der Umsetzung seines idiosynkratischen Denkmalschutzplanes dargestellt wird.
Das Kapitel 6.2. ist dem wissenschaftlich innovativsten, aber gleichzeitig auch politisch fragwürdigsten Teil der Arbeit von Reiswitz in Serbien gewidmet, der von ihm in die Wege geleiteten Zusammenarbeit mit der SS-Forschungsgemeinschaft „Das Ahnenerbe“. Das Zustandekommen dieser Allianz wird in Kapitel 6.2.1. beschrieben, in Kapitel 6.2.2. der politische Kontext erhellt und schließlich in Kapitel 6.2.3. die Spur des Ahnenerbe-Geldes verfolgt.
In Kapitel 6.3.1. geht es um das „Routinegeschäft“ des Kunstschutzes unter Reiswitz’ Führung, und in Kapitel 6.3.2. wird der über den reinen Kunstschutz sukzessive erweiterte Aufgabenbereich von Reiswitz eingeführt. Schließlich wird in Kapitel 6.3.3. die Abwicklung des Kunstschutzes erhellt und kurz auf die Nachkriegskarriere von Reiswitz eingegangen.