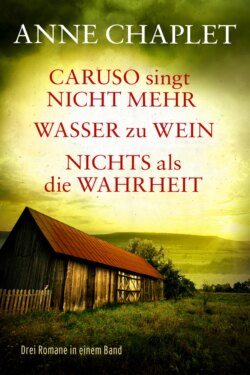Читать книгу Caruso singt nicht mehr / Wasser zu Wein / Nichts als die Wahrheit - Drei Romane in einem Band - Anne Chaplet - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAm nächsten Morgen quälte sich ein milchiges Licht durch die schon lange nicht mehr geputzten Fenster in Bremers Haus, der am Abend zuvor eine Flasche Rotwein auf die glückliche Fügung geleert hatte, daß das Wasser gerade rechtzeitig wieder gesunken war. Paul hatte die Augen geöffnet und gleich wieder zugemacht. Er wußte auch so, wie spät es war. Gegen sechs Uhr kam der Tankwagen von der Molkerei, um die Milch vom Hof der Nachbarn abzuholen. Der Fahrer ließ alle wissen, daß er eine leistungsstarke Autostereoanlage besaß, und scherzte meistens fast ebenso laut mit Marianne, Pauls schöner Nachbarin, die sich durch keine EG-Norm von ihren Milchkühen abbringen ließ. Jetzt konnte Paul noch eine knappe halbe Stunde weiterdösen, bis pünktlich um halb sieben Erwin mit seinem Morgenritual einsetzte. Das begann mit einem bellenden, röchelnd verebbenden Husten, gefolgt von schleimförderndem Räuspern und Ausspucken, gefolgt von heftigem Rütteln am ewig klemmenden Schacht des Zigarettenautomaten an der Straße. Man konnte sich auf seine Nachbarn verlassen. Danach dauerte es noch etwa dreißig Minuten, bis der Bäckerwagen laut hupend um die Ecke bog.
Auch Paul hatte seine Morgenrituale. Die erste Kanne Darjeeling nahm er im Bett zu sich, zusammen mit der Zeitung von gestern. Danach mußten Nachbars Katzen gefüttert werden, die ihn ungeduldig draußen vor der Haustür erwarteten. Die Katzenbelagerung begann meistens schon vor Tau und Tag, wie er feststellen konnte, wenn er in den frühen Morgenstunden vom Schlafzimmer im ersten Stock aufs Klo im Erdgeschoß mußte. Während er sich später in der Küche den Tee kochte, begann draußen das Geplärre. Und spätestens wenn er sich oben angezogen hatte und wieder die Treppe herunterkam, war auf dem Fußabtreter vor der Haustür die Hölle los.
Heute waren die Zwillinge, zwei schwarze, besonders gefräßige Brüder, die ersten. Sie warfen sich ihm entgegen, sobald er aufgeschlossen, die Klinke herabgedrückt und die Tür einen Spaltbreit geöffnet hatte. Auch der Graugetigerte und die Schwarzweiße strichen ihm um die Beine, während er in der Küche die erste Dose des Tages öffnete – obwohl keines der Tiere ins Haus durfte. Wenigstens, sagte Bremer sich und fixierte den Grauen strafend, guckten sie schuldbewußt dabei. Voller Gier scharten sich schließlich alle um die beiden Näpfe, die er ihnen gefüllt vor die Tür stellte, und versuchten, ihre dicken Köpfe möglichst gleichzeitig hineinzustecken. Die kleine schwarze Kätzin kriegte nur deshalb etwas ab, weil sie sich die Brocken mit der Pfote aus dem Freßgeschirr angelte und daneben, auf dem Boden, verspeiste. »Könnt ihr nicht mal manierlich essen?« brummelte Paul. »Immer muß man hinter euch aufwischen!«
Nachbars Katzen mußten zu Hause nicht hungern. Aber nur bei Bremer gab es etwas, wofür kein Bauer auch nur eine müde Mark ausgeben würde: Dosenfutter eben. Das war das elementare Katzenbedürfnis. Weshalb Bremer in Windeseile zum beliebtesten Dosenöffner des Dorfes aufgestiegen war. Im Gegenzug ließen sich die Tiere gnädig zum Schmusen herab. »Ihr alten Erpresser«, sagte Paul, der dem Grauen über die Nase strich und der Schwarzweißen, die gerade erst handzahm wurde, die andere Hand hinhielt. Zwei Blaumeisen hüpften laut schimpfend von Birke zu Birnbaum. Paul genoß beruhigt das Gefühl, daß die Welt wieder in Ordnung war.
Das gestern noch so totenstarre Dorf hatte sich aus seiner Verpuppung befreit und schüttelte die Schmetterlingsflügel. »Hast schon gehört?« rief ihm Marianne zu, die, wie jeden Morgen, die Gass’ fegte. Bis zu ihr hatte das Hochwasser es nicht gebracht, sie beseitigte nur die dicken Fladen, die ihre Kühe hinterlassen hatten auf dem Weg vom Stall auf die Wiese.
»Bast hat es mir gestern erzählt.« Paul stand ans Gartentörchen gelehnt und sah Wilhelm zu, dem Ortsvorsteher, der mit der Kehrmaschine die Dorfstraße heraufkam.
»Verdammte Rumänen!« sagte Marianne mit Überzeugung. Seit es um Klein-Roda herum einmal eine wilde Verfolgungsjagd gegeben hatte, lebte Marianne in der beruhigenden Gewißheit, daß die Schuldfrage ein für allemal geklärt war. Eine rumänische Bande hatte damals die Gegend unsicher gemacht, sie war auf das Knacken von Geldsafes und Tresoren spezialisiert. Nach einem Überfall auf das Postamt von Engelen hatten sich die Banditen erst im Wald versteckt und dann versucht, mit rauchenden Reifen zu fliehen. Seither gab es bei der Polizei eine »Arbeitsgruppe Moldau«.
»Ach, Marianne, komm«, winkte Paul ab. »Die halten sich doch nicht mit Brandstiften und Pferdeschlitzen auf!«
»Weiß man’s?« Marianne schob resolut einen Kuhfladen auf die Schippe.
»Das Asylantenpack! Alle abschieben!« Vom Zigarettenautomaten her hörte Paul die heisere Stimme vom alten Alfred, genannt »das Ekel Alfred«. Der Mann schlug seine Frau, wenn er gesoffen hatte, wie jeder im Dorf sah und hörte. Er war ein Querulant, ein Störenfried: Den Bauern Knöß hatte er angezeigt, weil der nachts und illegal Gülle in der naturgeschützten Flußaue abgeladen habe. (»Das würde Bauer Knöß natürlich niemals tun«, hatte Paul gespöttelt, als sich alle über Alfred aufgeregt hatten.) Und die Kinder von Karlheinz und Lieselotte Becker, Kevin und Carmen, hatte er in einem Brief an den Bürgermeister beschuldigt, am Hochwasser schuld zu sein, weil sie Steine in eins der drei Flüßchen geworfen hätten. Kevin und Carmen mochten an vielem schuld sein, daran aber gewiß nicht.
Eigentlich mochte ihn niemand. Und dennoch, stellte Paul mit einem Anflug von Neid fest, gehörte er zum Dorf. Unauflöslich. Bei Alfred waren es nicht die Rumänen, sondern die Asylanten, die an allem schuld waren. Insbesondere die koreanische Familie, die jenseits der Flußaue in einem alten, heruntergekommenen Dreiseitenhof lebte, dessen eine Seite unlängst in Flammen aufgegangen war. In diesem Fall waren die Täter bald und eindeutig identifiziert: Die älteren der sechs Kinder hatten in der Scheune gekokelt. Was lag näher, als die Kinder auch anderer Taten zu verdächtigen?
Erwin war bei der schätzungsweise vierten Zigarette heute morgen angekommen, das Husten und Röcheln klang merklich gedämpfter. Auch er stand am Zaun, einem »Rancher-Zaun«, wie er Paul mal erklärt hatte, den er in liebevoller Eigenarbeit um sein schmales Fachwerkhäuschen und das peinlichst gepflegte Rasengrundstück gezogen hatte, beides gegenüber Bremers Haus, auf der anderen Seite der Dorfstraße gelegen.
Ein knappes »Gude!« war der einzige Gruß, den er um diese frühe Morgenstunde, noch völlig nüchtern, fertigbrachte. »Ei, Erwin«, rief Marianne zu ihm hinüber, »hast schon gehört?« Erwin räusperte sich und spuckte. »Hör mir uff«, sagte er kopfschüttelnd, »hör mir bloß uff.«
Paul winkte der alten Martha zu, die auf ihrem auch schon sehr antiken Fahrrad vorbeiradelte, die schlohweiße Mähne im Wind. »Kerle! Daß ich das noch erleben muß!« rief sie kopfschüttelnd der Straßenversammlung zu und entschwand um die Ecke. »Soll sie froh sein«, kommentierte Gottfried, der seinen betagten Jagdhund Fritz zum Morgenspaziergang ausführte. »Sie wird bald achtzig.« Das hätte bei jedem anderen herzlos geklungen. Bei Gottfried nicht.
Paul merkte plötzlich, wie ihm die Kehle eng wurde. Der Friede täuschte. Nichts war in Ordnung. Das jährliche Hochwasser war man gewöhnt, das steckte man weg wie nix; das fiel alles unter Naturgewalten; Schicksal; Gottes unergründbarer Ratschluß. Aber die Pferdemörder und Brandstifter, die waren nicht gottgesandt: Sie waren die Urschurken des Landlebens. Sie legten ihre Hand nicht nur an die Fundamente bäuerlicher Existenz, sondern erschütterten auch den Seelenfrieden der ländlichen Gemeinde: durch den ständigen, den allgegenwärtigen Verdacht. Bremer spürte fast am eigenen Körper, wie sich Angst in die Selbstverständlichkeit einmischte, mit der jeder seiner Tätigkeit nachging.
Auch Marianne mußte etwas gespürt haben. Sie lehnte sich auf ihren Besen und sah ihn prüfend an. »Heute schon radeln gewesen?« Paul lächelte dankbar zurück. »Du meinst, das empfiehlt sich, oder?«
Marianne nickte. »Dringend, würde ich sagen.«
»Alte Klatschbase«, dachte er liebevoll, während er ins Haus ging, sich umziehen. Ihr hatte er unvorsichtigerweise im letzten Frühjahr anvertraut, was ihn täglich aufs Rennrad trieb. Seither wußte es jeder. »Er muß einfach fahrradfahren«, hatte er sie mit verschwörerischer Stimme zu Gottfried sagen hören. »Es ist, hat er gesagt, wie ein ... wie ein ...«
»Zwang«, hatte Paul für sich ergänzt, bei dessen Anblick sie schuldbewußt zusammengezuckt war. Und das war die reine Wahrheit: Er fuhr geradezu zwanghaft Fahrrad, seit er vor fünf Jahren hierhergezogen war, nach Klein-Roda, in das, was auch er ein gottverlassenes Kaff genannt hatte. Wegen der Kondition, gegen das Älterwerden, weil der Arzt es empfohlen hat? Das würde jeder hier verstehen. Aber aus »Selbstvergewisserung«? Marianne hatte ihn damals zweifelnd angeschaut. »Ich muß gucken, ob noch alles da ist«, war sein zweiter Versuch. Das leuchtete ihr seltsamerweise schon eher ein. Vielleicht, weil auch sie ihn, wie alle hier, für einen mehr oder weniger netten Spinner hielt.
In Wirklichkeit war mittlerweile er es, den jeder im Umkreis von zwanzig Kilometern vermißt hätte, wenn er einmal länger ausgeblieben wäre. Der drahtige Mann mit der grauen Bürstenfrisur, dem schnellen Rad und den muskulösen Beinen war eine den Hausfrauen, Treckerfahrern, Postboten und Warenauslieferern vertraute Erscheinung. Er grüßte alle. Ihn grüßten alle. »Der tägliche Beweis, daß es mich gibt«, hatte Bremer gesagt. Daraufhin hatte Marianne mitleidig geguckt.
Paul stieg in die Fahrradklamotten und holte sein Rennrad aus dem Schuppen. Radfahren war die beste Therapie – gegen Melancholie, Lebensüberdruß, Existenzangst und Übergewicht. Morgens, im ersten, zögernden Sonnenlicht, auf seiner Lieblingsstrecke, die ihn einen steilen Anstieg über einen Bergrücken Richtung Streitbach führte, wehte ihn regelmäßig eine leise Ahnung von dem an, was andere wohl Heimatgefühl genannt hätten. Die rötlich angestrahlten Wolkenschleier, die sich frühmorgens über die Talsenken legten, von denen sie sich schon gegen neun Uhr wieder erhoben, um sich aufzulösen im blauesten Himmel von ganz Hessen, kamen ihm überirdisch schön vor, und die Wälder, die über Paul den Tau der Nacht von ihren Blättern schüttelten, strahlten ihn in den leuchtendsten Farben an, die Gott erschaffen hatte.
Kürzlich war er im Morgenlicht an der Kramerschen Pferdekoppel entlanggefahren, als plötzlich die ganze Herde mit fliegenden Mähnen am Gatter entlanggaloppierte, ihn begleitete auf seinem eigenen Ritt, bis die falben, roten, grauweißen, schwarzglänzenden Körper wie eine Rauchwolke abdrehten und am Horizont verschwanden. Für solche Momente kloppte er Tag für Tag seine dreißig, vierzig Kilometer herunter, für den Anblick des Graureihers über der Flußaue und des Bussardpärchens auf der Koppel, die er dort schon seit Tagen gravitätisch herumschreiten sah, immer zu zweit. Für den Anblick der windgebeugten Apfelbäume an der Straße nach Waldburg, deren rote Früchte in diesem Jahr besonders stark zu leuchten schienen. Für den Duft: Gras, Kuh, Asphalt, Heu, Gülle, Diesel, Pferd, sonnenerwärmte Luft.
Als er heute, hinter dem Friedhof von Streitbach, die Straße nach Rottbergen hochgefahren war, eine kurze, harte Steigung hinauf, einer berauschenden Aussicht auf gleich sieben Windräder am Horizont entgegen, als sein Atem schneller ging, als sich ein fast beseligtes Lächeln auf seinem Gesicht zeigte – da spätestens machte sie sich wieder bemerkbar, diese beruhigende Leere in seinem Kopf. In diesem Zustand mußte er nicht mehr grübeln. Über die Vergangenheit. Über die Zukunft. Über eine gescheiterte Ehe. Über seine gescheiterte Existenz.
Was soll sein, Bremer? sagte er sich in solchen Momenten. Das Leben ist gut. Hart, aber ungerecht. Und voller Überraschungen.
Bremer fuhr dampfend in Klein-Roda ein und stellte sein Rad in den Schuppen. Auf der Straße klappte eine Autotür, die Falle am Gartentörchen klickte, und Ernst, der Postbote, hielt am langgestreckten Arm Pauls Zeitungen und die Post, so als wolle er mit solcherlei dorfunüblichen Druckerzeugnissen wie der FAZ und dem Manufactum-Katalog möglichst wenig in Berührung kommen.
»Der alte Noth ist tot«, rief er im Gehen Paul zu, kurz bevor er durchs Törchen verschwand, das er wieder, wie eigentlich immer, sperrangelweit offengelassen hatte – extra für Bello, nahm Paul mittlerweile an, den Riesenbernhardiner mit der Riesenneugier und dem Hang zu Riesenscheißhaufen, die er mit Vorliebe in Pauls Garten zu hinterlassen pflegte.
In diesem Moment öffnete sich im Nachbarhaus knarrend ein Fenster und auch Marianne rief: »Hast du schon gehört? Der alte Noth ist gestorben, irgendwann heute nacht.«
Als Paul, mit zwei Mark fünfzig und einem gebrauchten Eierkarton in der Hand, zu Gottfried rüberschlenderte, rief er schon von weitem: »Der alte Noth ist tot.« Aber Gottfried wußte das natürlich längst.
Paul kannte den alten Noth nur als alten Noth – als uraltes Männchen mit eingefallenem Mund über einem zahnlosen Gaumen, das morgens und abends gebeugt über die Dorfstraße schlurfte. Die abgewetzte Kordhose, die an dunkelroten, ausgeleierten Hosenträgern um die ausgemergelte Gestalt schlotterte, war verschmutzt, zerrissen und hing im Hosenboden auf eine Weise herunter, die den Verdacht erhärtete, der jedem kam, dem der alte Mann vor die Nase geriet. Der alte Noth pflegte sich offenkundig vollzuscheißen und sich in diesem Zustand völlig wohl zu fühlen – selbst dann, wenn die Masse erkaltet und steif geworden war und ihn zu einem verräterischen Watschelgang zwang.
An Bremer hatte er einen Narren gefressen – vielmehr an dessen Garten, aus dem der alte Mann mit kindlicher Freude zu klauen pflegte, was gerade besonders schön blühte. Die Familie, fand Paul, kümmerte sich nicht genug um den alten Knacker. Und wo blieb eigentlich die Gemeindeschwester, um dem Kerl wenigstens mal den Hintern zu putzen?
Aber nun war er tot – und Zeit war’s. Das fanden alle hier, vorab Marianne, die lauthals auf Söhne und Enkel des Veteranen schimpfte, die es fertiggebracht hätten, den alten Zausel völlig verkommen zu lassen. »Ich möcht nicht wissen, wie das bei denen zu Hause aussieht, seit die Berta nicht mehr da ist.«
Seit die einzige Frau im Hause, die Schwiegertochter vom alten Noth, oben auf dem Friedhof lag, schienen sich die Männer aufs gemächliche Verkommen eingestellt zu haben.
»Die lassen doch niemanden rein«, ergänzte Gottfried, vor dessen Hoftor, unter der schönen großen Linde, unter der die Feierabendbank nicht fehlte, sich alle einzufinden pflegten, wenn es was zu besprechen gab. Hier war sozusagen der informelle Thing-Platz der Gemeinde. »Die sind doch völlig verhockt.«
Seit dem Tod der Berta konnte man dem Untergang der Familie Noth zusehen. Der »Oppa« schlurfte übelriechend und unrasiert durch die Gegend, der »Vatta« fuhr jeden Tag, morgens und abends, mit einem klapprigen alten Fahrrad zum Friedhof hoch und ließ seiner Frau nach ihrem Tod eine Anteilnahme zukommen, die sie sich im Leben nicht hätte träumen lassen. Der dickliche Jüngste war etwas beschränkt, aber es reichte zu Hilfsarbeiten im Sägewerk. Und der Älteste war ein verkniffener Typ mit Wieselgesicht, wie Paul fand, der den Burschen haßte. Der Knabe fuhr nicht nur die paar Meter zum Zigarettenautomaten mit dem Auto und ließ seine Rostlaube fröhlich weiterdieseln, während er den Zigarettenautomaten mißhandelte, sondern warf auch noch regelmäßig den Zellophanüberzug der Kippenschachtel, die er unter Fluchen, Rütteln und Klopfen dem Apparat abgezwungen hatte, in Pauls Vorgarten. Bremer fischte wöchentlich zehn bis zwölf dieser widerlichen Überzieher aus seinen Rosen. Zu seinem Leidwesen hielten alle ortsansässigen Raucher seinen Garten für eine besonders formschöne Zellophanhüllendeponie.
»Vielleicht hätte man rechtzeitig etwas unternehmen müssen«, meinte Marie, die gutherzige Frau von Gottfried. Ortsvorsteher Wilhelm widersprach. »Da kannst du gar nichts machen, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und my home is my castle. Die haben noch nicht einmal die Gemeindeschwester reingelassen.«
Paul streichelte den Alten Fritz, Gottfrieds Jagdhund – »ein reinrassiger Weimaraner«, wie Gottfried gern betonte –, der seinen schönen samtgrauen Kopf auf Pauls Knie gelegt hatte und ergeben zu ihm hoch schaute. Von wegen dörfliche Gemeinschaft, nachbarschaftliche Solidarität und was die Städter noch so alles hineinphantasieren in die angeblich heile Welt auf dem Dorf, dachte er. Soziale Kontrolle verhindert höchstens das Allerschlimmste. Und das auch nicht immer.
Die Verunsicherung war mit Händen zu greifen. Daß der alte Noth, wie Wilhelm erzählte, halbnackt und auf dem Boden liegend gefunden worden war, ganz kalt und steif schon, war seinen Nachbarn nur ein vorerst letzter Beweis für den Zerfall aller Werte, die man hier hochhielt. Irgend etwas lief schief. Aber was?
Paul dankte Gottfried für die zehn Eier – Zwerghuhneier, aber von garantiert glücklichen Tieren – und ging nach Hause. Erst ein bißchen Holz hacken. Das lenkte ab. Und dann gab es keinen Grund mehr, sich länger vor der Arbeit zu drücken.
»Was würde über den heutigen Tag in meinem Tagebuch stehen?« dachte Bremer, der aus guten Gründen keines schrieb, wenige Stunden später. »Katzen gefüttert. Rad gefahren. Depression gekriegt.« Er spürte, wie ihn die Stimmung im Dorf einzufangen begann. Wie das Wetter: tief gehängtes Grau, düster. Mißtrauen hatte sich über alles gelegt, durchdringend wie der Schweinegestank, der aus dem Stall von Bauer Knöß herüberwehte. Selbst die Alltagsgeräusche – und das Landleben ist laut! – kamen Bremer heute merkwürdig gedämpft vor. Normalerweise dröhnten hier die Trecker, jaulten die Hunde, röchelten die Hähne. Ständig rief jemand: nach Kevin und Carmen, die auf nichts und niemanden hörten. Nach dem Riesenbernhardiner Bello, für den das ebenfalls galt.
Wenigstens das in Pauls Ohren schönste Geräusch unter all den vielfältigen Landlauten näherte sich auch heute wieder vom Friedhof her. Es klang wie das vielstimmige Knacken dünner, dürrer, trockener Hölzer, begleitet von sattem Klatschen, wie der müde Beifall nach einer Festansprache, und von einem unnachahmlichen Ruf, der das ganze Dorf durchhallte: »Aa-auf!«
Aa-auf. Marianne trieb ihre Kühe von der Weide zurück zum Melken, große, braunweiße, brunzdumme Tiere, die gelangweilt auf die Straße brezelten, jedes Jahr im Spätsommer Pauls kleinen Spalierapfelbaum zu schänden versuchten und von Marianne mit Stockhieben und jenem durchdringenden Ruf angetrieben werden mußten, der das Knacken ihrer Hufe auf dem Asphalt höchstens für Minutenbruchteile schneller werden ließ.
Aa-auf.
Das war, für Paul, der Ruf der Geborgenheit. Er unterteilte den Tag wie anderswo das Glockengeläut. Er brachte Ordnung ins Leben.
Vom Apfelbaum fiel eine dicke, grüne Reinette und zerbarst mit einem trockenen Schmatzen auf dem Asphalt. Zeit für die Apfelernte. Nicht heute. Vielleicht morgen.