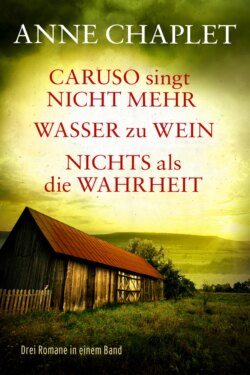Читать книгу Caruso singt nicht mehr / Wasser zu Wein / Nichts als die Wahrheit - Drei Romane in einem Band - Anne Chaplet - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеBremer brauchte Frankfurt. Etwa alle zwei Wochen. Und er genoß es, zurückzukommen in sein Dorf, wo ihn am Ortseingang schon die vertrauten Geräusche und Gerüche überfielen: das hohe Jaulen einer Kreissäge, das Aufheulen des Rasenmähers von Erwin und der Gestank aus dem Gülletankwagen von Schweinebauer Knöß. Als er das Gartentörchen öffnete, mischte sich ein weiteres, ein unvertrautes Geräusch in die vormittägliche Lärmorgie, das er nicht gleich einordnen konnte.
Wenn es nicht heutzutage Fernsehprogramme rund um die Uhr gäbe – und wenn er überhaupt einen Fernseher hätte –, dann hätte er das, was er jetzt hörte, für das weiße Rauschen nach Sendeschluß gehalten. Und wenn er ein etwas größeres, sozusagen städtisches Modell jener Zierbrunnenanlagen besäße, die man im Baumarkt in Haslingen bekam, weshalb schon drei seiner Nachbarn eine hatten, dann hätte er ebenfalls eine weit angenehmere Erklärung für das gehabt, was von seinem Haus her zu ihm herüberklang. Aber es gab eigentlich nur eine Möglichkeit. Er beschleunigte seine Schritte. Als er vor der Haustür stand, floß ihm ein dünnes Rinnsal entgegen.
Paul schloß mit fliegenden Fingern die Haustür auf und stürzte die Treppe hinauf ins Bad, wo ein scharfer Wasserstrahl eine Handbreit unterhalb des elektrischen Durchlauferhitzers austrat, in hohem Bogen auf die Decke traf, von der Putz und Farbe bereits in dicken Placken abgesprungen waren, an der Wand herunterlief und gurgelnd über den Fußboden zum Bodenabfluß strömte. Kaltwasserzuleitung, notierte er automatisch. Defekte Dichtung. Als er ein Stockwerk tiefer in die Küche gehastet war, um dort den Haupthahn abzudrehen, sah er, was er schon geahnt hatte: daß der Bodenabfluß nur einen Bruchteil des Wassers aufgenommen hatte. Die Wassermassen waren an der Wand vom Badezimmer im ersten Stock entlang in die direkt darunterliegende Küche im Parterre geflossen. Was Fußboden und Wand nicht aufgesogen hatten, bewegte sich nun Richtung Haustür.
Paul stöhnte und setzte sich auf die Treppe. Bremer, du bist ein Verlierer, dachte er verbittert. Knapp dem Hochwasser entgangen. Kein Wasserrohrbruch im Winter. Aber es holt dich ein – es holt dich ein!
Eine läppische, blöde, öde Dichtung. Er fluchte laut und atmete tief durch. Das Wasser war unter großem Druck ausgetreten, der Wasserdruck war in Klein-Roda enorm. Wahrscheinlich schon mindestens seit gestern. Das meiste war offenbar in Decke und Wände eingesickert, in den Lehmstrich, mit dem die Gefache zwischen den alten Eichenbalken ausgefüllt waren. Das traditionsreiche Baumaterial hatte hervorragende dämmende Eigenschaften – aber auch die Fähigkeit, sich mit Feuchtigkeit vollzusaugen und diese so schnell nicht wieder herzugeben. Ein naßkalter Winter stand Bremer bevor.
Mit Ekel im Gesicht tappte er durch die Lachen auf dem Boden, um seine Gummistiefel aus der Abstellkammer zu holen und den mit einer Gummikante versehenen Abzieher, den er sich für solche, allerdings im Falle eines Hochwassers befürchteten Kalamitäten zugelegt hatte. Im Haus war es kühlfeucht, und die Wände verströmten bereits einen strengen Geruch. Die Wasserrechnung würde gigantisch ausfallen.
In Gummistiefeln und mit dem Werkzeugkasten in der Hand stieg er die Treppe wieder hoch. In zehn Minuten war die Sache erledigt: Rohre aufgeschraubt, Kalk von den Muffen abgekratzt, zu seinem Glück eine passende Dichtung gefunden, eingesetzt, zugeschraubt, fertig. Die Wasserschäden zu beseitigen würde erheblich länger dauern. »Komplettrenovierung«, knurrte er. »Man kriegt ja langsam Übung.«
Aber wenigstens wußte er sich zu helfen, sagte sich Bremer nicht ohne Genugtuung. Er mußte keine Handwerker anrufen und auch noch teures Geld für deren Hilfe bezahlen. Oder nach den Nachbarn schreien. Das zählte in seinem Dorf. Daß Bremer die Gartenmauern selbst hochzog, die neuen Fenster selbst einsetzte, das Vordach über der Haustür selbst reparierte, galt hier weit mehr als die obskuren Dinge, mit denen er sich sonst noch beschäftigen mochte, wenn er sommers mit seinem Notebook am Gartentisch saß. Wer tätig war, sichtbar und nachvollziehbar, gehörte dazu. Nichts einfacher als das. Allerdings hatte er, wenn er sich recht erinnerte, wohl Monate gebraucht, bis er begriffen hatte, daß der nachbarliche Kommentar »Na, reißt du endlich ab?«, nachdem er im Schweiße seines Angesichts zur Verschönerung des Dorfes beigetragen hatte, ein Kompliment war und höchste Anerkennung bedeutete. Auf die Idee, sagte er sich zu seiner Entschuldigung, wären wohl auch andere nicht gleich gekommen.
Mit Abzieher und Feudel versuchte Paul, Bad und Küche wieder halbwegs trocken zu bekommen. Er fühlte sich kalt und ungeliebt und sehnte sich nach der Stadt. »Mietwohnung!« sagte er vor sich hin. »Zentralheizung!« Und, nach einigem Nachdenken, »Teppichboden!« Noch nicht einmal die Versicherung würde ihm beispringen. Er war zu geizig gewesen und hatte seine Police nicht um den Schutz bei Leitungswasserschäden ergänzen lassen.
In der Küche sah es noch übler aus als im Bad. Eins seiner Lieblingskochbücher, das auf der Arbeitsplatte gelegen hatte, war völlig durchweicht, die Seiten zusammengeklebt. Er versenkte es unter passenden Flüchen in der Papiertonne. Das Holz der Arbeitsplatte war aufgequollen. Wasser war in die Tischsteckdose geraten und hatte einen Kurzschluß ausgelöst. Und seine kleine japanische Kamera hatte es ebenfalls erwischt. Für Unterwasserfotografie war sie nicht gebaut. Bremer murmelte Verwünschungen und versenkte auch sie.
Nach anderthalb Stunden war er gründlich frustriert und kalt bis auf die Knochen. Er beschloß, sich das Feuer im Wohnzimmer jetzt schon anzuzünden. Auch Holzhacken macht warm.
»Ich dacht schon, ich hätt was Komisches gehört aus deinem Haus«, rief ihm Marianne zu, die sich aus ihrem Küchenfenster beugte, als er aus der Tür kam.
»Komisch ist gut gesagt!« rief er zurück, »das war ein Wasserfall!« Es tat ihm gut, die Mischung aus Entsetzen und Mitleid auf ihrem Gesicht zu sehen, als er ihr die Geschichte erzählte.
Und es tat ihm noch besser, seinen Zorn und seine Frustration am Brennholzstapel hinter dem Haus auszulassen. Nach einer Viertelstunde wischte er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und attackierte sogar einen verwachsenen Eichenklotz mit Inbrunst. Erst als Zigarettenrauch zu ihm herüberkräuselte, merkte er, daß er Publikum hatte. Willi, Mariannes Mann, sah ihm zu, die Kippe im Mund, das Anglerhütchen gewagt schräg auf dem Kopf, den er sich mit der rechten Hand kratzte.
»Na, machst du wieder alles kaputt?«
Es war, als ob irgend etwas in ihm auf dieses Stichwort gewartet hätte. Paul ließ die Axt fallen und brach in hemmungsloses Gelächter aus, in ein aus der Leibesmitte aufsteigendes Lachen, das ihn schüttelte und zusammenkrümmte und nach Luft schnappen ließ. »Willi«, japste er, »Willi ...«
»Ist ja gut«, sagte der gemütlich, »ist ja gut.«
Als Paul sich wieder beruhigt hatte, setzte er sich auf den großen Baumstamm neben dem Holzplatz und klopfte auf den Platz neben sich. »Komm, setz dich.«
Mit Männern schweigen tat wohl, dachte er. Willi rauchte, kratzte sich ab und an den Kopf mit den dunkelbraunen Lokken und trat die Kippe schließlich mit dem Absatz seiner Gummistiefel in den weichen Boden. Nach zwei Minuten zündete er sich die nächste an. In einem jähen Anfall von Großmut verzieh Paul dem Mann seiner Freundin Marianne, daß auch er, immer wenn er dem störrischen Zigarettenautomaten eine Packung abgerungen hatte, den Zellophanüberzug der Kippenschachtel in Pauls Vorgarten warf.
Einvernehmlich saßen die Männer beisammen, sagten nichts und ließen die Zeit vergehen.
»Schwierig das alles im Moment, nicht?« sagte Willi kryptisch.
Paul antwortete nicht. Und legte dann die Hand auf die Schulter des Mannes und drückte einmal kurz. »Ja«, sagte er.
Als er mit einem gefüllten Holzkorb den Schuppen betrat, in dem er das frischgespaltene Holz zwischenlagerte, verflog die Ruhe, in der er sich eben noch eingerichtet hatte. Er verstand erst gar nicht, was er da vor sich sah. Auf dem Boden unter dem Schuppenfenster lagen Scherben, Glasscherben, von einer Flasche offenbar, denn ein Flaschenhals war zu erkennen, der noch intakt war. Die Scherben lagen in einer Pfütze, in irgendeiner hellen Flüssigkeit. Katzenpisse? Paul verwarf den Gedanken gleich wieder. Katzen haben es gerne gemütlich dabei, und Scherben waren keine gute Unterlage. Im Flaschenhals, fiel ihm auf, steckte ein Stück Papier, das oben, dort, wo es aus der Flasche herausragte, schwärzlich, nach unten hin braungelb war. Eindeutig angekokelt. Brandspuren. Das Papier sah wie eine Lunte aus, durchfuhr es ihn, das Ganze wie ein Brandsatz, den man ihm in den Schuppen geschleudert hatte, in dem nicht nur sein Rennrad stand, sein Gartengerät, seine Werkbank, eine Leiter, eine Sackkarre, ein Sack Zement, sondern in dem auch ein guter Kubikmeter gespaltenes Holz, sechs Zentner Briketts und vier Zentner Eierkohlen lagerten.
»Verdammt«, sagte er und atmete geräuschvoll aus. Er guckte zum Fenster: Das Oberlicht stand offen. Es stand ja immer offen. Jemand hatte ihm durchs Oberlicht einen Molotowcocktail in den Schuppen geworfen, erste Wahl für einen Brandherd, fand Paul, den plötzlich eine namenlose Wut packte. Ich bring ihn um, das miese Schwein, und zwar ganz langsam, dachte er und sah seine Hände sich fest um einen Hals legen und dann langsam zudrücken, zudrücken und dann schütteln, wie es die Katzen mit ihrer Beute machen. Bis es knackt. Paul ballte die Fäuste. Ich will ihn umbringen, stellte er mit einer Mischung aus Genugtuung und Verblüffung fest. Bestialisch umbringen. Das Gefühl war ihm neu.
Eine kaputte Dichtung war Schicksal. Wie Hochwasser. Aber das, das hier, das war die reine menschliche Bosheit, das hatte ein Gesicht, einen Namen und eine Anschrift. Es war ihm, als ob er darauf gewartet hätte, daß das Unglück, dieser graue Ascheregen über seinem Leben, menschliche Gestalt annahm. So ein mieses Schwein! Und noch nicht einmal geklappt hatte es! Dieser Gedanke ernüchterte ihn wieder.
Für eine ordentliche Brandstiftung war das Ganze tatsächlich ein bißchen dilettantisch. Paul setzte den Holzkorb ab und tauchte einen Finger in die Flüssigkeit. Sie roch nach nichts, nicht nach Benzin, nicht nach Spiritus. Mit der Gartenschere zog er das Papier aus dem Flaschenhals, die »Lunte«, und breitete es unter Zuhilfenahme eines Schürhakens auf dem Hackklotz aus. Verblüfft sah er, daß die »Lunte« eine Botschaft enthielt. In unbeholfener Blockschrift stand auf dem Papier: »Du bist der nächste.«
Paul mußte sich setzen. Auf den Holzkorb, als Notbehelf. Der nächste was? Das nächste Opfer einer Brandstiftung? Das nächste Mordopfer? Der nächste, der auf einen dummen Bubenstreich hereinfällt? Ich kann nicht klar denken, dachte er, noch immer mit Schweiß auf der Stirn, voller Wut. Klar war nur eines: Jemand bedrohte ihn. Hier, wo er sich fünf Jahre sicher gefühlt hatte. Vor den Anforderungen der Welt. Vor seinen Gefühlen. Vor der Verantwortung. Vor – ach, weiß der Teufel. Er stand auf, klopfte sich Holzstaub und Holzsplitter vom Hosenboden und beschloß, die Polizei anzurufen. Die sollte sich einen Reim auf die Sache machen.
»Schwierig, das alles im Moment, nicht?« Ach, Willi.
Zwei, drei Stunden könne es schon dauern, bis jemand vorbeikäme, sagte man Paul auf der Polizeidienststelle im gut dreißig Kilometer entfernten Bad Moosbach, an die er über die Notrufnummer vermittelt worden war. Es gehe ja nun nicht mehr um Leben oder Tod. In der Tat. Aber was war eigentlich, wenn es darum einmal ging? Warten Sie mit Ihrem Ableben, bis wir den Stau auf der B 27 weiträumig umfahren haben?
Die Zeit des Dorfsheriffs war eindeutig vorbei. Bremer zog sich um und setzte sich aufs Rennrad. Bloß nicht warten müssen. Lieber die dunklen Schatten gleich bekämpfen, die er vom Boden seiner Seele nach oben flattern fühlte.
Er ließ mit einem Schnicken des Zeigefingers der linken Hand die Gangschaltung auf den mittleren Zahnkranz einrasten und legte seine ganze Frustration in den Antritt. »Schönes Landleben! Heile Welt!. fluchte er mit zusammengebissenen Zähnen, als er schon am Ortsausgang einen zermatschten Igel auf der Straße liegen sah. Auch der hatte sich sicher geglaubt. Bloß weil er Stacheln hatte.
Seine Reifen hätte er mal wieder aufpumpen sollen, dachte Paul, als er zum dritten Mal in eines der schlecht wieder zugeklebten Löcher in der Asphaltdecke hineingefahren war und den Stoß schmerzhaft in Handgelenken und Wirbelsäule spürte. Normalerweise, wenn ihn die Wut nicht vernebelte, fuhr er Slalom um die hervorstehenden Kanaldeckel oder die quadratischen Vertiefungen am Straßenrand in den Nachbardörfern. Die meisten Hausbesitzer hatten den Anschluß an den Abwasserkanal in Eigenarbeit vollzogen, die Strecke von der Hausgrube bis zur Straße selbst ausgeschachtet und dann zugeschüttet und die Asphaltdecke nur sehr sparsam wieder ausgebessert. Immerhin verfügten die Nachbargemeinden seit einem Jahr über den Anschluß an die Kläranlage, auf den Klein-Roda noch immer wartete.
Hinter Heckbach griff er plötzlich in die Bremsen. Eine Blutspur zog sich über die Breite der Straße, und am Wiesenrain lag ein Haufen fliegenumflirrter Eingeweide, der den über der Wiese kreisenden und schrill schreienden Greifvögeln offenbar bislang entgangen war. Schon wieder eine Leiche! zuckte es ihm durchs überreizte Hirn. Er stieg ab und besah sich den Haufen genauer. Das sah eher nach den Überresten irgendeines armen Wildtieres aus, das einen ganz banalen Verkehrstod gestorben war. Seine strapazierten Nerven ließen ihn offenbar nur noch das Schlimmste erwarten.
Der Schock saß. Dreihundert Meter weiter, kurz hinter dem Scheitelpunkt einer langgezogenen Kurve, hatte ihn der Weltschmerz fest im Griff. Angerührt war er eigentlich immer, wenn er hier vorbeikam. Heute stand ein Strauß mit kupferfarbenen Chrysanthemen neben dem schon etwas verwitterten Holzkreuz vor der großen Robinie rechts am Straßenrand.
Sie denken noch immer an ihn, dachte Paul. Vor einigen Monaten hatte er eine Frau mit schulterlangem, wehendem braunen Haar gesehen, wie sie die Vase neben dem Holzkreuz säuberte und aus einer kleinen Gießkanne den Blumentopf wässerte. War es die Schwester? Die Freundin?
Blumen für »Martin. 4. April 1976. 13. Juni 1995«. Für einen gerade 19jährigen. Wer warst du, Martin? Je nach Stimmung stellte Paul ihn sich als fröhlichen braunhaarigen Burschen vor, Schreinergeselle vielleicht, der von einem volltrunkenen Freund nach einem Besuch in der Disco gegen den Baum gefahren worden war. Diese Sorte Tod stand in der Statistik der Verkehrsopfer auf dem Land an vorderster Stelle. Paul wollte schon immer mal sämtliche Holzkreuze in der näheren Umgebung zählen. Jedes Jahr kamen welche dazu.
Und manchmal stellte er sich Martin als eines dieser kleinen Arschlöcher vor, die sich ihren besoffenen Kopf selbst und irgendwie verdientermaßen am Chausseebaum eingefahren haben. Sie waren eine Gefahr – für sich und andere. Oder etwa nicht?
Und die dritte Möglichkeit? »Vielleicht hat er es mit Absicht getan«, flüsterte Paul und nickte einem Bussard zu, der neben der Straße auf einem Zaunpfahl saß und streng zu ihm herüberschaute. Für viele junge Leute war das Leben in einem engen, kleinen Dorf eine eher zweifelhafte Idylle. Und für einige bedeutete es ein Leben ohne Ausweg. Außer diesem.
Vor vielen Jahren noch hätte er das ähnlich gesehen. Heute allerdings war das anders. Bremer spürte mit flackerndem Herzen, daß er sich nicht nur, ohne es zu wollen, in Anne verliebt hatte. Das ging ja noch. Sondern auch in sein gottverlassenes, stinkendes, lautes und enges Kuhkaff. Und auch das nur aus Versehen. Es mußte erst jemand kommen, der dich aus der Idylle vertreiben will, Bremer, dachte er. In Gefühlsdingen bist du ganz schön schwach auf der Brust.
Er schaltete runter und ging die nächste Steigung sanft an, damit sein Herz wieder langsamer schlug. Keine Idylle war perfekt. Erwin soff, Alfred schlug seine Frau, und Marianne, die ihm einmal ihr Herz ausgeschüttet hatte, zweifelte an ihrer Ehe. Der jüngste Sohn vom Schweinebauern Knöß war kürzlich laut um Hilfe brüllend nachts um drei Uhr auf der Landstraße gesehen worden – Drogen, hieß es. Und Kathrinchen mit ihren fünfzehn Jahren war schwanger. Gib der Perspektivlosigkeit einen Namen: Familie, dachte Paul böse.
Aber wer wollte es schon perfekt, vor allem, wenn es um Idyllen ging? »Sie haben dich freundlich aufgenommen, als du krank und kaputt warst, Bremer«, sagte er sich. Nach der Scheidung von Sibylle. Und ihm etwas gegeben, von dem er bis dato gar nicht wußte, daß er es brauchte: Kontrolle. Soziale Kontrolle. Paul lachte auf und ließ sich den Berg hinunterrollen. Wer hätte das gedacht: daß Kontrolle glücklich machen konnte ...
Gottfried, zum Beispiel. Der gute Gottfried. Gottfried hatte den ganzen Tag nichts zu tun – außer dem bißchen Hühnerfüttern und Karnickelzüchten. Zwischendrin – das heißt meistens – saß er vor dem Haus und ließ sich von der Sonne bescheinen, Pauls kleines Anwesen direkt im Blick. Gottfried war ein zufriedener Mann. Gottfried war ein glücklicher Mann. Gottfried hatte alles unter Kontrolle. Vor allem Paul.
Gottfried wußte, wann Paul aufstand, wie lange er am Schreibtisch saß, wen er zu Besuch hatte und wann der das Haus verließ; wie viele leere Weinflaschen Paul wöchentlich zum Altglas-Container trug, und was es bei ihm zum Mittagessen gab. Gottfried ermahnte ihn, beim Gärtnern oder Renovieren rechtzeitig Feierabend zu machen, und erinnerte ihn bei aufziehenden Wolken daran, das Verdeck seines Autos zu schließen.
Wenn Gottfried etwas entging, war immer noch Marianne da. Während Gottfried Pauls Anwesen von der gegenüberliegenden Straßenseite aus einsehen konnte, lag Mariannes Bauernhof gleich links von ihm. Sie nahm Pakete entgegen, wenn Paul unterwegs war. Sie schleppte ihm im Sommer ganze Eimer voll mit Salat an, von dem sie immer zuviel hatte. Sie brachte ihm selbstgebackenes Brot mit, vom Backhaus. Er war froh, wenn er ihr dafür das Feuerholz hacken und im Herbst ein paar Körbe Äpfel geben konnte.
Sie hatte ihm ziemlich bald das Du angeboten, damals, als er krank und deprimiert in Klein-Roda ankam. Es war ihm heute noch peinlich, daß nicht er es war, der im Dorf die Runde machte, um sich vorzustellen: »Paul Bremer. Ich bin der neue Nachbar. Ich bin der Verrückte, der die Bruchbude dahinten wieder renovieren will. Ich bin ein bißchen einsam, ein bißchen seltsam, aber sonst ganz in Ordnung.« Es war Marianne gewesen, die auf ihn zugekommen war – und es war Marianne, die ihn verteidigte, wenn man sich wieder einmal an ihm störte: Daß er die Gass’ nicht regelmäßig fegte. Und seltsame Freunde hatte. Und häufig nicht da war. Und wovon lebte der Kerl überhaupt?
Das Dorf hatte ihm wieder Halt gegeben nach der Trennung von Sibylle – soviel stand fest, obwohl es seine städtischen Freunde nicht verstanden: Wie hältst du das aus? Diese ewige Kontrolle! Dieses dauernde Überwachtsein! Daß sie selbst einander oft tagelang weder zu Gesicht bekamen noch sich auch nur anriefen, mochte er ihnen nicht vorwerfen. Ein Gemeinschaftsapostel war er schließlich nicht. Wie konnte er ihnen erklären, daß ihn die dörfliche Kontrolle einfach nicht mehr schreckte? Wenn er sich von Gottfried beobachtet fühlte, dachte er ihn einfach weg. Am liebsten hätte er seinen Freunden gesagt: Hier kann ich nicht verlorengehen. Hier ist – irgendwie – Heimat ... Aber das hätte auch wieder niemand verstanden. Bremer, du sentimentaler Hund, dachte Paul und trat unwillkürlich stärker in die Pedale. Als ob man vor aufstörenden Selbsterkenntnissen wegfahren könnte ...
Nach dem Anstieg hinter Oberhunden stieg er vom Rad, nahm einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche und setzte sich auf die Bank, die unter einer Linde vor dem alten, aus Bruchstein gemauerten Wasserreservoir stand. In der Ferne drehten drei Windräder ihre Flügel. Hinter ihm stieg eine Gabelweihe auf und stieß ihren hohen Schrei aus.
Die Wahrheit war: Es tat ihm noch immer weh, an Sibylle zu denken. Der er keine Heimat gewesen war. Obwohl er es ebenso gewollt hatte wie sie: das Heim, den Herd, das Kind. Glaubte er jedenfalls.
Der Job in der Frankfurter Werbeagentur war nie sein Traumjob gewesen – er war der ewige Behelfsberuf, der ihn am »Eigentlichen« hinderte. An was, bitte? Bremer schnaubte verächtlich. Die Werbeagenturen wimmelten nur so von verhinderten Künstlern und Literaten, die alle für Höheres geboren waren und »es« nur des Geldes wegen taten. Um sich fürs »Eigentliche« aufzusparen. So ein Arschloch warst du auch, dachte er, der mittlerweile überaus realistische Vorstellungen von den eigenen Talenten hatte.
Als Sibylle endlich schwanger war und von ihm mehr als nur das Bekenntnis zum Kind erwartete, als sie Stundenpläne wünschte, klare Einigung über Aufgabenaufteilung, Teilzeitarbeit auch für ihn vorschlagen wollte, entdeckte Paul plötzlich eine mächtige Liebe zu seinem Beruf, die er ihr bis dato, worauf sie resigniert hinwies, völlig verschwiegen hatte.
Er würde sich das nie verzeihen. Im fünften Monat hatte Sibylle eine Fehlgeburt. Er war gerade wieder unterwegs gewesen, hatte einen großen Auftrag für die Agentur zu bearbeiten, wichtig, auch für die Zukunft, auch für das Kind, wie er seit einiger Zeit gerne behauptete. Im entscheidenden Moment war er nicht da. Sibylle war allein ins Krankenhaus gefahren – allein mit Ungewißheit, Angst, Schmerzen – und schließlich: Gewißheit.
Bremer stieg wieder aufs Rad und fuhr die Strecke hinunter nach Rottbergen – halb blind vor Tränen. »Der Fahrtwind«, redete er sich halbherzig ein. Klar: Es war ja immer nur der Wind.
Sibylle wußte früher als er, daß ihre gemeinsamen Pläne gescheitert waren. Er hatte die Trennung akzeptiert, sie war unausweichlich. Aber was tat ihm eigentlich immer noch so weh? Zwei Tage vor der Scheidung hatte er sein Büro bei Everyman und Partner ordentlich aufgeräumt, Christa einen Zettel hinterlegt, wo und wie er sämtliche laufenden Vorgänge archiviert und abgespeichert hatte, die Kündigung eingereicht, die nötigen Aktienanteile flüssig gemacht und diese Hütte hier gekauft. Für Peanuts, um ehrlich zu sein. Und betrieb seither Einsiedelei – wenn auch unter den Augen der Öffentlichkeit. Als Buße? Vielleicht. Dann war das Fahrradfahren wie das tägliche Rosenkranzbeten.
Die Vorstellung reizte ihn – von der täglichen heiligen Handlung unter Einsatz von Muskelkraft und Shimano-Schaltung. Gelobt seien die Jahreszeiten und der Fortschritt der Welt. Gepriesen die Lauchstangen und Kohlköpfe in den Gemüsegärten der Bäuerinnen. Die Holzstapel, die man im Sommer anlegte. Der ungemein tüchtige Vertreter, der in den 6oer Jahren tonnenweise Eternitplatten an die Landbevölkerung verkauft haben mußte, die nun vor jeder Fachwerkfassade klebten.
Der heilige Zauber funktionierte. Paul spürte, wie sich seine Stimmung hob: getröstet vom Rot des Weinlaubs am Schulgebäude von Waldburg, vom Gelb der Rudbekien in einem Bauerngarten gleich hinter Streitbach, von den kupferfarbenen Chrysanthemen und roten Astern. Und von dem ersterbenden Grau, das von dem rachitischen Holzzaun abblätterte, der sich um ein heruntergekommenes Armeleutehaus in Rottbergen lehnte.
In Groß-Roda begegnete ihm der braune Jeep wieder, den er vorgestern früh vor dem Weiherhof gesehen hatte. »Der Flug des Falken« hatte offenkundig eine Karambolage erlitten: Die Beifahrerseite war völlig eingedrückt. Das Fahrzeug stand am Straßenrand wie abgestellt und abgeschrieben. Irgendwie fühlte er Genugtuung. Geschah dem Deppen recht.