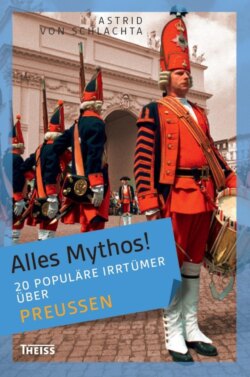Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über Preußen - Astrid von Schlachta - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die preußischen Gebiete erweitern sich
ОглавлениеOb es der Aufbau von Machtblöcken, die Übernahme wirtschaftlich erfolgreicher Standorte oder der Zugang zum Meer war – Expansion war stets mit Interessen verbunden. Mit ihren strategischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten lockten die Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg sowie die Grafschaften Mark und Ravensberg die brandenburgischen Kurfürsten im frühen 17. Jahrhundert. Die Begehrlichkeiten auf die Gebiete im nordwestlichen Teil des Alten Reichs, die einen Teil des heutigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen bilden, wurden 1609 geweckt, als der katholische Herzog Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg ohne Erben starb. Es entbrannte ein dynastisch-konfessioneller Erbfolgekrieg, in den vor allem Spanien, Österreich und Pfalz-Neuburg sowie die Niederlande, Brandenburg und Frankreich involviert waren. Erstere wollten die Gebiete für den Katholizismus erhalten, letztere sie für den Protestantismus gewinnen. Direkte Erbansprüche konnten Johann Sigismund von Brandenburg für seine Frau Anna, deren Mutter aus Jülich-Kleve-Berg stammte, und Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, der Neffe Herzog Wilhelms, stellen.
Die Lage verschärfte sich, als brandenburgische und pfälzische Truppen in Jülich-Kleve-Berg einmarschierten. Obwohl man sich zunächst im Dortmunder Rezess von 1609 darauf geeinigt hatte, das Gebiet gemeinschaftlich zu regieren, brach der Konflikt bald wieder aus. Vor allem von katholischer Seite entstand neuer Druck, als der Kaiser – eigentlich ein neutraler Vermittler – die katholische Seite mobilisierte und auch die beiden gemeinschaftlich Regierenden versuchten, ihre Macht auszuweiten. Brandenburg fand in den Niederlanden einen Verbündeten und der Pfalzgraf von Pfalz-Neuburg, Philipp Ludwig, konnte seine Hoffnungen auf Spanien und den Kaiser setzen, nachdem er zum Katholizismus übergetreten war. 1614 schlossen die Kontrahenten den Vertrag von Xanten, der den Konflikt zunächst beilegte: Die Herzogtümer Jülich und Berg gingen an Pfalz-Neuburg, das Herzogtum Kleve sowie die Grafschaften Mark und Ravensberg an Brandenburg. Erst 1672 war der Konflikt dann endgültig beendet. Kleve und Mark blieben brandenburgisch, Jülich und Berg pfalz-neuburgisch.
Für Brandenburg brachte der Konflikt zwei entscheidende Neuerungen mit sich. Johann Sigismund trat zum reformierten Glauben über, und Brandenburg erhielt Besitzungen im Westen, die territorial zunächst nur recht schwer integriert werden konnten. Doch sie waren die Grundlage für die preußische Macht am Niederrhein. 1702 folgte durch einen Erbanspruch die Grafschaft Moers, und nach 1713 ergänzte das neu gegründete Herzogtum Geldern preußischen Anteils, zu dem die Stadt Geldern, aber auch Keveelaer, Venlo, Staelen und Viersen gehörten, die Besitzungen der Hohenzollern an Niederrhein und Maas. Die westlichen Gebiete Preußens waren nicht nur nur wirtschaftlich sehr potent – Krefeld beispielsweise gehörte zu den führenden Städten in der Seidenweberei –, sondern sie waren auch militärisch von Bedeutung. Sie bildeten den Brückenkopf zu den Niederlanden und einzelne Städte, wie Geldern, stiegen zu wichtigen Festungs- und Garnisonsstädten auf.
Eine andere strategische Bedeutung hatten jene Gebiete, die Preußen nach dem Großen Nordischen Krieg zugesprochen bekam. Durch den Frieden von Stockholm (1720) kamen Stettin, das Land bis zur Peene mit den Inseln Usedom und Wollin (und damit wichtige Ostseezugänge) sowie die Odermündungen an Preußen. Von 1724 an ließ Friedrich Wilhelm I. Stettin zur Festung ausbauen. Gleichzeitig begann er, das Randow-Bruch nahe Löcknitz trockenzulegen und durch neue Siedler urbar zu machen.
Auch Ostfriesland war für Preußen vor allem deshalb wichtig, weil es den Zugang zur Nordsee über den wichtigen und gut ausgebauten Hafen in Emden garantierte. Das Land fiel 1744 nach dem Tod des letzten ostfriesischen Herrschers, des Fürsten Carl Edzard aus der Familie der Cirksena, an Preußen. Mit dem Tod des kinderlosen Carl Edzard wurde eine den preußischen Herrschern vom Kaiser als oberstem Lehensherrn erteilte Anwartschaft auf Ostfriesland gültig. Kurfürst Friedrich III. hatte die Expektanz 1694 erworben und sich diese 1706 und 1715 vom Kaiser bestätigen lassen. Allerdings erwies sich die Situation als nicht ganz so einfach, da auch Holland und Dänemark Ansprüche stellten und als alte Schutzmächte Truppen in Ostfriesland stationiert hatten. Doch Preußen konnte sich letztendlich durchsetzen. Friedrich Wilhelm I. hatte bereits 1732 den Titel eines „Fürsten von Ostfriesland“ in seinen Herrschaftstitel aufgenommen. Zudem hatte Preußen Verbündete unter den ostfriesischen Ständen gefunden und konnte so 1744 auf wohlgesinnte Vertreter in der Verwaltung und unter den Ständen bauen.27
Preußen erweiterte sich also stetig. Den Höhepunkt setzte Friedrich II. 1740 mit Schlesien und den westpreußischen Gebieten, die in der Ersten Teilung Polens 1772 hinzukamen. Doch territoriale Expansion wurde in der Frühen Neuzeit stets von den anderen Mächten im Reich und in Europa beäugt. Der Prellbock für Eroberungen waren die Interessen des Reichs und die bestehenden Bündnisse. Und so hingen auch die Eroberungen Brandenburg-Preußens nicht in einem politisch luftleeren Raum; erst recht nicht waren sie Ergebnis einer autonomen Territorialpolitik. Preußen war Teil des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Dieses Reich hatte zwar etwas von seiner Macht und der Integrationskraft auf seine Territorien eingebüßt, aber tot war es im 18. Jahrhundert keineswegs. Wie bereits an den Ergebnissen des Friedens von Wien von 1738 deutlich geworden ist, riefen Entscheidungen einzelner Fürsten – 1738 eben der Tausch Lothringens gegen die Toskana – andere Fürsten auf den Plan. Die Entscheidung Kaiser Karls VI. berührte das Reich ebenso wie andere territoriale Veränderungen.
Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war ein lange gewachsenes Gebilde mit Regeln, Hierarchien und Ordnungen. Erst kam der Kaiser, dann die Kurfürsten, wie es die „Goldene Bulle“ von 1356 festgelegt hatte. Die pfälzische Kurwürde war die höchste, weil sie laut „Goldener Bulle“ mit dem Amt des Erbtruchsesses verbunden war, das wiederum das vornehmste innerhalb des Kurfürstenkollegiums darstellte. Als Gremium der politischen Verhandlungen und als Vertretung der Reichsstände gab es den Reichstag, der seit 1663 „immerwährend“, also dauerhaft, in Regensburg tagte. Beschlüsse des Reichstags waren bindend für alle Glieder des Reichs.
Friedrich II. störte die Ordnung des Reichs 1740, als er Schlesien einnahm, und 1756, als er Sachsen überfiel. 1756 trat ein Sanktionssystem des Reiches in Kraft, die Reichsexekution. Vor allem auf Betreiben Maria Theresias sollte der Reichstag die Reichsacht gegen Friedrich verhängen, weil dieser den Reichsfrieden gebrochen hatte. Der Reichstag erklärte den Reichskrieg gegen Preußen, es kam zu einem Aufmarsch eines Reichsheeres gegen die preußischen Truppen. Friedrich wiederum berief einen Gegenreichstag ein, der den Kaiser für abgesetzt erklären und einen eigenen Kaiser, potentiell Friedrich selbst, wählen sollte. In der Schlacht bei Roßbach schlugen die preußischen Truppen dann jedoch im November 1757 das Reichsexekutionsheer, das sich mit Frankreich verbündet hatte. Die Niederlage fand ihre Verarbeitung in Spottgedichten wie: „Und kömmt der große Friderich und klopft nur auf die Hosen, so läuft die ganze Reichsarmee, noch mehr als die Franzosen.“
Brandenburg-Preußen war an das Heilige Römische Reich deutscher Nation gebunden. Diesem Umstand haben auch alle Interpretationen Rechnung zu tragen, die Brandenburg-Preußen spätestens seit dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm als absolutistisch geprägten Staat sehen, dessen Herrscher alle Macht in sich vereinte, gestützt auf Geheime Räte, Minister, Gesandte und Statthalter regierte und an keine kontrollierende Gewalt gebunden war. Doch diese Interpretationen sind ebenso zu hinterfragen wie der Begriff des „Absolutismus“ an sich. Die historische Forschung hat ihn in den letzten Jahren massiv kritisiert und seine Grenzen aufgezeigt, denn kein frühneuzeitlicher Herrscher war absolut und konnte ohne seine Landstände und weitere zwischengeschaltete Institutionen regieren. Diese stellten den Kontakt zu den Untertanen her und „verkauften“ die Politik des Fürsten. Auch in Geldangelegenheiten ging nichts ohne die Landstände. Steuern gab es nur, wenn der Herrscher seinerseits Privilegien gewährte und Zugeständnisse machte.
Weitere Grenzen setzten die Reichsgerichte, das Reichskammergericht in Wetzlar und der Reichshofrat in Wien. Sie waren die höchsten Appellationsgerichte, die allen Untertanen offenstanden, die Gerichtsbeschlüsse unterer Instanzen revidieren wollten. Allerdings konnten Fürsten vom Kaiser ein „Privilegium de non appellando“ erhalten, das den Untertanen des betreffenden Territoriums die Appellation an die Reichsgerichte untersagte. Preußen erhielt 1702 ein beschränktes Privilegium, das Appellationen unter bestimmten Umständen verbot. 1746 folgte dann ein unbeschränktes „Privilegium de non appellando“. Dies bedeutete, dass das 1703 in Berlin eingerichtete Obergericht für preußische Untertanen letzte Instanz war. Bei einer nicht-preußischen Instanz zu klagen, war also nicht mehr möglich. Ein „Privilegium de non appellando“ zu erhalten, war das Ziel vieler Fürsten, denn es half, die eigene Macht als Landesherr auszubauen. Auch der Kaiser untersagte als Landesherr den Untertanen seiner eigenen habsburgischen Länder die Appellation bei den Reichsgerichten.
Des Weiteren waren die Monarchen gebunden an Bündnisse und diplomatische Verpflichtungen. Für das 18. Jahrhundert spricht man von einem europaweiten „Gleichgewicht der Mächte“, einem ausbalancierten und durch Bündnisse gestützten Ausgleich der Interessen. Kein Staat, so besagten politische Theorien, sollte so mächtig werden, dass er die Freiheit und Unabhängigkeit der anderen Staaten gefährdete.28 Im Wesentlichen waren es die fünf Mächte Frankreich, Großbritannien, Russland, Österreich und Preußen, die die europäische Politik bestimmten, wobei Preußen erst im 18. Jahrhundert in die Riege der Großmächte aufstieg. Die traditionelle „Erbfeindschaft“ zwischen Österreich und Frankreich sorgte dafür, dass England und Österreich sowie Preußen und Frankreich gesetzte Allianzen waren – bis 1756. In diesem Jahr kam es zum sogenannten „Renversement des alliances“, zur „diplomatischen Revolution“ des 18. Jahrhunderts, als Friedrich II. mit der „Westminster-Konvention“ einen Vertrag mit Georg II. von England schloss. Es handelte sich um einen Nichtangriffspakt, der für den Fall eines Angriffs die gegenseitige Unterstützung festlegte. Frankreich, das sich durch das Vorgehen Friedrichs brüskiert fühlte, ging kurz darauf einen ähnlichen Pakt mit Österreich ein. Ein Ergebnis der neuen Allianzen war die Verheiratung der österreichischen Erzherzogin Maria Antonia mit dem französischen Thronfolger und späteren König Ludwig XVI. – eine Allianz, die bekanntermaßen in der Französischen Revolution ihr tragisches Ende fand.