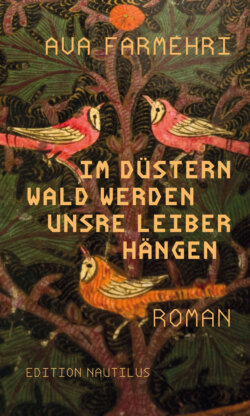Читать книгу Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen - Ava Farmehri - Страница 13
ZWEITES KAPITEL 1
Оглавление»Dann ist sie eben etwas seltsam. Jedes Kind ist anders!«, sagte meine Kinderärztin. Sie gab mir einen Lutscher, und ich wickelte ihn aus und schob ihn mir in den Mund. Das orange Papier warf ich auf den Boden. Mein Vater beugte sich vor, hob es auf und bedachte mich mit einem missbilligenden Blick, den ich ignorierte. Stattdessen sah ich aus dem Fenster. Draußen stand ein Apfelbaum, der aussah wie gekreuzigt. Oder wie der Buchstabe T. Seine Äste bogen sich unter der Last reifer Früchte, der Rasen war mit verfaulten Äpfeln übersät. Ich saß zwischen meinem Vater und meiner Mutter auf einer hellbraunen Ledercouch, die nach Kleinkindkotze stank. Meine Eltern blickten sich an und wussten nicht, was sie sagen sollten. Schließlich fragte Dr. Vafa, wohl aus professionellem Pflichtgefühl oder aus dem Bedürfnis, ihre Patienten zu beruhigen: »Worum geht es denn? Imaginäre Freunde? Angst im Dunkeln?«
Ich schenkte Dr. Vafa ein Lächeln und ersetzte ihren Anblick dann wieder durch das T, das seine blutigen Arme beschwörend gen Himmel reckte. Ich stand auf und wollte gehen, aber mein Vater zog mich zurück auf die Couch. »Setz dich.«
Ich gehorchte.
Mein Vater räusperte sich. »Nein, es geht um etwas Ernsteres.« Er warf meiner Mutter einen Seitenblick zu, aber sie saß nur zurückgelehnt auf der Couch und starrte ausdruckslos auf das Gemälde an der Wand gegenüber. Das Bild in dem kostbaren geschnitzten Holzrahmen zeigte eine Gruppe schmaläugiger Jäger mit Turbanen, die eine Löwin mit Speeren durchbohrten. Vielleicht hatte meine Mutter Mitleid mit dem verwundeten Tier und wünschte, sie könnte sich zwischen die blutrünstigen Jäger und die Löwin werfen und den Männern, indem sie die Speere in ihr eigenes Fleisch eindringen ließe, zeigen, dass sie die wahren Tiere waren. Ich weiß es nicht, aber meine Mutter stierte auf das Gemälde, als wollte sie seine ganze Grausamkeit in sich aufnehmen. Als wäre das Gemälde der einzige Grund, warum wir in diesem kühlen Zimmer saßen. Ihr Haar, das sie sich zu Hause oft um den Finger wickelte, ihr Haar, auf dessen Spitzen sie gern herumkaute, war von einem schwarzen, lose gebundenen Kopftuch verhüllt.
Da meine Mutter weiter beharrlich schwieg, blieb meinem Vater nichts übrig, als verschämt zu murmeln: »Unsere Tochter ist sieben Jahre alt und macht immer noch ins Bett, und sie –« Er starrte beschämt zu Boden und warf meiner Mutter wieder einen Blick zu: »Aresu, vielleicht solltest du es ihr erklären. Sag doch auch mal was.« Meine Mutter erwachte aus ihrer Trance und drehte sich halb zu meinem Vater um, der sich müde die Augen rieb. An seinem Mittelfinger prangte der schwere Silberring mit dem gelben Edelstein.
Dr. Vafa klappte den Mund auf, aber bevor sie etwas sagen konnte, ergriff meine Mutter das Wort: »Sheyda dschan«, sagte sie und fuhr mir mit den Fingern durchs Haar, »warum gehst du nicht nach draußen und spielst ein bisschen, bis Papa und ich hier fertig sind?«
Ich sprang auf und wollte zur Tür laufen, aber sie packte mich am Ellbogen, griff nach meinem Kinn und zog mein Gesicht dicht an ihres heran. Der Lutscher, den ich immer noch im Mund hatte, schlug klackernd gegen meine Zähne. »Bleib von der Straße weg und sprich nicht mit Fremden.« Dann küsste sie mich auf die Wange und wischte die braune Lippenstiftspur mit dem Daumen ab.
Ich nickte und rannte nach draußen.
Dort stand ich unter dem Baum, berührte sein Rückgrat und blickte hoch zu einem knallroten Apfel, der weit oben an einem Ast hing. Mit in den Nacken gelegtem Kopf überlegte ich, wie ich am besten an dem Stamm hochkäme, wo ich die Füße hinsetzen und an welchen Ästen ich mich festhalten musste. Nach drei gescheiterten Versuchen ließ ich mich ins Gras fallen, das vom Dauerregen am Vormittag noch feucht war, und lehnte meinen Rücken an den Stamm. Ich atmete angriffslustig, wickelte mir Grashalme um den Finger und kaute auf dem Rest meines Lutschers herum, der zerbröselte und nach Pappe zu schmecken begann. Der widerlich süße Geruch verfaulter Äpfel vernebelte mir den Kopf, und ich musste mich aus diesem Dämmerzustand befreien, bevor er mich ganz und gar überwältigte. Ich reckte den Hals und beschwor den Apfel, versuchte, ihn zum Herunterfallen zu überreden, sang ihm die Lieder vor, mit denen meine Mutter mich abends in den Schlaf wiegte, versprach, ihn niemals zu essen, und beteuerte gleich darauf, ich würde ihn mit der allergrößten Zärtlichkeit verspeisen.
Geduldig wartete ich auf ein Wunder, so geduldig, wie ich es den Rest meines Lebens tun würde. Ich wartete darauf, dass mich jemand rettete und mir die Lösung auf dem Silbertablett servierte. Irgendwann fand ich, dass es Zeit für einen Kompromiss war. Ich stand auf und suchte das Schlachtfeld nach einer Apfelleiche ab, die einigermaßen intakt aussah, so als würde sie höchstens leichten Durchfall verursachen. Als ich meine Beute aufhob, spürte ich, dass die verborgene Seite matschig war. Meine Finger glitten über die klebrige braune Haut und drangen tief in die überreife Feuchte ein. Ich schloss die Augen und biss sehnsüchtig in den Apfel. Süßer Saft rann mir über die Zunge, und ich sog ihn mit lautem Schlürfen ein, woraufhin die Frucht an meinen Lippen kleben blieb.
Als ich den Bissen gerade herunterschlucken wollte, spürte ich an meinen Lippen einen Wurm, ungefähr so groß wie der kleine Finger eines Babys. Er versuchte verzweifelt, sich zu retten, indem er in das nächstbeste warme Loch kroch: meinen Mund. Hastig spuckte ich mehrmals aus, wischte mir wütend über den Mund und rieb mir die Zunge mit dem Ärmel meines Pullovers ab. Vorher hatte ich allerdings noch auf den Wurm gebissen und die Bitterkeit seines gallertartigen Körpers geschmeckt. Apfelwürmer schmecken nach Eiter. Keine Ahnung, wie andere Würmer schmecken, aber Apfelwürmer schmecken nach Eiter.
Meine Eltern brauchten zu lang.
Bei unserer Ankunft hatte ein Junge mit blauen Augen auf dem Bürgersteig gesessen und Prophezeiungen des Dichters Hafis verkauft. Er hatte einen gelbgrünen Sittich dabei, der auf einem Stapel aus verschiedenfarbigen, zu kleinen Umschlägen gefalteten Blättern thronte. Auf jedem Blatt stand ein fal, ein Gedicht, das den Erfolg oder das Scheitern deiner niya, deiner Absicht, vorhersagte. Es war Aufgabe des Sittichs, einen Umschlag auszuwählen. Die ganze Zeit, während ich erst vergeblich versucht hatte, auf den Baum zu klettern, und dann vergeblich versucht hatte, den Apfel zu verhexen und zum Runterfallen zu bewegen, hatte mich der Junge beobachtet. Seine Blicke hatten mich angestachelt, es noch beharrlicher zu versuchen, seinetwegen hatte ich den Apfel noch heftiger begehrt. In dieser Hinsicht war ich wie meine Mutter. Nicht wie meine Mutter Aresu, sondern wie unser aller Urmutter: Eva. Ich wollte unbedingt das Gesicht wahren. Deshalb stand ich auf, nahm einen großen Stein, zielte sorgfältig und schleuderte den Stein mit aller Kraft in Richtung des Apfels. Wieder und wieder verfehlte ich mein Ziel. Schließlich kam der Junge näher, seinen Sittich auf der einen Hand, seine lyrische Einkommensquelle in der anderen.
»Wo sind deine Eltern?«, fragte er.
Ich vermied es krampfhaft, den Vogel anzusehen, starrte weiter hoch zu dem Apfel und gab keine Antwort.
»Wo sind sie? Noch da drinnen? Bist du stumm oder was?« Der Sittich knabberte an den Fingern des Jungen, tippelte dann zielstrebig seinen Arm hoch und setzte sich auf seine Schulter. Ich schwieg.
»Wenn du es mir sagst, hole ich dir den Apfel vom Baum«, sagte er mit einem dümmlichen Grinsen, bei dem er einen abgebrochenen Schneidezahn entblößte. Ich gab mich geschlagen und zeigte auf Dr. Vafas Praxis, die sich im Erdgeschoss des angrenzenden Hauses befand.
»Du musst lernen, wie man auf einen Baum klettert. Welchen Apfel willst du denn? Ich hole ihn dir. Aber du musst in der Zwischenzeit auf meinen Vogel aufpassen, damit ihn niemand klaut. Übrigens, du darfst nie die Blätter von einem Apfelbaum oder die Kerne essen.«
»Warum nicht?«
»Weil du dann stirbst.«
Noch bevor ich ihm den Apfel zeigen konnte, schob er seine Tageseinnahmen in die Brusttasche seines Hemdes und überreichte mir den Karton mit den Gedichten. Dann forderte er den Sittich mit einem Pfiff dazu auf, auf meine angststarre Schulter zu wechseln. Ich schrie auf, als der Vogel sich flatternd neben meinem Ohr niederließ und seine Federn mein Haar streiften. Er schlug noch ein paar Sekunden mit den Flügeln und beruhigte sich dann. Der Junge lachte und sagte, ich solle keine Angst haben, sondern mich ganz normal verhalten. Dann zog er seine hässlichen Schuhe aus und kletterte auf den Baum. Ich beobachtete, wie er den Stamm fachmännisch mit den Knien umklammerte und sich nach oben schob, ohne sich irgendwo festzuhalten, durch reine Muskelkraft. Sein magerer Po, der nicht viel größer war als meiner, sah von unten sehr lustig aus.
Ich streckte einen Arm aus und rief etwas zu laut: »Der da oben ist es, der glänzende Apfel über dir.« Der Sittich versteckte sich in meinem Haar, knabberte an meinem Ohr, rieb seinen gebogenen Schnabel an meinem Nacken und kitzelte mich so sehr, dass ich lachen musste. Als der Junge nach meinem Apfel griff, sah er zu mir herunter, und an seinem Gesichtsausdruck erkannte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Aber da war es zu spät. Eva hatte den Apfel gewollt, Adam würde ihn essen. Mit den Beinen hielt der Junge die Taille des Baums umschlungen, griff mit der linken Hand nach dem Ast, zog ihn zu sich herab und pflückte den schimmernden Apfel. Er rieb ihn an seiner Hose blank und biss dann mit einem lauten Krachen hinein, das mir noch tagelang im Ohr klingen würde.
Tränen schossen mir in die Augen und begannen mir über die Wangen zu laufen. Wütend warf ich seinen Karton zu Boden, sammelte mehrere verfaulte, ameisenbedeckte Äpfel in meinem Pullover und begann, ihn damit zu bewerfen. Ich hasste ihn, ich hasste ihn abgrundtief. Der Sittich flatterte schimpfend über den regenbogenfarbenen Blättern, die jetzt überall auf dem Rasen verstreut waren. Einige Äpfel trafen den Jungen nur am Hals oder am Bauch, aber der letzte traf ihn mitten auf die Nase. Er verzog das Gesicht und plumpste wie ein Stein zu Boden, mit blutender Nase, den angebissenen Apfel in einer Hand.
Ich lief davon.
Eine Viertelstunde später kam ich mit meinen Eltern aus dem Haus. Ich versteckte mich hinter meinem Vater und umklammerte seine Beine wie ein verängstigter Koala. Ich zerrte so heftig an seinen Hosentaschen, dass er fast gestolpert wäre. Er befreite sich von meinen schwitzigen Tentakeln und sagte: »Baba dschan, bitte geh wie ein normaler Mensch.«
Der Junge saß auf dem Bürgersteig, an derselben Stelle wie vorher, und hielt sich ein blutiges Taschentuch an die Nase. Der Karton mit den Umschlägen stand wieder vor ihm, und obenauf thronte der Sittich wie ein gelangweilter Wahrsager, der in einem Jahrmarktszelt darauf wartet, dass jemand seine übersinnlichen Fähigkeiten in Anspruch nehmen möchte.
»He, junger Mann!«, sagte mein Vater, als er die blutige Nase und das schmutzige Hemd des Jungen sah, und wuschelte ihm aufmunternd durchs schwarze Haar. »Alles in Ordnung?«
Der Junge zog einen Apfel aus seinem Hemd und rieb ihn an der Hose blank. »Ja.« Er grinste mich mit seinem bescheuerten abgebrochenen Zahn an und streckte mir den Apfel hin. »Den hier hast du vergessen.«
Ich bat meine Mutter mit einem Blick um Erlaubnis, und der Junge erklärte: »Sie hat mich gebeten, ihr einen Apfel zu pflücken, und ist dann ohne ihn weggerannt.«
»Das war aber wirklich nett von dir«, sagte mein Vater zu dem Jungen. »Das war wirklich nett von ihm, nicht wahr, Sheyda?« Er schob mich zu dem Jungen. »Sei nicht undankbar! Er hat sich sogar verletzt, nur um dir einen Gefallen zu tun. Na los, nimm den Apfel.«
Ich tat wie geheißen. Ich riss ihm den Apfel aus der Hand, bevor der Junge es sich anders überlegen und ihn selbst essen konnte. »Warte!«, rief meine Mutter, als sie sah, dass ich Anstalten machte hineinzubeißen. »Wir müssen ihn erst waschen. Du kannst ihn zu Hause essen.« Sie griff in ihre Handtasche und kramte etwas Geld hervor, um den Jungen für seine Bemühungen zu bezahlen.
»Ich will den Vogel haben«, sagte ich ruhig.
»Sheyda dschan, sei nicht dumm«, zischte meine Mutter.
»Der ist nicht zu verkaufen«, rief der Junge wütend, und ich war heilfroh, dass ich den Apfel schon an mich genommen hatte.
»Warum lässt du den Sittich nicht eine Prophezeiung für dich aussuchen?«, sagte meine Mutter. »Du hast doch bestimmt eine Frage, auf die du eine Antwort möchtest, Schatz?«
»Nein. Ich will den Vogel.«
»Den kannst du aber nicht haben. Junger Mann, bitte lass deinen Vogel ein fal für meine Tochter aussuchen«, sagte mein Vater mit wachsender Ungeduld und einem Anflug von Ärger in der Stimme. »Stell eine Frage, Sheyda. Aber behalte sie für dich. Oder formuliere einen Wunsch.«
»Wie viele Wünsche habe ich denn?«
»Einen.«
Ich schloss die Augen und dachte an etwas, was mir damals sehr bedeutsam vorkam. Nachdem der Vogel mit schiefgelegtem Kopf alle Möglichkeiten durchgegangen war, zog er mit dem Schnabel einen kleinen Umschlag hervor. Meine Mutter bat ebenfalls um ein fal. Wir bezahlten den Jungen und gingen mit den beiden Umschlägen davon; der eine war orange wie der Lolli, den ich von der Kinderärztin bekommen hatte, der andere himmelblau wie die Augen des Jungen. Im Taxi nach Hause öffnete meine Mutter ihren Umschlag und las das Gedicht, faltete das Papier dann sorgfältig wieder zusammen und schob es in ihre Handtasche. Dann öffnete sie meinen und las, was darauf geschrieben stand.
»Was um Himmels willen hast du dir gewünscht?«, fragte meine Mutter, die Hafis’ Prophezeiungen viel zu ernst nahm. Das Papier zitterte in ihren Händen.
»Ich habe geschummelt. Ich habe mir mehrere Sachen gewünscht.«
»Das macht nichts. Was hast du dir gewünscht?«
»Ich habe mir gewünscht zu verschwinden. Oder in einem Apfel zu leben wie ein Wurm.« Ich starrte auf die glänzende Schale des Apfels und versuchte, mein Spiegelbild darin zu erkennen. »Und du, maman? Was hast du dir gewünscht?«
Mein Vater drehte sich vom Beifahrersitz zu uns um. Er hielt eine halb abgebrannte Zigarette zwischen zwei angespannten Fingern, atmete den Rauch aus und sagte: »Sie hat sich gewünscht, du wärst normal.«
»Ich habe mir auch noch den Vogel gewünscht«, sagte ich und starrte weiter auf meinen Apfel.
Meine Mutter zerknüllte das orange Papier und warf es kurzerhand aus dem Fenster des fahrenden Taxis.
Ich habe nie erfahren, was in Dr. Vafas Sprechzimmer gesagt worden war. Aber ich kann es mir denken, denn drei Wochen später saß ich in einer anderen Praxis auf einer anderen Couch und sah aus einem anderen Fenster. Diese Couch stank nach teurem Parfüm, freien Assoziationen und Albträumen, und ich saß zwischen denselben Eltern, die fest überzeugt waren, dass ich verrückt war. Dr. Fereydun ist bis heute mein treuer Psychiater. Dr. Vafa hatte ihn meinen Eltern empfohlen, weil er große Erfolge mit schweren Fällen vorzuweisen hatte, und so einer war ich offenbar.
Die Wände seines Büros rochen nach verschämten Geständnissen und bösen Erinnerungen. Das Büro war zweimal so groß wie unser Wohnzimmer, und auf Dr. Fereyduns Schreibtisch standen viele schöne Dinge. Dinge, die in unserem Wohnzimmer, so fand ich, noch schöner ausgesehen hätten, zum Beispiel in einem der beiden Glasschränke, in denen meine Mutter das gute Geschirr und ihre Sammlung Porzellanengel aufbewahrte. Diesmal saß ich zwei lange Stunden still und wartete darauf, dass der Doktor mir einen Lutscher schenkte. Aber das tat er nicht. Er sprach die ganze Zeit mit meinem Vater und bombardierte mich mit Fragen zu meinem Spielzeug. An viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Am besten im Gedächtnis geblieben ist mir der Geruch seiner Couch, aber das liegt vor allem daran, dass er über die Jahre hinweg derselbe geblieben ist. Den Geruch von Erinnerungen bekommt man nicht so leicht wieder raus.
Der Glasschrank mit den Engeln war immer verschlossen. Meine Mutter versteckte den Schlüssel, aber ich wusste, wo ich suchen musste. Jeden Freitag schloss sie die Tür auf, um die Engel abzustauben und neu zu arrangieren. Sie nahm jeden einzelnen zärtlich in die Hand, hüllte ihn in ein feuchtes schwarzes Tuch und rieb ihn ab. Manche Engel beteten im Knien, andere blickten gütig auf mich herab, füllten meine Augen mit Wärme und segneten mich mit ausgebreiteten Armen. Ein weiblicher Engel spielte Harfe, zwei andere hielten arrogant die Augen geschlossen. Der Schlüssel befand sich in der Küche, in einem leeren Porzellankrug, in dem meine Mutter auch sämtliche Hemdknöpfe aufbewahrte, die mein Vater bei der Arbeit verlor.
Drei Tage später bemerkte meine Mutter die schwarze Katze, die trotzig zwischen all den monoton weißen Engeln stand, den Schwanz aufgerollt wie eine Peitsche, eine Pfote erhoben, als wollte sie ihrem Gegenüber das Gesicht zerkratzen oder einfach nur hallo sagen, ein Auge arglistig zusammengekniffen, die Zunge spöttisch rausgestreckt. Ihr geöffnetes Auge folgte mir gelb und hypnotisch durchs Zimmer. Meine Mutter knallte die Katze vor mich auf den Küchentisch. Ich war gerade damit beschäftigt, Erdbeermarmelade auf ein knuspriges Stück taftun zu schmieren. Ich sah lächelnd von meinem Frühstück auf, weil ich dachte, meine Mutter wollte sich bei mir bedanken. Falsch gedacht.
»Wann hast du die Katze an dich genommen? Wie hast du das angestellt?«, brüllte sie. »Wir saßen doch die ganze Zeit neben dir!«
Ich machte ein langes Gesicht. Leckte den Teelöffel ab, tauchte ihn erneut ins Glas, träufelte weiter Marmelade auf mein Brot.
»Meine Tochter ist eine Diebin! Was hast du noch gestohlen?« Meine Mutter riss mich vom Stuhl, ging vor mir auf die Knie und schüttelte mich. »Was hast du noch mitgenommen? Antworte!«
»Nichts. Nur die Katze.« Meine Mutter sah mich mit irren Augen an. Mir wurde klar, dass ich etwas sehr Schlimmes angestellt hatte, auch wenn ich nicht genau wusste, was daran so verwerflich war. »Ich wollte sie dir zum Muttertag schenken. Papa …«
Sie gab mir eine Ohrfeige, die nicht besonders wehtat. Vor Schreck begann ich zu weinen. Sofort zog sie mich in ihre Arme und rief atemlos: »Tut mir leid, Schätzchen, tut mir leid.« Ihr Haar geriet mir in die Augen und in den Mund, und ich musste husten. Es war ein trockener Husten, der mir im Hals wehtat und den ich mit Absicht übertrieb. Meine Mutter nannte mich ein dummes Mädchen und zog mich ins Badezimmer. Ich hielt immer noch den Löffel in der Hand und stolperte schluchzend hinter ihr her, während die Marmelade auf den Boden tropfte. Im Badezimmer hielt sie meinen Kopf über das Waschbecken und seifte mir Gesicht und Hände mit einer bitter schmeckenden grünen Seife ein. Die ganze Zeit über ließ ich den Löffel nicht los. Ich spuckte einen rötlichen Schaum voller kleiner schwarzer Samen ins Waschbecken. Dann hob ich den Blick. Das war die schlimmste Strafe: Meine Mutter zwang mich, im Spiegel mitanzusehen, wie ihr Tränen über das Gesicht liefen. Sie wollte mir zeigen, was ich ihr angetan hatte. Damals wusste ich nicht, ob es die Seife oder die Tränen meiner Mutter waren, die mich von meinen Sünden reinwuschen.
Jetzt weiß ich es.
»Wirst du es Papa sagen?«, fragte ich, während sie mir eine Jeans anzog und sie über meinem Bauchnabel zuknöpfte.
»Nein«, antwortete sie ohne jede weitere Erklärung.
Dr. Fereydun sagte, ich dürfe die Katze behalten. Er habe nicht einmal gemerkt, dass sie weg sei. Meine Mutter entschuldigte sich immer wieder und zerquetschte mir die Hand, damit ich dasselbe tat, damit ich wiederholte, was wir im Taxi einstudiert hatten: »Es tut mir leid, dass ich die Katze genommen habe, ohne Sie um Erlaubnis zu bitten. Ich verspreche, dass ich beim nächsten Mal vorher frage und dass ich nie wieder etwas stehlen werde.« Der Doktor sagte lächelnd, ich solle die Katze als Geschenk dafür betrachten, dass ich so ein mutiges Mädchen sei und meinen Fehler zugegeben hätte. Mit hochrotem Gesicht eilte meine Mutter mit mir aus dem Sprechzimmer.
Zu Hause angekommen, sagte sie, sie sei böse auf mich und wolle mich für den Rest des Tages nicht sehen. »Geh mir aus den Augen oder ich erzähle es doch noch deinem Vater.«
Ich verschwand in meinem Zimmer und knallte die Tür hinter mir zu. Die Katze nahm ich mit. Mein Magen knurrte, ich hätte gern eine Tasse heißer Milch mit einem Löffel Zucker getrunken. Ich zwang mich zu weinen, und es gelang mir auch, ein paar Tränen zu verdrücken. Ich leckte sie mir vom Gesicht und lag dann zufrieden auf meinem Bett, während der silbrige Nachmittag zu einem mitternachtsblauen Abend wurde. Irgendwann weinte ich noch etwas mehr, weil ich müde war und nicht schlafen konnte. Später muss ich dann doch eingeschlafen sein, wenn auch nur lang genug, um ins Bett zu machen. Ich wachte erst auf, als meine Blase den letzten Tropfen aus meinem Körper gepresst hatte. Ich fühlte mich erleichtert und schob eine Hand unter die Decke, um zu prüfen, wie groß der Schaden an der Matratze war. Als ich die Hand wieder hervorzog, war sie warm und klebrig. Mit den Beinen schob ich meinen Teddy unter der Decke hervor, um ihn vom Tatort zu entfernen, und als er in Sicherheit war, ließ ich von ihm ab. Er hing über der Bettkante, und zwischen seinen Beinen prangte ein Loch, genauso groß wie das Loch, das ich und die Welt eines Tages im Herzen meiner Mutter hinterlassen würden. Mein Teddy gebar einen Wattebausch.
In diesem Moment hörte ich das Glöckchen an der Tür klingeln, die von unserem Garten ins Wohnzimmer führte. Ich strampelte die stinkende Decke weg, sprang aus dem Bett und beobachtete durchs Schlüsselloch, wie mein Vater ein Bein hob, um seine Schnürsenkel zu lösen, wie er sich Halt suchend an die Wand lehnte und nacheinander beide Schuhe auszog. »Aresu«, rief er, während er in seine Pantoffeln schlüpfte, »Aresu dschanam, wo bist du?«
Meine Mutter tauchte im Blickfeld des Schlüssellochs auf. Während sie auf meinen Vater zuging, wogte ihr Po unter dem langen Kleid. Ich lief zurück zum Bett und schlüpfte hinein, froh, wieder von der warmen Geborgenheit eingehüllt zu werden, die durch das Zusammentreffen eines nassen Nachthemds und einer nassen Matratze entstand. Wegen des stechenden Uringeruchs musste ich die Luft anhalten. Ich versteckte den Kopf unter dem Kissen und begann eine Diskussion mit meinem Teddy.
»Ich bin keine Diebin, ich bin keine Diebin, ich bin keine Diebin. Er hat gesehen, wie ich die Katze genommen habe, aber er hat kein Wort gesagt.« Diese Sätze sprach ich mir immer wieder vor und schwor mir selbst, dass sie die Wahrheit waren, bis ich irgendwann einschlief. Falls meine Mutter mich bei meinem Vater verpetzte, wollte ich es nicht hören.
In der Nacht wachte ich auf, als meine Mutter misstrauisch schnuppernd ins Zimmer kam. Sie brachte mir ein Honigbrot auf einem Tablett. »Du hast den ganzen Tag nichts gegessen, und wir haben keine Marmelade mehr«, sagte sie lächelnd und schob mir ein Kissen in den Rücken, während ich mich gähnend aufsetzte.
Ich wollte ihr eigentlich die Frage stellen, tat es dann aber doch nicht. Es war nicht mehr wichtig, weil ich mit einem Mal sicher war, dass mein Vater mich in Schutz genommen hatte. Jetzt liebte ich ihn wieder. Als ich die Decke wegschob, um mir die Zähne putzen zu gehen, setzte ich den darunter gefangenen Gestank frei. Meine Mutter fiel fast in Ohnmacht. »Ey choda, Sheyda!«, rief sie und hielt sich die Nase zu. Dann zerrte sie mir das Nachthemd über den Kopf, spülte mich in der Badewanne ab und zog mir ein sauberes Nachthemd an, das sich weich und beruhigend anfühlte wie frischer Schnee. Anschließend versuchte ich, ihr beim Umdrehen der Matratze zu helfen, tänzelte um sie herum, zog an dieser oder jener Ecke, war aber im Prinzip völlig nutzlos. Meine Mutter sagte, jetzt sei es zu spät, um noch irgendwas gegen den Gestank zu tun.
Ich putzte mir die Zähne, und als ich zurück in mein Zimmer kam, sah ich, wie meine Mutter einen Haufen Sachen unter dem Bett hervorzog und die schmutzige Wäsche aussortierte, die ich dort versteckt hatte. Mit spitzen Fingern hielt sie ein Rüschennachthemd und drei Schlüpfer mit gelben Flecken in die Höhe, Beweise, die ich nicht verleugnen konnte. Beschämt schlich ich zu meiner Schultasche und zog weitere Schlüpfer zwischen den Büchern hervor. Sie waren noch feucht. Ich kroch in mein frischbezogenes Bett, und meine Mutter deckte mich zu, rieb mir mit dem Handrücken das gewaschene Gesicht trocken und streichelte über die Stelle, wo sie mich zuvor geschlagen hatte. Mit nach Safran duftenden Fingern zog sie die Konturen meines Gesichts nach und sang mich mit meinem Lieblingslied in den Schlaf:
La la la la Laleh Du bist meine Himmelsblume La la, du warst mein Schicksal Schlaf, Gefährtin meiner Seele Schlaf, meine Nachtigall mit glockenheller Stimme Schlaf, mein Liebling, der mich glücklich machen wird Eine Nachtigall singt in meinem Herzen Schlaf, meine blühende Blume Schlaf, mein kostbares Juwel Schlaf, mein Augenlicht Dein mondbeschienenes Gesicht ist mein Paradies Mein Herzenslicht Du bist mein süßer Granatapfel.
Ich lag still da und atmete durch die Nase, das Haar hinter die Ohren gestrichen, die Wimpern von Tränen benetzt. Meine Mutter, die dachte, ich wäre eingeschlafen, schaltete das Licht aus und wandte sich zum Gehen. Ich richtete mich auf und bat sie zu tun, was sie jeden Abend tat. Sie kniete sich im Dunkeln neben mein Bett und sah jetzt aus wie einer ihrer Engel. Dann legte sie ihre vollen Lippen an mein Ohr und machte leise schmatzende Geräusche. Ihr Atem kitzelte mich, und ich kicherte, um die Gänsehaut zu vertreiben. Als die Geräusche gleichmäßig wurden, schloss ich die Augen vor dieser Welt und stellte mir vor, wie ich zurück in ihren Schoß kroch, wie ich tief in ihr drin in Sicherheit war, weit weg.
»Maman«, sagte ich schläfrig, bevor sie aus dem Zimmer ging und die Tür hinter sich zuzog, »bitte sag Nana, sie soll noch mehr Erdbeermarmelade machen.«
»Schon geschehen, mein Liebling.«
Wenn ich an jene Nacht zurückdenke, weiß ich noch, dass ich, während meine Mutter mir das Schlaflied sang, reglos dalag. Ich lauschte ihrer melancholischen Stimme und genoss ihre hoffnungsvollen Bewegungen und ihren warmen, süßen, nach Minztee duftenden Atem. Ich war völlig gebannt vor Bewunderung. In jener Nacht fragte ich mich, warum meine Mutter mich liebte und warum sie mir verziehen hatte. Wenn ich ihr die Frage gestellt hätte, hätte sie sicher geantwortet, dass sie mich liebe, weil ich ihre Tochter sei. Vielleicht wäre sie auch errötet und hätte nicht gewusst, was sie sagen soll. Aber dann hätte ich an das Gutenachtlied gedacht. Ich war ihr Schicksal, ihre Seelengefährtin, ihre blühende Blume. Ich war ihre liebeskranke Nachtigall.
Als Kind verstand ich nicht, was diese Worte wirklich bedeuteten, aber für mich waren sie das Schönste von der Welt, weil meine Mutter sie täglich zu mir sagte. Sie waren das Schönste von der Welt, und die wenigen Minuten, wenn ich vor dem Schlafengehen der Stimme meiner Mutter lauschte, waren unser gemeinsames Gebet.
Liebte sie mich, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte? Umarmte sie mich deshalb jeden Abend? Die Menschen tun so viel aus schlechtem Gewissen! Sie würden alles tun. Ich nutzte ihre Schuldgefühle zu meinem Vorteil, hatte aber keine Ahnung, wie und warum das funktionierte.
Als ich am nächsten Tag aufwachte, stellte ich fest, dass mein Vater ein großes Paket Windeln und einen blauen Plastiküberzug für meine Matratze gekauft hatte.