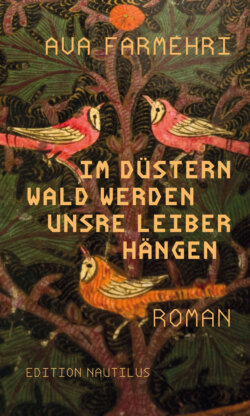Читать книгу Im düstern Wald werden unsre Leiber hängen - Ava Farmehri - Страница 14
2
ОглавлениеEine Woche vor meinem Malheur hatte ich vor dem Schokoladenregal gestanden, während mein Vater an der Kasse mit Agha Ali redete, dem freundlichen Ladenbesitzer, der mir immer eine Flasche Parsi-Cola schenkte, wenn er mich schwitzend auf der Straße spielen sah. Sie unterhielten sich über Agha Alis Khodro Samand, der am Abend vorher aufgebrochen worden war. Der Wagen war sein ganzer Stolz, und alles, was herausnehmbar und wegtragbar war, einschließlich des Fahrer- und Beifahrersitzes, war gestohlen worden: das Radio, der Motor, die Scheibenwischer, die Seitenspiegel, der Rückspiegel und sogar der Duft-Tannenbaum am Rückspiegel. Alles weg! Die Diebe hatten die Türen von außen mit einem Schlüssel zerkratzt und die Innenverkleidung mit einem Messer aufgeschlitzt. Sie hatten die Scheinwerfer zertrümmert. Sie hatten alle vier Reifen zerstochen, aber erst, nachdem sie das Auto die Straße hinuntergeschoben hatten, weg von Agha Alis Haus, zu einer Stelle, wo sie ihrem schändlichen Tun ungestört nachgehen konnten. Agha Ali war außer sich, er schüttelte den Kopf, rieb sich die Stirn, schimpfte lauthals auf die Diebe, die seinen geliebten Samand geschändet hätten, und tat seine Meinung darüber kund, was die gerechte Strafe für dieses Pack wäre.
»Man sollte ihnen die Nasen abschneiden, damit sie ihr weißes Pulver nicht mehr schnupfen können. Nur deswegen klauen sie Autos!«
Um ihn zu trösten, sagte mein Vater, die Polizei sei auf der Suche nach den Übeltätern und außerdem besitze einer seiner Freunde eine Autowerkstatt und werde ihm einen guten Preis machen, falls er Ersatzteile oder einen neuen Gebrauchtwagen kaufen wolle.
Die glänzende Verpackung einer Tafel Milchschokolade war aufgerissen, und eine Ecke schaute hervor. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich mir vorstellte, wie der weiche braune Klumpen auf meiner Zunge schmolz. Während die Männer in ihr Gespräch vertieft waren, tat ich nichts weiter, als das zu vollenden, was jemand anders begonnen hatte: Ich streckte die Hand aus, brach ein verlockendes Schokoladenstück ab und zog es aus der dünnen Aluminiumfolie. Doch noch bevor ich es in meinem Mund verschwinden lassen konnte, warfen beide Männer ruckartig den Kopf herum und sahen mich stirnrunzelnd an. Vier misstrauische und peinlich berührte Augen starrten mich an. Sie vermehrten sich, bis überall im Laden Augen schwebten, die mich strafend ansahen. Ich erstarrte, das Schokoladenstück in der Hand, auf halbem Weg zu meinem geöffneten Mund.
»Die Schokolode war offen, ammu Ali. Be choda, sie war offen!«
Mein Vater räusperte sich und begann so laut zu atmen, dass ich trotz der Entfernung die Luft durch seine Lungen rauschen hörte. »Sheyda dschan, wir essen keine Dinge, für die wir noch nicht bezahlt haben«, sagte er mit beherrschter Stimme, jede einzelne Silbe betonend.
Ich blickte zu Agha Ali, der mich verständnisvoll anlächelte und gleichzeitig darüber nachzudenken schien, was er sagen sollte.
Meine Eltern hatten mir einmal erzählt, dass einem, wenn man die Unwahrheit sagt, die Stirn knallrot anläuft und in Leuchtschrift das Wort »Lügner« darauf erscheint. Von da an trug ich das Haar offen und versteckte meine Stirn hinter einem schützenden Pony, der mir, selbst wenn ich ein Kopftuch trug, ins Gesicht fiel.
»Ich wollte nicht –«, stammelte ich. Doch ich beendete den Satz nicht, sondern strich stattdessen mein Haar beiseite und rief: »Seht! Seht her! Ich sage die Wahrheit.«
Die beiden Erwachsenen blickten einander überrascht an, vielleicht auch ein wenig belustigt von meinem theatralischen Auftritt.
Das Stück Schokolade, das in meiner schwitzigen Hand zu schmelzen begonnen hatte, fiel zu Boden.
Ich blickte fassungslos auf meine unschuldige Beute und sah für einen kurzen Moment unzählige Splitter in alle Richtungen davonstieben wie hungrige Ameisen, die sich mit allem, was sie tragen konnten, davonmachten und sich unter Regalen, staubigen Teppichen und in Abflüssen verkrochen.
Ich hätte mich am liebsten auch verkrochen. Also ließ ich mich wie ein Stein zu Boden fallen. Ich landete auf dem Gesicht und gab keinen Ton von mir, nicht mal ein »Aua«. Ich lag ganz still da, atmete und wartete, dass mein Vater wegging, wartete, dass ich aus dieser peinlichen Situation erwachte, wartete, dass jemand in den Laden kam und die beiden Männer ablenkte, damit ich mich hinausschleichen und nach Hause rennen konnte. Ich lag da und wartete, dass auch ich in tausend Splitter zersprang und verschwand.
Agha Ali und mein Vater kamen angelaufen. Agha Ali zog mich hoch und legte mir die Hände auf die Schultern. »Alles in Ordnung, Sheyda chanum. Alles in Ordnung, asisam. Du kannst die Tafel Schokolade mit nach Hause nehmen. Ist doch nur ein dummes Stück Schokolade, mein Kind. Komm, nimm noch mehr Schokolade mit nach Hause, schließlich ist heute Shab-e Yalda, Wintersonnenwende, und wir alle haben einen Haufen Süßigkeiten verdient.«
Mein Vater drehte mich herum, um sich mein Gesicht anzusehen, und wischte mir mit dem Daumen zwei Blutstropfen von der Unterlippe. Dann schob er mir die Lippen auseinander, als wäre ich ein Pferd, dessen Gesundheit er überprüfen wollte, untersuchte mein Zahnfleisch und vergewisserte sich, dass kein Zahn abgebrochen war.
Nachdem er festgestellt hatte, dass alles in Ordnung war, ließ er mich los.
Ich schaute nach rechts und nach links wie ein Muslim nach dem Gebet, erst zu Agha Ali, der leicht lächelte und mir eine Tafel Schokolade hinstreckte, dann zu meinem Vater, der ganz und gar nicht lächelte.
Ich brüllte meinen Vater an: »Be choda, die Schokolade war schon offen.« Dann stürmte ich mit flatterndem Kopftuch aus dem Laden. An der Straßenecke blieb ich stehen.
Was soll ich sagen, er glaubte mir nicht. Das Einzige, was mein Vater zu mir sagte, als er an der viel befahrenen Kreuzung ankam, war, dass er mich streng bestrafen würde, sollte ich jemals wieder etwas stehlen. Wir gingen zusammen zurück nach Hause. Ich trug die Plastiktüte voller Schokolade und anderer nutzloser Dinge, die mein Vater aus Scham gekauft hatte, als Entschuldigung für mein Fehlverhalten.
»Ich dulde keine Diebe unter meinem Dach, verstanden?«
Er zerrte unsanft an meinem schmalen Körper, als er mir half, die Straße zu überqueren und über die Bäche zu springen, die durch die Rinnsteine liefen.
Was mir mein Vater leider nicht erklärte, war, wen ich um Erlaubnis fragen sollte, bevor ich etwas nahm. Das erklärte mir erst meine Mutter nach dem Vorfall mit der schwarzen Katze in Dr. Fereyduns Sprechzimmer.
Doch die Zeiten, in denen ich mich an fremden Sachen vergriffen habe, sind lange vorbei. Im Gefängnis sitze ich aus einem ganz anderen Grund. Manchmal frage ich mich, warum meine Eltern mich eigentlich nie in Schutz genommen haben, vor allem mein Vater nicht, der doch genau wusste, wie es sich anfühlt, ununterbrochen verleumdet und als Bösewicht abgestempelt zu werden. Mein Leben lang haben sich immer nur Fremde für mich eingesetzt. Nur sie haben meine Absichten erklärt, meine Absichten verstanden, mich verstanden. Vielleicht lag das daran, dass die Fremden nicht mit mir unter einem Dach leben mussten und nicht darunter zu leiden hatten, dass sie meine Eltern waren. Sie konnten nach der Begegnung mit mir einfach nach Hause zu ihren friedlichen Familien gehen und ihren wohlerzogenen Kindern Geschichten über böse Kinder wie mich erzählen, Kinder, die ihren Eltern und Gott den Gehorsam verweigerten. Sie konnten ihnen erzählen, was diese bösen Kinder für eine Zukunft erwartete, dass sie nämlich zu bösen Erwachsenen heranwuchsen, die Autos klauten und Pulver schnupften, das zwar weiß, aber trotzdem dreckig war.
Ich frage mich, ob es stimmt, was die Leute sagten: Dass die Menschen, die dich jeden Tag sehen, die mit dir zusammenleben, die mit dir essen, mit dir verreisen und mit dir beten, dich am besten kennen. Meine Eltern haben mich nie verstanden. Vielleicht war das das einzige wirkliche Trauma meiner Kindheit. Denn ich wollte unbedingt verstanden werden. Ich wollte, dass die beiden Menschen, die ich am meisten liebte, mir zeigten, wo es langging. Doch sie wollten etwas anderes. Sie wollten vom jeweils anderen verstanden werden und hatten keine Zeit für mich. Sie wollten wissen, warum und wann und wie, sie wollten große Antworten auf große Fragen. Und ich war nur eine winzig kleine Frage ohne Fragezeichen.
Als ich an jenem Tag nach Hause kam, in mein Zimmer lief und mich vor den Spiegel stellte, fiel mein Blick auf das Stück Schokolade, das an meiner Stirn klebte. Den ganzen Nachhauseweg über hatte mir mein Schatz im Gesicht gepappt. Ich entfernte das klebrige Stück und schob es mir in den Mund. Dann leckte ich mir die Finger ab und verrieb den Fleck, bis meine Stirn ganz rot war. Ich war gezeichnet. Mein Vater hatte mich also doch bestraft. Er hatte mich als Lügnerin gebrandmarkt.
Heute frage ich mich, was es wohl zu bedeuten hat, dass sich der Vorfall an Shab-e Yalda ereignete, der Nacht, in der Mithra geboren wurde, der zoroastrische Gott der Wahrheit. Ich frage mich, ob die Tatsache, dass es die längste und dunkelste Nacht des Jahres ist, irgendwelche Auswirkungen darauf gehabt hat, was für ein Mensch ich geworden bin.
Solche Dinge, solche scheinbar unwichtigen Dinge, spielen nämlich eine große Rolle. Ich war wahrhaftig rettungslos verloren.