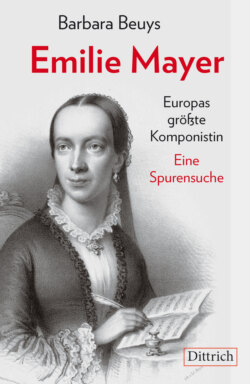Читать книгу Emilie Mayer - Barbara Beuys - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFanny Hensel, geborene Mendelssohn, hatte als Kind wie ihr Bruder Klavierunterricht bekommen und beherrschte das Piano souverän. Felix spielte außerdem Geige, nichts Besonderes für einen jungen Musiker. Und wenn Fanny dieses Instrument auch gerne gespielt hätte? Auf ihrem berühmten Genter Altar wiesen um das Jahr 1430 die Brüder Jan und Hubertus van Eyck musizierenden Engeln eine dominierende Rolle zu. Die prächtigen Flügel am Rücken eng angelegt, spielen die himmlischen Wesen ebenso Harmonium wie Geige. Für die irdischen Zuschauer – ob Frauen oder Männer – war das über Jahrhunderte eine Selbstverständlichkeit. 1783 sorgte der Pädagoge, Komponist und Pfarrer Karl Ludwig Junker mit seinem Buch »Vom Kostüm des Frauenzimmer Spielens« dafür, dass mit dem aufgeklärten Jahrhundert für Frauen in der Musik andere Töne aufgezogen wurde.
Ausgangspunkt seiner Epistel war der Grundsatz der Ungleichheit von Männern und Frauen in der Musik, angefangen bei den Instrumenten: »Es giebt Instrumente, die mehr, andere – die weniger sich fürs Frauenzimmer schicken.« Zu denen, die sich nicht schickten, gehörte die Geige: »Wenn wir ein Frauenzimmer die Violin, das Horn, oder den Baß, spielen sehen, so empfinden wir ein gewisses Gefühl des Unschicklichen …« Wir – das sind die Herren der Schöpfung, die Fanny Hensel so in Rage versetzten und selbstverständlich ihre körperliche Stärke auch im Bereich der Instrumente ausspielten. Die Saiteninstrumente, so der Pfarrer Junker, erfordern »oft eine schnelle, heftige, gewaltsame Bewegung« und die stehe mit der »anerkannten Schwäche des zweyten Geschlechts gar in keiner Verbindung«. Und weil der »Stand des Weibes Ruhe« ist, kommt für sie nur das Klavier infrage, vielleicht noch Laute, Zither und Harfe.
Aber nun redet sich der Pfarrer doch noch in Rage, weil die Vorstellung einer Frau am Cello seine Fantasie an- und aufregt. Die »Stellung und Lage des Körpers« bei diesem Instrument vertrage sich nicht »mit dem Begriff des sittlichen Anstandes«, weil sie »in der Seele gewisse Bilder und Nebenideen« erweckt. Junker beschreibt bis ins Detail ein Frauenzimmer, das Cello spielt: »Sie kann hiebey zwey Übelstände nicht vermeiden. Das Überhangen des Oberleibs und also das Pressen der Brust; und denn eine solche Lage der Füße, die für tausende Bilder erwecken, die sie nicht erwecken sollten; …«
Der Gottesmann kennt sich aus in der Seele des starken Geschlechts, wo sexuelle Fantasien bei Tausenden ausgelöst werden, wenn allein die weiblichen Füße – zum größten Teil von einem wallenden Kleid bedeckt, das natürlich über die Knöchel geht – neben dem Cello sichtbar werden. Dass eine Frau die Beine spreizt, um das große Instrument in den Griff zu bekommen, ist ein Tabu, dass der Fantasie des Lesers stillschweigend überlassen wird. Ein langlebiges Tabu: Noch im 21. Jahrhundert sitzen Männer breitbeinig in Straßenbahnen und Talkshows, während Frauen ihre Beine sittsam zusammenpressen.
Der neue Blick auf die Instrumente, wenn es um die Geschlechterfrage geht, ist der Einstieg in eine Musik, die ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eine revolutionäre Umdeutung erfährt. Bis dahin waren Töne für den Kenner, egal ob männlich oder weiblich, ein Mittel, fantasiereich etwas nachzuahmen – Blitz und Donner, die Vier Jahreszeiten und ebenso Gefühle. Nun wird die Vorstellung darüber, was Musik bedeutet, auf den Kopf gestellt: Musik ist nicht mehr Nachahmung, sondern der individuelle Ausdruck des Menschen, der die Töne zum Klingen bringt. Sie erzählt von den persönlichen Empfindungen eines Menschen, der sich mit seinem innersten Wesen in der Musik ausdrückt. Damit ist die Grundlage für eine unterschiedlich bewertete Musikkultur zementiert, die – wie der Mensch an sich – in männlich und weiblich aufgeteilt wird.
Ein zentraler Baustein jeder Komposition wird mit den Tonarten Dur und Moll gelegt, bis heute »Tongeschlechter« genannt. Mitte des 18. Jahrhunderts erklärt eine Anleitung zum Komponieren, Moll sei von Dur so abhängig wie Eva von Adam in der biblischen Schöpfungsgeschichte. Es folgt der Vorschlag, Dur – das mit »frisch und freudig« assoziiert wird – als modus masculinus und Moll, das für »gelassen und so zu reden weiblich« stehe, als modus femininum zu bezeichnen.
Was hier noch höflich vorgeschlagen wird, bringt Jean-Jacques Rousseau zur gleichen Zeit knallhart auf den Punkt. Gemäß seiner abwertenden Geschlechterdefinition, die er in »Émile« wenig später ausbreiten wird, markiert die Ikone der Aufklärung 1758 in seinem »Lettre à d’ Alembert«, was die Musik männlicher Komponisten von weiblichen Versuchen unterscheidet – und weitet das Urteil gleich auf die ganze Kunst aus: »Die Weiber, im Ganzen genommen, lieben keine einzige Kunst, sind in keiner einzigen Kenner – haben durchaus kein Genie.« Vielleicht können ihnen in der Musik »kleine Arbeiten noch gelingen«, aber keinesfalls erfüllt sie »jenes himmlische Feuer, das die ganze Seele erwärmt, jenes Genie, das alles verzehrt und mit sich fortreißt« und die männlichen Künstler antreibt. Den »Weibern wird alles das stets mangeln«. Ihre Werke werden »kalt und niedlich seyn, wie sie selbst sind. Geist werden sie haben … aber niemals Seele«.
Die Konsequenz der biologischen Festlegung von Frauen und Männern für die Musik zieht der Philosoph und Schriftsteller Christian Friedrich Michaelis, der hervorragend Klavier und Geige spielt, 1795 in seiner Schrift »Ueber den Geist der Tonkunst«. An erster Stelle steht die Musik mit männlichem Charakter: voller Energie, mutig, fröhlich und ihre Quelle ist ein »lebhaftes Kraftgefühl«. Im Kontrast dazu verliert sich die Musik »weiblichen Charakters« im »sanften Spiel der Empfindungen«. Der Philosoph spricht das Urteil über diese Musik ohne zu zögern: »Sie ist weder witzig noch humoristisch; denn hierzu würde … freier Schwung der Phantasie, kurz, eine sich selbst erkennende, frei bestimmte Thätigkeit erfordert, welche an sich der weiblichen Kunst fremd ist.«
Die innere Logik ist nachvollziehbar: Wenn sich in der Musik eine Persönlichkeit manifestiert, dann ist sie eine Charakterfrage. Und die ist seit Rousseau von anerkannten Dichtern, Denkern und wissenschaftlichen Autoritäten bestätigt und schließlich im Brockhaus-Lexikon einvernehmlich festgeschrieben. Den Charakter von Männern und Frauen hat die Natur auf ewig durch ihre biologische Disposition festgelegt: stark, tatkräftig, mit abstraktem Denkvermögen und deshalb für den Aufritt in der Öffentlichkeit bestimmt, hat der Mann vom Schicksal den edleren Teil erhalten. Entsprechend wird er in diesem Geist auf allen Gebieten der Kunst und also auch in der Musik kreativ sein. Die Frauenzimmer, – nicht grundlos als zweites Geschlecht definiert, – haben den kleineren Verstand, sind schwach und von der Natur lebenslang als Mütter geprägt. Sie können neben dem Kindererziehen in der Musik gerade einmal »kleine Arbeiten« zustande bringen. Weiblichkeit und kreatives Schaffen schließen einander aus.
Kein Wunder, dass Ernst Brandes 1805 in seinen »Betrachtungen über das weibliche Geschlecht« triumphierend fragt: »Was ist in der Musik, der Kunst … von den Weibern geliefert? … Hat das Geschlecht wohl einen einzigen Componisten, der gekannt werden kann, aufzuzeigen?« Für den Juristen Brandes ist eine Antwort überflüssig. Doch er ist schlecht informiert oder will es nicht wissen.
Emilie Mayer in Friedland wusste es möglicherweise besser, denn hier auf dem Land, im benachbarten Herzogtum Mecklenburg-Schwerin – ab 1818 Großherzogtum – gab es eine Ausnahme: die Pianistin, Sängerin und Komponistin Sophie Westenholz, geb. Fritscher. Das wird sich herumgesprochen haben und auch Carl Heinrich Ernst Driver, der als Organist der zwei großen Kirchen die Menschen in Friedland mit Musik versorgte, zu Ohren gekommen sein. Kaum vorstellbar, dass er seiner Klavierschülerin in der Ratsapotheke, deren Kompositionstalent er nicht klein hielt, sondern fröhlich anfachte, nicht von dieser Ausnahme-Frau erzählt hat.
Im Gegensatz zu Emilie Mayer, aber im Einklang mit den meisten Frauen, denen es gelang, sich gegen den Zeitgeist auf musikalischen Bühnen durchzusetzen, kam Sophie Westenholz aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater war Organist in Neubrandenburg. Die musikalische Begabung der kleinen Sophie fiel am herzoglichen Hof von Mecklenburg-Schwerin auf. Als Sechzehnjährige wurde sie 1775 in die Hofkapelle aufgenommen, zwei Jahre später heiratete sie den Kapellmeister der Hofkapelle.
Acht Kinder kamen in den nächsten elf Jahren zur Welt, Doch auch als Mutter blieb die Sängerin und Pianistin Westenholz festes Mitglied der höfischen Unterhaltung. 1789 starb ihr Mann, da begann sie eine Karriere als Pianistin, die sie unter anderem nach Berlin und Leipzig, Kopenhagen und Hamburg führte. Zugleich hatte sie bis 1821 Einfluss auf die Hof- und Kirchenmusik, leitete zeitweilig die Hofkapelle vom Klavier aus und brachte neben Mozart und Haydn ihre eigenen Werke zur Aufführung.
Als Sophie Westenholz 1838 starb, war es gerade zehn Jahre her, dass die neunjährige Clara Wieck, als Wunderkind umjubelt, zusammen mit einer Pianistin im renommierten Leipziger Gewandhaus vierhändig Klavier spielte. Wie ihre Kollegin in Mecklenburg-Schwerin war Clara Wieck zur Pianistin ausgebildet worden: von ihrem eigenen Vater, einem Klavierlehrer, fest entschlossen, aus seiner Tochter eine Klaviervirtuosin mit Seele zu formen. 1830 gab sie in Leipzig ihr erstes Solokonzert und begleitete auch eine eigene Liedkomposition. 1832 ging der Vater mit seiner Tochter auf Tournee nach Paris. Die Pianistin Clara Wieck wurde europaweit bekannt.
1835 ein grandioser Höhepunkt: Unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy spielte das Leipziger Gewandhausorchester Clara Schumans Klavierkonzert a-Moll, op. 7, die sechzehnjährige Komponistin saß am Klavier. Die Musikkritik war fast sprachlos: »… hörte man das Werk ohne den Schöpfer zu kennen, nie würde man dem Gedanken Raum geben, es sei von einer Dame geschrieben.«
Während der überwältigenden Erfolge wuchs bei der jungen Clara eine große Liebe heran. Seit 1830 gehörte der zwanzigjährige Robert Schuman zum Haushalt der Wiecks in Leipzig. Er wollte Pianist werden. Doch seine rechte Hand verweigerte sich, und Schumann konzentrierte sich aufs Komponieren. Clara war sechzehn, als zwischen ihr und Robert der erste Kuss getauscht wurde. Obwohl der Vater entschieden gegen eine Heirat war, blieb sie ihrer ersten Liebe treu. Und Robert Schumann suggerierte, dass die Kunst des Komponierens sie beide zu einer höheren Einheit verband: »Du vervollständigst mich als Componisten, wie ich Dich…«
Aber dieses Ideal einer Zweiheit in der Einheit stärkte Clara nicht, es nagte am Selbstwertgefühl der Frau und Komponistin. Ihrem Tagebuch vertraute sie an: »Ich tröste mich immer damit, dass ich ja ein Frauenzimmer bin, und die sind nicht zum componieren geboren. Ich zweifle ganz an mir …« Fast wie ein Akt der Selbstvergewisserung lässt sich eine mehrmonatige Reise im Frühjahr 1839 nach Paris deuten. Sie reist allein, unerhört für eine junge Frau. Alle Selbstzweifel sind verflogen, als Clara nach einem Konzert im traditionsreichen Erard’schen Salon mitten in Paris, wo sich die musikalische Elite trifft, im März an Robert schreibt: »Mein Concert habe ich gestern ganz glücklich überstanden, … wahrhaftes Furore hab ich gemacht, wie man sich lange bei keinem Künstler erinnern kann. … mein Renommée ist gemacht, und das ist mir genug.«