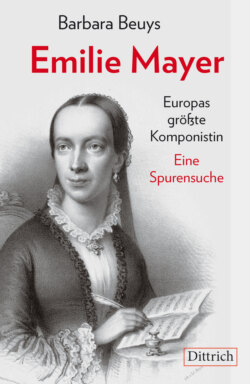Читать книгу Emilie Mayer - Barbara Beuys - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3 Gebet Euren Töchtern eine männliche Erziehung. Der Vater will Emilies Persönlichkeit nicht brechen 1820–1831
ОглавлениеIm Mecklenburgischen Friedland hat der Ratsapotheker Mayer zur gleichen Zeit keine Bedenken, dass der Organist Driver, den er als Klavierlehrer für seine Tochter Emilie engagiert hat, das musikalische Talent des noch nicht zehn Jahre alten Mädchens kräftig fördert. In ihren »Erinnerungen« erzählt die Stettiner Kaufmannstochter Marie Silling, die mit einer Nichte von Emilie Mayer befreundet war, dass Drivers Beifall für die erste Komposition – ein Walzer – seine Schülerin beflügelte: »… die kleine Künstlerin komponierte bald nicht nur zu Hause, sondern in den Zwischenstunden der Schule, auf den Spaziergängen, allüberall entstanden ihre musikalischen Improvisationen …«. Die nachträgliche Überhöhung einer bewunderten Frau, fast vier Jahrzehnte nach ihrem Tod erschienen, von einer, die es mit den Fakten nicht so genau nahm?
Der Vergleich mit der »Biographischen Skizze«, die die Schriftstellerin Elisabeth Sangalli-Marr zu Lebzeiten von Emilie Mayer 1877 für die Neue Berliner Musikzeitung verfasst, bestätigt, was unglaublich klingt: »Unter lustigem Geplauder in den Zwischenstunden der Schule, auf ihren Spaziergängen, allüberall componirte sie ihre Lieder, Variationen und Sonaten.« Als 1888 »Frauen als schaffende Tonkünstler – ein biographisches Lexikon« erscheint, wird im Beitrag über Emilie Mayer ihre frühkindliche Begabung bestätigt: »In ungetrübtem Glücke kindlichen Frohsinns flohen die Schuljahre dahin, während welcher Zeit eine große Anzahl von Klavierstücken entstanden war.« Wie nebenbei berichten alle Quellen: dass Emilie in ihrer Kindheit zur Schule ging.
Das macht stutzig, denn Friedlands einziges Gymnasium, die traditionsreiche ehemalige Gelehrtenschule, stand nur dem männlichen Geschlecht offen, das nach dem Gesetz der Natur tatkräftig in der Öffentlichkeit wirkte oder in den Wissenschaften – dank männlichem Abstraktionsvermögen – forschte. Der Lebensraum der Frau war die Privatsphäre, ihr Beruf Kinder zu gebären und aufzuziehen, darauf war ihr kleines weibliches Denkvermögen angelegt. Nach diesen unterschiedlichen Standards blieb den Mädchen in Preußen bis ans Ende des 19. Jahrhunderts eine gleichberechtige gymnasiale Bildung versperrt; die Universität war ihnen bis 1908 verschlossen. Der Ausweg, der vereinzelt im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts Gestalt annahm – allerdings nicht in Friedland – war die Höhere Töchterschule.
Dass die emanzipierte Elisabeth Sangalli-Marr, die in ihren Büchern und Schriften für eine gleichberechtigte weibliche Bildung eintrat, der kleinen Emilie Mayer wider besseres Wissen eine Schulzeit andichtet, die es nicht gegeben hat, ist kaum glaubhaft. Und dass ein angesehenes Lexikon wenig später diese Information wiederholt, obwohl sie für die Leserinnen nicht nachvollziehbar ist, ist ebenso undenkbar.
Bisherige Beiträge zur Biografie von Emilie Mayer vermuten, dass sie – »wahrscheinlich« – von Privatlehrern unterrichtet wurde, von Schule keine Rede. Das mag für ihre späteren jugendlichen Jahre zutreffen. Die Aussagen der zwei zeitgenössischen Quellen zu Emilies Kindheit erlauben über ein Familienleben zu spekulieren, wo die väterliche Autorität auf liberale reformfreudige Ansätze baute. Das würde die große Politik mit dem Alltag im kleinstädtischen Friedland verbinden. Denn Emilie Mayer wuchs in einer Zeit auf, in der die Abfolge von Hoffnungen und Enttäuschungen das Leben der bürgerlichen Eliten, zu denen der Ratsapotheker zählte, prägte.
Der Schlachtruf der Französischen Revolution von 1789 erschütterte die feudal-adligen Gesellschaften in den westeuropäischen Ländern und Fürstentümern bis ins Mark. Wenngleich die Monarchen dort weiterhin fest auf ihren Thronen saßen und nirgendwo sonst Könige oder Fürsten aufs Schafott geschickt wurden, forderte eine bürgerliche Elite neue Maßstäbe für eine moderne Gesellschaft: nicht adlige Geburtsprivilegien, sondern individuelle Bildung, Leistung und persönlicher Einsatz sollten über den Rang und den Einfluss innerhalb der Gesellschaft entscheiden. Als Preußen unter napoleonischer Übermacht 1806 zusammenbrach, sahen die Modernisierer, die es auch in adligen Kreisen gab, in der Krise ihre Chance: Aus dem Obrigkeitsstaat sollte durch liberale Reformen eine aufgeklärte Gesellschaft entstehen.
Die Reformer waren sich einig: Bildung – vor allem in den ärmeren und ländlichen Schichten – war der Schlüssel zu einem modernen Staat. Ein Verfechter neuer Strukturen im preußischen Schulsystem war Wilhelm von Humboldt, ab 1809 im Innenministerium in Berlin für den »öffentlichen Unterricht« verantwortlich. Pädagogisches Ziel müsse es werden, in den Grundschulen selbständiges Denken zu vermitteln, »das Menschenkind zum Menschen zu bilden«.
Seit 1796 gab es in Friedland eine einklassige Volksschule, die 1805 in »Bürgerschule« umbenannt wurde. Neben dem Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen nahm die Unterweisung im Christentum weiterhin den entscheidenden Platz ein. Als Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 von einer europäischen Allianz besiegt wurde, hofften die Reformer in Preußen – wie in den anderen deutschen Staaten – endlich neue pädagogische Programme durchzusetzen. Doch zwischen September 1814 und Juni 1815 gelang es den feudalen Mächten auf dem Wiener Kongress, wo über Europas Zukunft ohne Napoleon verhandelt wurde, die Zustände der alten vor-revolutionären Zeit wieder herzustellen. Auch in Preußen setzte sich die Restauration durch. Sie hatte in König Friedrich Wilhelm III. ihren stärksten Verbündeten, und die angepeilten gesellschaftlichen wie politischen Reformen landeten um 1819/20 endgültig im Mülleimer der Geschichte.
Ärzte und Pastoren, Lehrer und Apotheker gingen nicht auf die Barrikaden. Es begann das Biedermeier, der Rückzug des Bildungsbürgertums ins gemütliche Heim, die private Sphäre war der Lebensanker. Aber die Hoffnung auf eine Gesellschaft, in der Leistung, Persönlichkeit und Eigenverantwortung gefragt waren und nicht stummer Untertanengehorsam, verband sie weiter. Weil Vernunft zu den bürgerlichen Tugenden zählte, konnte es im privaten Bereich der Bürger durchaus flexible Lösungen geben.
Eine väterlichen Abweichung von den starren Regeln einer Standesgesellschaft hat Emilie Mayers Zeitgenosse Theodor Fontane zum Thema Schule am eigenen Leib erlebt und in »Meine Kinderjahre« beschrieben. Der Apothekersohn war acht Jahre alt, als er mit seinem Vater im Juni 1827 von Neuruppin nach Swinemünde, im östlichen Pommern am Stettiner Haff gelegen, aufbrach, wo eine Apotheke auf den neuen Besitzer wartete. Die Mutter würde im Herbst aus Berlin nachkommen. Am neuen Lebensort angekommen, musste der Vater entscheiden, in welche Schule der Sohn gehen sollte. Als der Vater erfuhr, es gebe in Swinemünde nur eine Schule, die Stadtschule, überlegte er nicht lange: »… da diese Stadtschule die einzige ist, so ist sie auch die beste.« Das schien ihm vernünftig; ob »standesgemäß« spielte keine Rolle.
Die Frau des Apothekers war anderer Meinung: »Als aber gegen den Herbst hin meine Mutter eintraf und mich mit den Holzpantoffeljungens aus der Schule kommen sah, war sie außer sich … denselben Tag noch erfolgte meine Abmeldung.« Der Achtjährige erhielt von nun an Unterricht bei Vater und Mutter, bevor er 1832 in Neuruppin ins Gymnasium kam.
Quellen sprechen dafür, dass Apotheker Mayer in Friedland um 1820 für seine kleine Tochter Emilie eine ähnliche Entscheidung traf. Sie besuchte, statt als Bürgertochter nach dem üblichen gesellschaftlichen Standard zu Hause von Privatlehrern unterrichtet zu werden, erst einmal die Bürgerschule, eine Volksschule, grundsätzlich für die Kinder der unteren Schichten eingerichtet. Emilie fühlte sich dort offensichtlich wohl und hatte Schulfreundinnen, die bewundernd erlebten, wie in den Pausen und beim Spazierengehen Kompositionen entstanden.
Für den Schulbesuch wie für die musikalische Freizeitgestaltung von Emilie Mayer gilt, dass Klavierlehrer Driver und ihr Vater sich einig waren, den standesgemäßen pädagogischen Vorgaben für Frauen, von Männern in zahlreichen Schriften seit Jahrzehnten festgelegt, nicht zu folgen. Der Ausgangspunkt für diese strikten Ratschläge ist die von der Natur ausgehende radikale Unterscheidung der Geschlechter, die das Lebensschicksal von Männern und Frauen unabänderlich prägt. Der starke, tatkräftige Mann »muss hinaus in feindliche Leben«, das er aufgrund seiner männlich-abstrakten Denkfähigkeit gestalten kann. »Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau« – mit einem begrenztem Verstand, der ausreicht, Kinder zu gebären, zu erziehen und dem Ehemann ein gemütliches Heim zu schaffen.
Es gab zur weiblichen Erziehung mutige Stimmen gegen den Strom. 1784 klagt das »Damenjournal« im ersten Band des »Magazins zum Besten der Erziehung armer Mädchen« an: »Man betrachtet uns, als hätten wir einen anderen Verstand als das Männergeschlecht und als wäre die geringste Ungleichheit in einigen Theilen des Körpers ein sicheres Kennzeichen auch der Ungleichheit der Seele.« Eine grundlegend falsche Sicht, weshalb die Eltern aufgefordert werden: »Gebet euren Töchtern eine männliche Erziehung, lasset ihnen die Kentnisse beybringen, zu deren Erlernung ihr eure Söhne anzuhalten pflegt … mit einem Wort, es sey kein Unterschied zwischen der Erziehung eurer Töchter und eurer Söhne.«
Der Jurist Ernst Brandes vertritt 1787 in seiner Schrift »Ueber die Weiber« die gegenteilige Meinung und hat die Mehrheit auf seiner Seite: »Der Mann muss um das Vergnügen, das ihm die Wissenschaften geben, sich mit diesen beschäftigen; … das Weib darf das nicht. Selbständigkeit ist nicht ihre Bestimmung, sondern Abhängigkeit.« Zwanzig Jahre später formte Caroline Christiane Louise Rudolphi in ihrem »Gemälde weiblicher Erziehung« aus dieser Vorgabe strenge pädagogische Grundsätze: »Es darf im Mädchen der herrische Mannessinn nicht aufkommen … Ihr Wesen soll sich zu weicher Biegsamkeit formen.« 1811 ließen die »Feyerstunden – Eine Quartalschrift zur Aufklaerung des Verstandes und Bildung des Herzens der Jugend beyderley Geschlechts« alle Höflichkeit fahren: »Das, was man heutzutage ein gelehrtes Frauenzimmer nennt, ist das abgeschmackteste Ding, welches man sich vorstellen kann …«
Das waren, mehr oder wenig höflich formuliert, für gebildete bürgerliche Eltern und Erzieher die vorherrschenden pädagogischen Grundsätze, um Töchter und Mädchen von früh auf in die Lebensbahnen zu lenken, die dem zweiten Geschlecht zustanden. Klavierlehrer Driver und Ratsapotheker Mayer wussten darum und hatten zugleich eine genaue Vorstellung, dass keine Kunst so viel abstraktes Denkvermögen und eine unabhängige Kreativität voraussetzte wie die Musik. Emilie bewies mit ihrem Komponiertalent, dass sie mit beidem reich ausgestattet war. Die fröhliche Leichtfüßigkeit, mit der sie aus eigenem Antrieb Walzer und Sonaten komponierte, zu unterdrücken, hätte bedeuten, ihre Persönlichkeit zu brechen. Alles spricht dafür, dass der Musiker Driver im Einklang mit dem Vater das Mädchen nicht den standesgemäßen Erziehungsregeln unterwarf.
Vielleicht ließen sich die beiden Männer auch deshalb mitreißen, wenn Emilie am Klavier saß und ihre eigenen Stücke spielte, weil die Musik während der Epoche der Restauration einer jener Räume blieb, in dem die Bürger sich ohne Gängelei durch Staat und Kirche eine eigene Welt schufen. Im Reich der Kultur, das sie nach ihren Vorstellungen gestalteten, erlebten sie Genuss und Vergnügen fern von höfischem Protokoll und starren Zeremonien – und ganz besonders intensiv in der Musik.