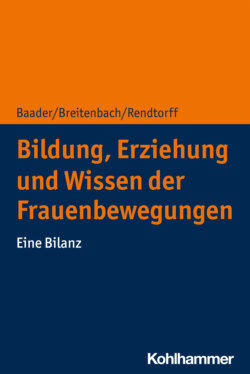Читать книгу Bildung, Erziehung und Wissen der Frauenbewegungen - Barbara Rendtorff - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Frauenbewegungen
ОглавлениеEbenso vielschichtig und uneinheitlich wie der Begriff »Feminismus« ist die Bezeichnung »Frauenbewegung«. Eine Kategorisierung als »Bewegung« kann stets nur im Nachhinein als Etikett vergeben werden, wenn sich bereits Personen in größerer Menge für ein bestimmtes Ziel oder gegen bestimmte politische Bedingungen zusammengefunden haben, sich zumindest rudimentär auch organisiert und ihre Aktivitäten über einen längeren Zeitraum hinweg artikuliert haben und so sichtbar werden. Damit dies funktioniert, brauchen Bewegungen auch so etwas wie eine »kognitive Konstitution« (Gilcher-Holtey 2005: 11), das heißt identitätsstiftende Themen und Praktiken, »ein symbolisches System der Selbstverständigung und Selbstgewissheit« (ebd.), die für den Mobilisierungsprozess bedeutsam sind. Diese bedürfen, neben den kognitiven Rahmungen, auch immer wieder besonderer Gelegenheitsstrukturen, innerhalb derer die Forderungen der Bewegung öffentlichkeitswirksam vorgetragen werden und ihren Ausdruck finden. Diese Merkmale treffen auf beide Frauenbewegungen zu. Beide haben sich organisiert, haben spezifische Protestformen entwickelt, Treffpunkte, Räume und Publikationsorgane geschaffen, agierten transnational und haben Theoriebildung und Akademisierung in Gang gesetzt und ihre Themen und Forderungen so mittel- bis langfristig eingebracht. Beide Frauenbewegungen haben dabei in ihren Themen unterschiedliche Akzentuierungen gehabt, aber es gibt auch eine Reihe von Gemeinsamkeiten und Berührungspunkten. Diese arbeiten wir in den einzelnen Kapiteln zu den zentralen Themen heraus. Die erste Frauenbewegung setzte ihre Akzente auf Bildung, Erwerbstätigkeit und Rechte (Bock 2005: 169), die zweite auf Formen der Wissensproduktion, Hausarbeit, Sprache, Körper, Gewalt, Sexualität und Formen der Selbstbestimmung in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Sie fokussierte sich stark auf »Individualisierung, Subjektwerdung, Subjektivität und Raum zur Selbstentfaltung« (ebd.: 323). Sie erfreute sich auch provokativer Protestformen, sie forderte Autonomie und brach »zuweilen unter Mühen – mit der Neuen Linken« (ebd.: 321).
Diese, wie auch die männlichen Politiker und Wissenschaftler, taten sich schwer, die Frauenbewegung überhaupt als eine »Bewegung« anzuerkennen (vgl. Kontos 1986), und es dauerte, bis sie nicht mehr nur als bürgerlich-reformistische Strömung eingeschätzt, sondern ihre »Patriarchatskritik« als zentraler und die politisch unterschiedlich positionierten Gruppen verbindender politischer Topos erkannt wurde (ebd.: 36).
Die erste Frauenbewegung in Deutschland verfügte über eine übergreifende zentrale Organisation, den Bund deutscher Frauenvereine (BDF; gegründet 1894). Damit stand die Vereinsstruktur als Organisationsform im Mittelpunkt. In den Vereinen waren die Frauen Mitglieder, so dass ihre Mitgliedschaft, auch für die historische Erforschung, zuordenbar war. Die zweite Frauenbewegung hingegen hing eng mit den internationalen sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre zusammen und war stark projektförmig organisiert, auch wenn vielfältige Vereine, wie etwa vereinsförmig organisierte Frauenzentren, Frauenbuchläden und Frauenbildungsstätten, dabei eine Rolle spielten (siehe die folgenden Kapitel). Ihre Bewegungs- und Projektförmigkeit äußerte sich in fluiden Organisationsformen und in zahlreichen damit verbundenen Konflikten. Insgesamt kann für die zweite Frauenbewegung an die Forschungen zu sozialen Bewegungen mit ihren spezifischen Dynamiken und Auseinandersetzungen angeknüpft werden (vgl. Gerhard 2008). Auch die Konflikte sollen Gegenstand dieses Buches sein, denn sie machen deutlich, welches die wichtigen Themen waren, welche unterschiedlichen Positionen damit verbunden waren und wo die Konfliktlinien und Kampffelder lagen und liegen. Konflikte sind Ausdruck von Dynamiken, umstrittenen Themen und Kämpfen um Hegemonie und zeigen, wie um Durchsetzung von Themen, Sichtweisen und Positionen gerungen wird. International agiert und sich an international geführten Debatten beteiligt haben sich beide Bewegungen.
Die zweite Frauenbewegung war auch inhaltlich sehr heterogen. Vieles geschah zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Die theoretische Analyse tendiert dazu, eine inhaltliche, aber auch eine zeitliche und örtliche Ordnung zu schaffen, die Ereignisse nachträglich zu ordnen und damit zu glätten und zu vereinheitlichen (beispielsweise orientierte sie sich an den Geschehnissen in den Großstädten, vor allem Berlin, die Entwicklung in der »Provinz« folgte mit einer gewissen Verzögerung und oft auf andere Art). Die Ziele der Bewegungen waren oft ebenso unklar und unbestimmt wie die Wege zu den unbekannten Zielen (vgl. Rendtorff 2009). Klar war für die Frauen der Frauenbewegung, dass sich sowohl die Verhältnisse als auch die Personen grundlegend verändern müssten und dass es Frauen gelingen würde, diese Veränderungen herbeizuführen. Auch hier kann die Analyse dazu tendieren, das Unbestimmte nachträglich zu konkretisieren. Diese Tendenz einer nachträglichen Systematisierung betrifft ebenfalls die Verbindungen und Verknüpfungen zwischen Frauenbewegung, feministischer Forschung, Geschlechterforschung und pädagogischer Theorie.
Fragen wir nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der ersten und der zweiten Frauenbewegung, so kann, auch wenn dies mit gewissen Vereinfachungen verbunden ist, zunächst gesagt werden, dass beide für die gesellschaftliche Teilhabe von Frauen kämpften. Dabei haben die meisten Gruppen der ersten Frauenbewegung und ihres bürgerlichen Flügels stark an der Idee der spezifischen »Kulturaufgabe« der Frau festgehalten, was zu differenten Konzepten von Bildung für die Geschlechter führte ( Kap. 2 und Kap. 4). Dass die weibliche »Kulturaufgabe« aufs engste mit Mutterschaft und Mütterlichkeit verbunden war, führte bei manchen Protagonistinnen zu einer Distanzierung gegenüber Wissenschaft und Intellektualität, außerdem ließ die Behauptung einer Struktur- und Wesensähnlichkeit von Frauen und Kindern die Zuordnung von Frauen zum Elementarbereich und ihre Beschränkung auf die Mädchenbildung plausibel erscheinen ( Kap. 2). Für die Berufsbildung bedeutete dies etwa, dass Gertrud Bäumer (1873–1954) als wichtige Protagonistin der bürgerlichen Frauenbewegung sich für spezifisch weibliche Berufe aussprach (vgl. Baader 2018a). Zwar hat die zweite Frauenbewegung nicht mehr von der »Kulturaufgabe« der Frau gesprochen, aber gleichwohl immer wieder auch nach einer spezifisch weiblichen Kultur oder weiblichen Sozialformen gefragt (vgl. Rendtorff 2016) und auch die Diskussion um die Zuordnung von Frauen zur frühkindlichen Erziehung weitergeführt (vgl. Breitenbach 2010, 2015). Beide Bewegungen haben spezifische und bis heute weiterwirkende Impulse für eine Modernisierung der öffentlichen Kleinkindbetreuung gesetzt (vgl. Baader 2015). Mit diesen Konstellationen verbundene Fragen setzen sich bis heute, wenn auch mit anderer Begrifflichkeit fort, etwa wenn danach gefragt wird, ob eine größere Beteiligung von Frauen in der Politik den Politikstil verändere oder mehr Mädchen in einer Schulklasse förderlich für die Gruppendynamik seien. Allerdings haben die bürgerlichen Frauen der ersten Frauenbewegung bei ihren diesbezüglichen Überlegungen mit »Mütterlichkeit« argumentiert, so etwa die Pädagogin, Sozialdemokratin, Sozialistin, Europaanhängerin und Kritikerin des Nationalstaates Anna Siemsen (1882–1951), die sich von einer stärkeren Beteiligung von Frauen und des damit verbundenen »mütterlichen« Einflusses eine »Humanisierung« der öffentlichen Sphäre und der Politik erhofft hatte (vgl. Pfützner 2018), während die Aktivistinnen der zweiten Frauenbewegung sich diese Humanisierung eher von einer größeren politischen Sichtbarkeit, Wertschätzung von Frauen und ihrer Arbeit und insgesamt dem Einfluss von Frauen auf die politische und gesellschaftliche Sphäre versprachen.