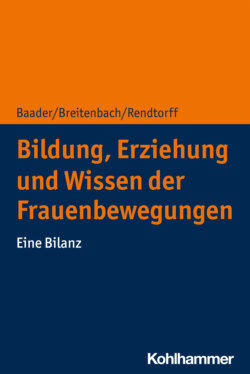Читать книгу Bildung, Erziehung und Wissen der Frauenbewegungen - Barbara Rendtorff - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ausgangslage und Anliegen in den 1970er Jahren
ОглавлениеDer mühsam erkämpfte freiere Zugang zu Bildung, Wissen und akademischen Abschlüssen war durch das NS-Regime wieder weitgehend eingeschränkt worden, aber die Bildungsreformen der 1960er Jahre hatten neue Möglichkeiten eröffnet. Die unter den Stichworten »Bildungskatastrophe« (Picht 1964) und »Bildung als Menschenrecht« (Dahrendorf 1965) geführte Debatte zielte zwar nicht vorrangig auf geschlechterbezogene Gleichberechtigung, hatte aber langfristig immerhin dazu beigetragen, die Bildungsbeteiligung von Mädchen und Frauen deutlich zu erhöhen, indem der Fokus allgemein auf »Chancengleichheit« gelegt wurde, die wiederum exemplarisch an der Benachteiligung des »katholischen Arbeitermädchens vom Land« (Dahrendorf 1965) als soziologische Kunstfigur erörtert wurde. Der Begriff der »Chancengleichheit« wurde im Zuge der Debatte um die sogenannte »Bildungskatastrophe« popularisiert. Dennoch fand die Zweite Frauenbewegung wiederum eine Situation der Ungleichverteilung von Bildungschancen und -wegen vor: Zwar hatten mehr Mädchen Zugang zu höherer Schulbildung und der Anteil der Geschlechter am Besuch des Gymnasiums hielt sich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre mit jeweils 22,5 % die Waage (Hopf 2010: 41f.), aber der Anteil von Studentinnen an den Universitäten betrug noch 1975 nur ein Drittel (Lenz 2008: 207). Schwerwiegender schienen in den Augen der wiederum »frauenbewegten« Frauen der 1970er Jahre jedoch die heimlichen geschlechterbezogenen Botschaften, die sich in den Subtexten, in nebenbei erfolgenden Zuschreibungen oder der Auswahl an Inhalten in Schule und Universität mitteilten und auch die staatlichen Richtlinien bestimmten: Abgesehen davon, dass beim Lehr- und Leitungspersonal der Schulen in Bezug auf Mädchen und Jungen »überkommene Vorstellungen« (Borris 1972: 77) vorherrschten, betonten auch die Lehrpläne aller Bundesländer, ob für Haupt- oder Realschule, dass auf »Eigenart und Lebensaufgabe« der Geschlechter gebührend Rücksicht zu nehmen sei, dass bei Mädchen die »wesenhaft weiblichen Anlagen« mit Blick auf künftige Mutterschaft entwickelt werden und sie (vor allem durch das Fach Hauswirtschaft) zu »Ordnung, Sauberkeit und Disziplin« als Grundlagen eines guten »Familienhauswesens« erzogen werden sollten (Borris 1972, Kap. II.11, III.12). Die Kritik von Frauenbewegung und feministischer Schulforschung an Schule und Bildungswesen wurde deshalb eng mit der Kritik der »weiblichen Sozialisation« verbunden ( Kap. 3).
Mit der zunehmenden Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Frauen veränderten sich auch das Selbstbild und die Professionsvorstellungen von Lehrerinnen, blieben allerdings auch weiterhin von den Widersprüchen gesellschaftlicher Geschlechtervorstellungen geprägt – so zeigte Karin Flaake (1989: 163), dass für die älteren Kohorten unter dem Eindruck des Lehrerinnen-Zölibats (der erst 1951, in Baden-Württemberg 1956, aufgehoben wurde) die Entscheidung zwischen einem »normalen« Weiblichkeitsentwurf als Ehefrau, Mutter und Hausfrau und einer selbständigen Berufsexistenz deutlich radikaler erschien als für die jüngeren Kolleginnen (vgl. Hoff 2005), für die sich – und das bis heute – das Problem der Vereinbarkeit beider »Rollen« in den Vordergrund schob: Weil die Familienverantwortung von Frauen nicht in Zweifel gezogen wurde, machte sich im öffentlichen Diskurs die herabsetzende und verächtliche Formulierung breit, es ginge den Frauen nur um ihre »Selbstverwirklichung«, so dass ihre Professionsorientierung angezweifelt oder gering eingeschätzt wurde und als selbstgewählter privater Luxus erschien, der die Familienpflichten bedrohte.
Die Fokussierung auf die Benachteiligung von Mädchen und Frauen führte aber auch zu einigen blinden Flecken, die sich noch bis heute als unklare Gesichtspunkte zeigen. So zeigten schon in den 1960er Jahren empirische Befunde, dass Mädchen offenbar tendenziell leistungsmäßig stärker waren als Jungen und häufig die an sie gerichteten Erwartungen übertrafen (Zinnecker 1972: 118; Borris 1972: 71), und auch das »Sitzenbleiberelend« (Artur Kern) der Jungen war bereits aufgefallen. Diese frühen Befunde, die ja auf die Widersprüchlichkeit und Erklärungsbedürftigkeit der aktuellen Studien ein interessantes Licht werfen könnten, werden heute in der Diskussion um »Jungen als Bildungsverlierer« weitgehend ignoriert.
Die Interventionen der vielen auf Bildung, Schule und Universitäten bezogenen Frauenprojekte und vor allem aus der schnell entstehenden feministischen Schulforschung kann man in ihrer langfristigen Wirkung auf Pädagogik und Bildungspolitik nicht hoch genug einschätzen. Auch wenn manche der frühen Studien in Bezug auf Methodologie und Methoden später als unzulänglich kritisiert worden sind (Breitenbach 1994), wurden doch etliche Strukturaspekte deutlich, deren Entwicklung und Veränderung in den folgenden Jahrzehnten und bis heute in der Erziehungswissenschaft mit Aufmerksamkeit verfolgt wird: etwa dass Jungen deutlich mehr Aufmerksamkeit in der Schule auf sich zogen (Häufigkeit und Dauer von Sprechzeiten, Lob und Tadel), dass viele Schulbücher tendenziöse Texte und Aufgaben verwendeten, dass Lehrerinnen und Lehrer geschlechtstypisch ungleich in Leitungsfunktionen vertreten waren. Allerdings wurden auch viele wesentliche Erkenntnisse vom Mainstream der Erziehungswissenschaft nicht aufgegriffen, weil dieser nach wie vor blind war für die geschlechterbezogenen Dimensionen pädagogischer Konzepte – etwa die Problematisierung der Tatsache, dass die Mütter, deren nachmittägliche Verfügbarkeit vorausgesetzt wurde, von der Schule systematisch als »Hilfslehrerinnen der Nation« in Anspruch genommen wurden, was unter der Rede von »Eltern« dezent verschwand (Enders 1981: 176ff.).