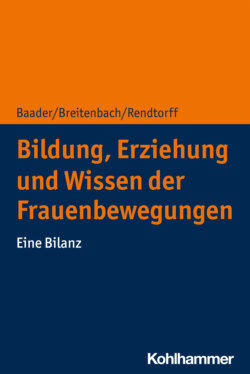Читать книгу Bildung, Erziehung und Wissen der Frauenbewegungen - Barbara Rendtorff - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bildung und Emanzipation
ОглавлениеFür beide Frauenbewegungen waren Bildung und Erziehung in ihren theoretischen Konzeptionen, ihrer Institutionalisierung und ihren Praktiken zentrale Bereiche – in diese zu investieren erschien als notwendige Voraussetzung für den politischen Kampf um Gleichberechtigung. Für die erste Frauenbewegung stand der »Kampf um Bildung« für bürgerliche Mädchen und junge Frauen im Zentrum, mit dem Ziel, angesehene Berufsmöglichkeiten für eigenständige Lebensentwürfe und gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. Der Blick der zweiten Frauenbewegung auf Bildung war stärker auf die Unterstützung von Emanzipationsprozessen, auf Empowerment durch Bildung und mit einer feministischen Wissenschaftskritik auch auf andere Formen der Wissensproduktion sowie auf die Hervorbringung von eigenen Bildungsmedien gerichtet. Während es der ersten Frauenbewegung mit dem Fokus auf frühkindliche Erziehung und Bildung im Kontext der Fröbelbewegung zunächst vor allem um Möglichkeiten der Berufstätigkeit von bürgerlichen Frauen im sozialen Bereich ging (später auch um den Zugang zu höherer Bildung, Abitur und Studium), interessierte sich die zweite Frauenbewegung vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie, Berufstätigkeit und auch von politischem Engagement für Einrichtungen der öffentlichen frühkindlichen Bildung wie die Kinderläden. Sie fragte dabei kritisch nach geschlechterdifferenzierenden Praktiken von Erziehung, Sozialisation und Bildung, in die auch geschlechtstypische Formen von Sorgeverhalten sowie Vorstellungen von Eignung und Passung zum Sozialen eingelassen sind. Die kritische Revision von Wissensbeständen und von Erziehung- und Bildungspraktiken mit ihren In- und Exklusionen stand im Zentrum der Bildungsinitiativen der zweiten Frauenbewegung. Der Begriff der Sozialisation, der um 1970 in Deutschland aufkam und auf die Rezeption US-amerikanischer Sozialwissenschaften zurückging, wurde beispielsweise in Verbindung mit der Frage nach »geschlechtsspezifischer Sozialisation« populär ( Kap. 3).
Beide Frauenbewegungen waren jedoch, bei aller Unterschiedlichkeit, mit ihrem Bildungsoptimismus insofern erfolgreich, als sie ein grundlegendes, die Erziehungs- und Bildungsvorstellungen nachgerade revolutionierendes Umdenken in Bezug auf Eignungen und Fähigkeiten von weiblichen und männlichen Kindern und Erwachsenen in Gang setzten. Allerdings fokussierten die beiden Frauenbewegungen unterschiedliche Institutionen und Organisationen sowie unterschiedliche Themen und Strategien bezüglich ihrer Bildungsbemühungen.
Seit den 1970er/1980er Jahren hat sich die historische Frauen- und Geschlechterforschung intensiv mit dem Verhältnis von privat und öffentlich auseinandergesetzt und dabei die Annahme einer strikten Dichotomie zunehmend infrage gestellt (Opitz-Belakhal 2010: 97ff.). Gleichwohl ist die Verhältnisbestimmung von privat und öffentlich bedeutsam für Geschlechterordnungen und Geschlechterverhältnisse. Der Slogan »Das Private ist politisch« kann als zentral für die zweite Frauenbewegung betrachtet werden. Nicht als Motto, aber als Denkfigur ist diese Perspektive jedoch auch in der ersten Frauenbewegung schon präsent. In der Geschichtsschreibung der Frauenbewegung wird dieser Slogan der zweiten Frauenbewegung mit der Thematisierung »innerfamiliärer Gewalt- und Ausbeutungsverhältnisse« sowie mit der Entscheidung über die »Gebärfähigkeit« in Verbindung gebracht (ebd.: 97). Für die zweite Frauenbewegung in der Bundesrepublik standen allerdings 1967/68 zunächst kritische Anfragen an die familiäre Arbeitsteilung und die Zuständigkeit für die Kindererziehung und damit auch Erziehungsfragen im Vordergrund, was jedoch in der Geschichtsschreibung der Frauenbewegung gerne übersehen wird (Baader 2008; Lenz 2008; Rendtorff 2009). Die zweite Frauenbewegung nahm also ihren Auftakt mit einem Erziehungsthema. Auch international war die Frage nach der Kindererziehung für die Anfänge der zweiten Frauenbewegung durchaus bedeutsam, so etwa bei der US-amerikanischen Feministin Shulamith Firestone (vgl. Firestone 1970).
Zentral für die zweite Frauenbewegung waren zudem die Universitäten als Orte der Bildung, der Wissenstradierung und Wissensproduktion. Dies zeigt sich etwa in Fragen nach der Repräsentanz von Frauen auf allen Ebenen der Universität und in den Auseinandersetzungen um Frauen als Subjekt und Objekt der Wissenschaft, so etwa im Zusammenhang mit den »Sommeruniversitäten« in Westberlin (Gruppe Berliner Dozentinnen 1977; Kap. 2 und Kap. 13). Das Bestreben, Frauen- und Geschlechterforschung sowie Genderstudien als Teile des universitären Curriculums oder gar als eigene Studiengänge an den Universitäten zu institutionalisieren, dokumentiert die Bedeutung, die universitären und akademischen Wissensformen beigemessen wird. Während sich in den frühen Texten der zweiten Frauenbewegung Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepublik das Ringen um Begrifflichkeit zur Bezeichnung von Geschlechterungleichheiten zeigte (vgl. Baader 2008), wurde zunehmend, auch international, der Begriff des Patriarchats als gesellschaftsanalytisches Konzept zur zentralen Referenz. Emanzipation, Befreiung und Selbstbestimmung waren darüber hinaus wichtige Schlagworte. Für Fragen der Selbstbestimmung stellten in der zweiten Frauenbewegung Sexualität, Körper und Gesundheit sowie Gewalt bedeutsame Aspekte dar ( Kap. 9, Kap. 10, Kap. 11). Die Aneignung von Wissen über den eigenen Körper war Ziel der internationalen Frauengesundheitsbewegung. Bücher wie »Our Bodies, Ourselves«, 1970 vom »Boston Womens Health Collective« herausgegeben und in viele Sprachen übersetzt bzw. für viele Länder angepasst, waren wichtige Meilensteine der internationalen Frauengesundheitsbewegung, die auch in der Bundesrepublik ein wesentlicher Motor der Frauenbewegung war. Insofern kann auch die Frauengesundheitsbewegung als eine »Frauenbildungsbewegung« bezeichnet werden, ging es doch um Formen der Wissensaneignung über den eigenen Körper und sein Funktionieren und damit um Gesundheitsbildung. 1980 wurde der internationale Bestseller unter dem Titel »Unser Körper – unser Leben« ins Deutsche übertragen. 1981 erschien mit »A New View of Woman’s Body« der US-Amerikanerin Carol Downer ein weiteres einschlägiges Buch, das das bisherige Wissen über den weiblichen Körper und seine Sexualorgane revolutionierte ( Kap. 10). Auch damit wird die Intention, neues Wissen zu schaffen, die für die zweite Frauenbewegung zentral war, unterstrichen. Versuche der Weiterführung der Frauengesundheitsbewegung im digitalen Zeitalter erweisen sich hingegen derzeit als schwierig.
Nicht zuletzt ist das Streben nach einer anderen, besseren Art von Bildung auch für die Themenfelder der Sozialen Arbeit zentral. Die Kritik an der geschlechtstypischen Teilung von Sorge sowie den geschlechterbezogenen gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen hatte auch hier Sozialisationsprozesse, Denkgewohnheiten und erziehungsbedingte Gewöhnungen an Über- und Unterordnungen als zentral erkannt, denen mit Aufklärung, durch Wissen, einer anderen Bildung und Erziehung und damit letztendlich auch veränderten Sozialbeziehungen begegnet werden könnte. Es ist die Geschlechterforschung, die den Sorgebegriff und Theorien der Sorge in den letzten Jahren stark in die Diskussion eingebracht und theoretisch entfaltet hat ( Kap. 6). Dabei wurde – im Anschluss an transnationale feministische Theorien – auch dafür votiert, den Sorgebegriff in der Erziehungswissenschaft als den übergreifenden Begriff zu fassen, der Erziehung und Bildung einschließt, da er die Grundlage aller sozialer Beziehungen darstellt (vgl. Baader/Eßer/Schröer 2014: 7–20). Diese Impulse wurden von der Disziplin aber eher abgewehrt.
Mit unserer Frage nach der Thematisierung von Erziehung, Bildung, Sozialisation und Sorge durch die Frauenbewegungen bearbeiten wir ein breites Thema, in das wir lediglich einige Schneisen schlagen können. Dabei liegt der Fokus schwerpunktmäßig auf der Bundesrepublik, den Blick auf die DDR und auf andere Länder nehmen wir nur sehr punktuell ein. Wir haben uns für eine gemeinsame Autorinnenschaft entschieden, da wir alle Kapitel gemeinsam schreiben und diskutieren, auch wenn unsere Positionen sich nicht in allen Fragen decken. Damit repräsentieren wir selbst Aspekte der Vielstimmigkeit des Feminismus, der zugleich Teil seiner Lebendigkeit ist.