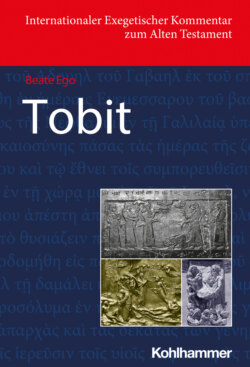Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Textgeschichtliche Aspekte
ОглавлениеWeitere interessante diachrone Dimensionen eröffnet die Textgeschichte des Buches, insofern dieses in mehreren, z. T. sehr unterschiedlichen Versionen vorliegt.143 Hier sollen exemplarisch die Entwicklungen vom Langtext GII zum Kurztext GI, die Traditionen der Vulgata sowie Verbindungen zwischen der antiken Überlieferung und den nach-antiken jüdischen Texten aufgezeigt werden.
Von G#sup#II#/sup# nach G#sup#I#/sup#Wichtig sind zunächst die inhaltlichen Verschiebungen, die sich in der Entwicklung von GII nach GI ergeben.144
a) GII und GI unterscheiden sich durch einen veränderten Umgang mit den Gottesbezeichnungen, der auf gewisse Tendenzen bei der Überarbeitung schließen lässt.
– GI hat, wie nicht anders zu erwarten, die Tendenz zu vereinfachen. So erscheint anstelle des Begriffs „Herrscher“ (3,14 GII) der weit verbreitete Begriff κύριος; Tob 14,7 GI redet nicht vom „Gott der Ewigkeit“, sondern vom „Herrn“; Tob 13,4 sagt anstelle von „Vater und Gott in alle Ewigkeiten“ zusammenfassend „Vater in alle Ewigkeiten“. Daneben sind noch Belege zu nennen, in denen auf die Gottesbezeichnung verzichtet wird (so in 3,3.6) bzw. in denen die entsprechenden Verse kein Pendant in GI haben (5,10; 12,20).
– In GI findet durch die Veränderung der Gottesbezeichnungen eine besondere theologische Akzentuierung statt. Auffallend ist die Rede vom „Tempel der Wohnung des Höchsten“ in Tob 1,4 GI (anstelle vom „Tempel der Wohnung Gottes“ in GII). Tob 13,18 GI liest „gepriesen sei der Gott, der alle Welt erhöht hat“ anstelle von „gepriesen sei der Gott Israels“. So werden die Macht Gottes und seine Universalität betont.
– GI verwendet kombiniert die Begriffe κύριος und ὁ θεός insgesamt sieben Mal (3,11; 4,19; 14,2.6–7), wohingegen κύριος ὁ θεός in GII nur zweimal erscheint (4,21; 14,15; beide Passagen haben keine Entsprechung in GI).
– GI kann die Rede vom „Gott des Himmels“ zurücknehmen. So ersetzt sowohl Tob 6,18 GI als auch Tob 7,11 GI „Herr des Himmels“ aus GII durch den „barmherzigen Gott“; Tob 8,15 GI liest anstelle „Gott des Himmels“ nur „Gott“.
– Tob 10,13 zeigt eine Tendenz zur Abkürzung. GII liest: „er pries den Herrn des Himmels und der Erde, den König über alles“, während GI dann ganz lapidar formuliert: „er pries Gott“.145 In Tob 7,12 findet das Motiv in GI keine Entsprechung.
– Allerdings wird diese verkürzende Tendenz nicht durchgängig eingehalten, wenn Tob 10,12 GI lesen kann: „der Herr des Himmels bringe dich zurück“ (anstelle des einfachen „der Herr bringe dich zurück“ in GII) und die Wendung „Herr des Himmels“ in Tob 7,17 unverändert bleibt. Tob 5,17 GI betont den Himmel als Wohnort der Gottheit, indem es hier heißt: „der Gott, der im Himmel wohnt“ (anstelle von „der im Himmel ist“).
– GI unterstreicht die Heiligkeit Gottes, wenn Tob 12,12.15 GI das Gottesepitheton „der Heilige“ haben (anstelle der Bezeichnung κύριος). Außerdem spricht Tob 3,11 GI nicht nur vom „Namen, der in Ewigkeiten gepriesen werden soll“, sondern vom „heiligen und ehrenvollen Namen“; Tob 8,5 GI hat „dein heiliger und herrlicher Name“ (anst einfach „Name“ in 8,5 GII). Allerdings fällt auch auf, dass GI gerade da verkürzen kann, wo GII den Begriff „heilig“ verwendet (so in 13,11 GII, wo es anstelle von „kommen […] zu deinem heiligen Namen“ in GI heißt: „zum Namen des Herrn, des Gottes“). Tob 13,18 GI verzichtet auf die Wiedergabe der Wendung „den heiligen Namen preisen“ (so in GII).
– GI hat die Tendenz, Personalpronomina zu verwenden und damit die Beziehungsebene zu unterstreichen: Tob 3,11 GI hat in der Gebetsanrede „Herr, mein Gott“ (anstelle von „barmherziger Gott“); 4,5 GI: „Gedenke des Herrn, unseres Gottes“.146
b) Bemerkenswerte Veränderungen finden sich auch in der Angelologie und den medizinisch-therapeutischen Vorstellungen.
– In GI spielt der Engel insgesamt eine größere Rolle, wenn das Gebet direkt „vor der Herrlichkeit des großen Rafaël“ erhört (3,16 GI) und die direkte Zuordnung des Engels zu Gott etwas zurückgenommen wird (siehe 5,4 GII: „ein Engel Gottes“ und GI: „Rafaël, der ein Engel war“).
– Tob 8,15 GI erweitert zudem den Lobaufruf durch die Einführung der Engel, die im Parallelismus auch „Heilige“ genannt werden können (siehe hierzu die Auslegung z. St.).
– Die Vorliebe für die Verwendung des Wortes ἅγιος, „heilig“, findet sich auch in Tob 8,15 GI in der Rede vom „heiligen“ Preislied.
– Allerdings hat man auch den Eindruck, dass GI das Motiv der Engelverehrung zurückdrängt (11,14).
– Der Bearbeiter von GI zeigt eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Gebrauch von medizinisch-magischer Begrifflichkeit und produziert so einen Text, der – vor dem Hintergrund des antikjüdischen Diskurses über die Legitimität therapeutischen Handelns – weniger verfänglich ist. Während GII τὸ φάρμακον als Überbegriff für Herz, Leber und Galle des Fisches (so 6,5.7) bzw. nur für die aus Fischgalle bestehende Augensalbe (so 11,8.11) benutzt, verzichtet GI an den betreffenden Stellen auf diese Begrifflichkeit.
c) In GI zeigt sich die Tendenz einer Rücknahme des Bezugs auf Israel und seine spezifischen Traditionen und eine Hinwendung zu einer Universalisierung.
– So tritt die Israelbegrifflichkeit (siehe 1,5.8.18; 5,5.9; 13,18; 14,4 [2x].5.7)147 sowie die Verwendung des Begriffes „Bruder“ (z. B. 1,5; 5,9; 10,6) zurück.
– GI eliminiert den Ausdruck „das Buch des Mose“. So kann einmal anstelle dessen auf „das Gesetz des Mose“ verwiesen (so 6,13 GI) oder nur allgemein von der „Bestimmung“ gesprochen werden (7,11; siehe auch 7,12). Tob 6,16 GI ersetzt die Gebote durch die Wendung „die Worte, die dir dein Vater gebot“. In Tob 1,8 entfällt sogar gänzlich die Referenz auf die Mosetora, wenn weder der Drittzehnte noch die Unterweisung der Debora explizit mit der Thematik verbunden werden.
– Allerdings enthält GI auch die Mahnung an Tobias aus dem Munde des Vaters, das Gesetz und die Gebote zu halten (so 14,8.9).
d) GI hat die Tendenz, bestimmte Aussagen zu steigern und damit zu generalisieren.
– Die Sünde der Naftaliten besteht anstelle der Verletzung der Kultzentralisation in GI in deren Fremdgötterdienst (siehe 1,5).
– Während Tobit in Tob 10,2 GII nur fürchtet, dass die Reisenden aufgehalten worden sein könnten, steht in Tob 10,2 GI die Sorge im Raum, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte.
– Anstelle von Nadab (so 14,10f. GII), dem Neffen Achikars, erscheint in GI Haman. Durch die Nennung dieser Figur, die in der Estererzählung Israels Erzfeind darstellt und als politischer Gegner mit einem radikalen Vernichtungswillen konnotiert ist, schwingt in dem Konflikt Achikars mit seinem Neffen eine nationale Komponente mit.
e) GI macht gelegentlich den Eindruck, dass Frauenfiguren eine bedeutendere Rolle spielen.
– So kommt Sara den beiden Reisenden entgegen, begrüßt diese als erste und führt sie in das Haus ihrer Eltern (7,1); vielleicht hat Edna hier auch das Siegelrecht (7,13).
– Aber es gibt auch die umkehrte Tendenz: Tob 8,15 nennt nur noch Raguël und nicht mehr eine Gruppe, zu der aufgrund des Kontexts wohl auch Edna gehörte.
Es ist schwierig, aus diesen Beobachtungen Rückschlüsse auf das Milieu zu ziehen, in dem die Überarbeitung GI entstanden sein könnte. Insgesamt fällt auf, dass GI die Universalität und Heiligkeit der Gottheit in den Vordergrund stellt sowie auch die Beziehung zu diesem Gott. Karin Schöpflin stellt fest, dass GI „die Distanz zwischen Gott und seinem Herrschaftsbereich inhaltlich vergrößert“.148 In diesem Zusammenhang versteht sie auch die Akzentuierung der Engelsfigur. Die Betonung der „Zugewandtheit der Gottheit zu ihren Verehrern“ macht sie an der häufigeren Verwendung des Terminus κύριος fest, der im Gegensatz zu „Gott“ einen Beziehungsbegriff darstellt. Aus diesem Befund möchte sie schließen, dass GI in einer Zeit mit „Gefährdungen“ [entstand], vergleichbar denen, wie sie in der Makkabäerzeit in Palästina gegeben waren, […] in der der Anspruch politischer Herrschaft auf gottgleiche Verehrung zugenommen hat“ und in der es um eine „Selbstversicherung des jüdischen Glaubens und Denkens, eine Identitätssicherung durch die Gottesbeziehung“ ging.149
Ein wichtiges Kriterium für die Verortung dieser Überarbeitung scheint mir die Tendenz zu sein, die Überlieferung von Israel abzukoppeln, wie sie durch das Zurücktreten der Israel- und Verwandtschaftsbegrifflichkeit gegeben ist. Vor diesem Hintergrund wäre zu überlegen, ob GI bereits in einem christlichen Milieu anzusiedeln ist.150 Dazu passt auch, dass die Thematik des Gesetzes in den Hintergrund tritt und auf das „Buch der Tora“ gänzlich verzichtet werden kann.
VulgataDer spezifische Charakter der Vulgata ist durch Unterschiede zur griechischen Überlieferung, insbesondere zum Langtext, der über die Vetus Latina zumindest indirekt als Vorlage diente, zu erheben.151 Dabei kommt den Zusätzen (so z. B. der expliziten Angleichung von Tobits Leiden an das Hiobs und dessen Glaubenstreue in Tob 2,12–18 Vg. oder dem dreitägigen Gebet vor der Hochzeitsnacht in Tob 6,16–22 Vg.), die wohl direkt auf den Kirchenvater Hieronymus zurückzuführen sind,152 besondere Bedeutung zu.
Möchte man das Material thematisch strukturieren, lassen sich folgende Bereiche nennen.
a) Vg. zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen starken Akzent auf eine lustfeindliche Sexualmoral legt.
– Dies zeigt sich an erster Stelle in dem Abschnitt über die sog. „Tobiasnächte“ in Tob 6,16–22 Vg. Danach sollen Tobias und Sara nach der Vertreibung des Dämons drei Nächte vor dem Vollzug ihrer Ehe im Gebet verharren, und der Umgang der Eheleute miteinander soll nicht der Befriedigung ihrer Lust dienen, sondern hat vielmehr das Ziel, eine Familie zu gründen (Tob 6,22 Vg.). Die Hinwendung zur Lust bedeutet die Abwendung von Gott und macht die Menschen Tieren wie Pferden und Maultieren gleich (Tob 6,17 Vg.). An dieser Stelle erfolgt auch eine Neukonzeptionierung der Figur des Dämons, da er nun als eine Kraft erscheint, die ihre schädigende Wirkung immer dort entfalten kann, wo Menschen nicht Herr ihrer Lust sind (Tob 6,17 Vg.).153
– Tob 8,4.5 Vg. nimmt dann diese Zusammenhänge wieder auf, wobei nun das Ausgeliefertsein an die Lust als ein Charakterzug präsentiert wird, wie er v. a. für die Völker typisch ist. Da Tobias seine Lust zu beherrschen vermag, kann der Dämon Asmodäus keine Macht über ihn ausüben. Asmodäus fungiert hier nicht als eine negativ konnotierte Gegenkraft (und ist damit auch gar nicht mehr „böse“, vgl. 3,8.17 mit Tob 3,8.25 Vg.), sondern verhält sich vielmehr affirmativ zu dem propagierten Wertesystem.154
– Auch für die Beschreibung Saras, die durch die Figurenstimme in ihrem Gebet zum Ausdruck kommt, ist diese Haltung charakteristisch. Sara, die sich immer vom leichten Spiel der anderen Mädchen fernhielt, ist nur deshalb bereit, einen Mann zu ehelichen, weil dies dem Willen Gottes entspricht, nicht aber um ihrer eigenen Lust willen (Tob 3,17 Vg.).
b) Des Weiteren spielt auch die Betonung der Gottesfurcht eine bedeutende Rolle.
– Tobit lehrt seinen Sohn von frühester Jugend an, Gott zu fürchten (Tob 1,10 Vg.). Nicht das „des Herrn Gedenken“ ist das Kriterium dafür, zur Mahlzeit Tobits eingeladen zu werden, sondern vielmehr die Gottesfurcht (Tob 2,2 Vg.). Tobit verbirgt die Leichname aus Gottesfurcht (Tob 2,9 Vg.). Als Plus zur griechischen Vorlage unterstreicht Tob 2,13f. Vg. Tobits Frömmigkeit und seine Gottesfurcht, die ihm von Kindheit an beigebracht wurden. Sie beinhaltet auch das Halten der Gebote, wobei jedoch keine explizite Referenz auf die Mosetora erfolgt; trotz seiner Erblindung hält Tobit an dieser Haltung fest. In seinem Begrüßungssegen für Tobias bei der Feier im Haus Raguëls bezeichnet Gabaël Tobias als den „Sohn eines sehr guten und gerechten Mannes, der Gott fürchtet und Almosen gibt“ (Tob 9,9 Vg., nach Tvscvlvm). Schließlich zeichnet Gottesfurcht auch das Leben des Tobias bis in sein hohes Alter aus (Tob 14,16 Vg.).
– Auch Tobias und Sara werden als gottesfürchtig beschrieben: Gottesfurcht ist das eigentliche Motiv, das Sara zu einer Ehe bewegt (Tob 3,18 Vg.), Tobias ist Sara wegen seiner Gottesfurcht bestimmt (Tob 7,12 Vg.), und dies ist auch die Haltung, die die Eheleute bei ihrem Umgang miteinander haben sollen (Tob 6,22 Vg.). Zudem zeichnet sich die gesamte Festesfreude durch Gottesfurcht aus (Tob 9,12 Vg.).
– Weiterhin erscheint Gottesfurcht ganz generell als die angemessene Haltung für ein gelingendes Leben und steht weit über jedem materiellen Wert (Tob 4,23 Vg.). In Tobits Abschiedsrede am Ende des Buches heißt es: „Seht also, was er [Gott] an euch getan hat, und mit Furcht und Zittern bekennt euch zu ihm und erhöht den König der Zeiten in euren Werken“ (Tob 13,6 Vg., nach Tvscvlvm).
– Auch der Erzählzug, dass Tobit seinen Mitexilierten gute Ratschläge gibt (Tob 1,15 Vg.), sein Geld dem Gabaël wegen dessen Bedürftigkeit überließ (Tob 1,17 Vg.) und sein Vermögen an die Armen verteilt und sie tröstet (Tob 1,19 Vg.), gehört – wenn auch der Begriff „Gottesfurcht“ selbst hier nicht explizit erscheint – in diesen Kontext.
– Saras integre Lebensführung soll sich schließlich auch zeigen, wenn die Eltern bei der Verabschiedung ihr den Rat mit auf den Weg geben, „die Schwiegereltern zu ehren, den Ehemann zu lieben, das Gesinde zu leiten, den Haushalt zu führen und sich selbst untadelig zu zeigen“ (Tob 10,13 Vg.).
Durch diese verschiedenen Motive werden die Protagonisten der Erzählung, insbesondere der alte Tobit und auch Sara, noch positiver dargestellt, als dies bereits in der griechischen Vorlage der Fall ist.
c) Wenn in Tob 2,13 Vg. die Gottesfurcht auch in Verbindung mit dem Halten der Gebote Gottes steht, so tritt die Bedeutung der Tora innerhalb der Erzählung insgesamt doch zurück.
– In seinen Ratschlägen im Gespräch mit Tobias über die Eheschließung in Tob 6,11–22 Vg. verzichtet Rafaël im Gegensatz zu den griechischen Texten ganz auf dieses Motiv.155 Auch wenn in Tob 7,14 Vg. das „Gesetz des Mose“ als Grund für die Verbindung der beiden Eheleute genannt wird, spielt es doch (im Gegensatz zu 7,12f. G) bei der eigentlichen Antrauungszeremonie sowie dem Anfertigen der Heiratsurkunde keine Rolle mehr. An keiner Stelle nennt Vg. das „Buch des Gesetzes des Mose“ (vgl. dagegen GII).
– Auffällig ist auch, dass Vg. konsequent auf das Motiv der Waschung verzichtet (vgl. 2,5.9; 7,9), und so ist zu vermuten, dass diese Waschungen, die die Vorlage nennt, in einem rituellen Sinne verstanden wurden und der Übersetzer diesem Erzählzug keine weitere Bedeutung beimessen wollte.
d) Vg. unterstreicht die Bedeutung des Gebets.
– Nach Tob 3,10f. Vg. betet Sara drei Tage lang. Ein dreitägiges Gebet soll nach den Worten des Engels auch vor dem Vollzug der Ehe von Tobias und Sara erfolgen (Tob 6,18 Vg.; siehe auch Tob 8,4 Vg. mit der Ausführung der Weisung).
– Während in der griechischen Vorlage das Gebet der Brautleute der Vertreibung des Dämons zeitlich nachgeordnet wird, erfolgt diese in Tob 6,19 Vg. im Rahmen des Gebets.
– In Tob 7,13 Vg. interpretiert Raguël den Zuspruch des Engels, wonach er ohne Sorge sein solle und Gott seine Tochter für Tobias als einem gottesfürchtigen Mann bestimmt habe, mit den Worten: „Ich zweifle nicht, dass Gott meine Gebete und meine Tränen vor seinem Angesicht zugelassen hat“ (nach Tvscvlvm). Damit wird deutlich, dass Raguël die glückliche Fügung der Ereignisse als Erfüllung seiner Gebete versteht. Die griechischen Texte kennen dieses Element nicht.
– Tob 7,17 Vg. verbindet die Notiz vom gemeinsamen Mahl vor der Hochzeitsnacht mit dem Hinweis darauf, dass die Protagonisten Gott loben (vgl. dagegen Tob 7,14 G ohne religiöse Referenz).
– Auch in der Szene von der Heilung des Vaters in Tob 11 wird dem Gebet eine größere Rolle eingeräumt. So weist der Engel Tobias bereits vor der Begegnung mit dem Vater an, dass er, sobald er das Haus betritt, Gott anbeten und ihm danken und im Anschluss daran dem Vater die Salbe auf die Augen streichen solle (Tob 11,7f. Vg.). Diese Reihenfolge der Ereignisse wird dann auch bei der Heilung selbst eingehalten (Tob 11,12–15 Vg.).
– Unmittelbar nach der Heilung erscheint in Tob 11,16 Vg. die Notiz, dass Tobit, seine Frau und alle, die ihn kannten, Gott priesen. Da in G allein Tobit als Akteur des Gotteslobs erscheint, liegt hier eine deutliche Vergrößerung des Chores vor, wodurch das Gebet ebenfalls mehr Gewicht bekommt. Allerdings wird der Inhalt des Gebets, das ja auch den Lobpreis an die Engel enthielt, an dieser Stelle nicht mehr genannt.
– Auch beim Abschluss der Offenbarung des Engels zeigt sich dieser Erzählzug, insofern nun die Protagonisten gleich für drei Stunden auf ihr Angesicht niederfallen und Gott preisen (Tob 12,22 Vg.).156
– Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch auf Tob 13,6 Vg. zu verweisen, wo explizit angeordnet wird, dass Gott „mit Furcht und Zittern“ bekannt werden solle.
e) Ein weiteres zentrales Theologumenon der Vulgatafassung ist das der Prüfung.
– Tobits Schicksal wird explizit als Prüfung verstanden. Allerdings geht es dabei nicht um seine eigene Standfestigkeit und sein Gottvertrauen (die scheint der Übersetzer stillschweigend vorauszusetzen), sondern darum, den anderen ein Beispiel für seine Geduld zu geben. Da Tobit von Kindheit an Gott fürchtete und die Gebote hielt, wurde er nämlich nicht verbittert, sondern blieb in der Furcht Gottes. Aber auch Sara scheint ihr Schicksal in diesem Sinne zu interpretieren, wenn sie in ihrem Gebet sagen kann, dass die göttliche Prüfung und Züchtigung eine Krönung des menschlichen Lebens darstellt (Tob 3,21 Vg.).
– Wie GI verbindet auch der Übersetzer der Vulgata die Entsendung des Engels mit dem Motiv der Prüfung (Tob 12,12 Vg.).157
f) Im Hinblick auf die Bedeutung der Familie zeigt Vg. ein differenziertes Bild. Während Vg. die Bedeutung der Nachkommenschaft betont (Tob 9,11 Vg.; 10,4.5 Vg.), scheint anderen familiären Beziehungen weniger Gewicht zuzukommen. So wird das Motiv der Endogamie marginalisiert (Tob 4,13f. Vg.; siehe auch das Gebet Saras in Tob 3,12–23 Vg.), und auch der Begriff „Bruder“ kann eliminiert werden (so z. B. bei 1,15; 2,2; 5,10; 10,6). Achikar (in Vg. „Achior“) erscheint nur im Zusammenhang mit dem Hochzeitsfest in Ninive in Tob 11,20 Vg.
g) Des Weiteren ist auch das Bild der Völker anders gezeichnet als in G.
– Der Schluss der Vulgatafassung des Tobitbuches erwähnt die Zerstörung Ninives nicht, sondern der Blick gilt hier den späteren Generationen, „die in einem rechtschaffenen Leben und in gesegnetem Lebenswandel [verblieben], sodass sie gern gesehen waren vor Gott wie vor den Menschen und allen Bewohnern des Landes“ (Tob 14,17 Vg.).
– Abgesehen von Tob 8,5 Vg., wo ein Seitenhieb auf die Lustzugewandtheit der Völker erfolgt, wird deren Rolle durchaus positiv gesehen. So verbindet Tob 8,19 Vg. das Dankgebet für die Vertreibung des Dämons bereits mit dem Motiv, dass die Betenden als Zeugen für Gottes Gnadenhandeln vor den Völkern auftreten sollen. Nach Tob 13,3–4 Vg. dient die Diasporaexistenz dazu, Gottes Wundertaten und seine Allmacht in der Völkerwelt bekannt zu machen; die Frommen sollen die Wunder Gottes erzählen und verkünden, dass es keinen „anderen allmächtigen Gott gibt neben ihm“.
h) Weitere deutliche Veränderungen finden sich in der Angelologie.
– In Tob 10,11 Vg. enthält der Segenswunsch des Brautvaters auch das Motiv des beschützenden Engels.
– Vg. lässt Tobias die Wohltaten des Engels vollständiger und prägnanter zusammenfassen: „Mich hat er wohlbehalten hin- und zurückgeführt; das Geld hat er selbst von Gabaël geholt; dass ich eine Ehefrau habe, hat er bewirkt und den Dämon von ihr genommen; Freude hat er ihren Eltern bereitet; mich selbst hat er vor dem Verschlingen durch den Fisch gerettet; auch dass du das Licht des Himmels siehst, hat er bewirkt, und durch ihn sind wir mit allen Gütern erfüllt worden. Was werden wir ihm geben können, das all diesem angemessen ist?“ (Tob 12,3 Vg.; nach Tvscvlvm).
– Tob 12,19 Vg. unterstreicht die Andersartigkeit des Engels, wenn das Motiv des Nicht-Essens ausgeschmückt wird: „Ich schien zwar mit euch zu essen und zu trinken, aber ich nehme eine unsichtbare Speise und einen Trank zu mir, der von den Menschen nicht gesehen werden kann;“ (nach Tvscvlvm).
i) Die lateinische Fassung zeichnet sich schließlich auch dadurch aus, dass hier ein stärkerer Akzent auf individuell-eschatologische Anschauungen gelegt wird
– Tob 4,11 Vg. verheißt, dass das Geben von Almosen die Seele nicht in die Finsternis eingehen lässt. Dies lässt vermuten, dass Hieronymus hier von dem Gedanken einer unsterblichen Seele ausgeht; es werden somit Vorstellungen aus dem Bereich der christlichen Eschatologie eingetragen.158
– Anstelle der „guten Gabe“, die das Almosen bildet, spricht Tob 4,12 Vg. davon, dass dieses eine „große Sicherheit“ (nach Tvscvlvm) darstellt. Auch an dieser Stelle scheint ein Einfluss eschatologischer Vorstellungen vorzuliegen.159
Die nach-antiken jüdischen ÜberlieferungenDie jüdische Tradition knüpft mit der aramäischen Version (Ar), Hebraeus Münster (HM), Hebraeus Fagius (HF), Hebraeus Londini (HL), Hebraeus Gaster (HG) und Ozar ha-Qodesch (OhQ) ab dem 13. Jh. an die griechische und lateinische Überlieferung an und entwickelt diese weiter.160 Ar, HM und HG weisen enge Beziehungen zueinander auf. Textgeschichtlich interessant ist insbesondere, dass HL in einem engen inhaltlichen Bezug zur Überlieferung der Vulgata steht.161 Eine Präsentation des gesamten Materials ist ein wissenschaftliches Desideratum und müsste aufgrund seines Umfangs in einer eigenen Publikation erfolgen. Hier soll ein Blick auf einige wesentliche Züge genügen, um so die großen Interpretationslinien des Stoffes deutlicher in den Blick zu bekommen.162
a) Eine wichtige Tendenz bei der Bearbeitung des Stoffes besteht darin, die Bedeutung der Almosengabe zu unterstreichen.
– Ar und HG stellen das Thema der Zehntabgabe als eine besondere Form des Almosengebens an den Anfang und Schluss der Überlieferung (zu 1,1–2 und zu 14 Ende).
– Auch in Tobits Testament in Tob 4 erfolgt eine eindeutige Betonung des Motivs, wenn Ar und HM die Mahnung zum Almosengeben erweitern.
– Eine Eschatologisierung des Motivs enthält HF, insofern Almosen hier vor der Gehenna errettet und dem Spender von Almosen eine „große und gute Gabe“ von Gott verheißen wird (zu 4,10f.).
– Schließlich kann das Motiv auch in den Hymnus Tobits integriert werden, wenn hier nicht nur zum Lob Gottes, sondern auch zum Almosengeben aufgerufen wird (HM zu 13,6). Somit wird insgesamt in der Überlieferung ein starker Akzent auf diese Frömmigkeitspraxis gelegt.
b) Des Weiteren bildet auch die Verstärkung der Gebetsfrömmigkeit eine bedeutende Komponente.
– Tobits Bittgebet (3,1–6) kann dramatisiert bzw. durch einzelne Wendungen erweitert werden (siehe HM, HF, HL).
– HL fügt beim Angriff des Fisches ein kurzes Stoßgebet ein (zu 6,3).
– OhQ platziert das Gebet vor die Vertreibung des Dämons und verändert durch diese Neukontextualisierung den Stellenwert dieses Motivs ganz generell, da nun nicht mehr die Räucherzeremonie die Vertreibung des Dämons bewirkt, sondern das Vertrauen der Protagonisten in Gottes Hilfe (zu 6,17; 8,2).
– Besonders interessant ist das Gebet des Tobias in der Hochzeitsnacht, das als Akrostichon gestaltet ist (HL zu 8,6); zudem spricht hier auch Sara ein eigenes Gebet (zu 8,7).
– Auch die Segensworte werden weiter ausgestaltet (z. B. HL zu 5,18; 7,11–14; 8,15–17; Ar, HM und HL zu 9,6).
– Schließlich enthält HL zu 11,14 auch ein Lobgebet der Hanna.
c) Zudem können die Überlieferungen die Bedeutung des Toragehorsams unterstreichen (so u. a. HF zu 4,19; Ar zu 7,7; HM zu 8,7; 9,6). Ein Teil der Versionen legt auch einen deutlichen Akzent auf die Erfüllung der rituellen Bestimmungen und Reinheitsfragen (z. B. Ar, HM, HL, HG und OhQ zu 1,10f.; HF und OhQ zu 2,9).
d) Die Versionen setzen zudem verschiedene theologische Akzente. Abgesehen von zahlreichen Einfügungen verschiedener Gottesepitetha spielen hier narrative Elemente eine bedeutende Rolle, etwa eine geschichtstheologische Reflexion zur Verfolgung durch Sanherib, die Gottes Gerechtigkeit betont (HM zu 1,18).
e) Andere Motive der Erzählung, so die Angelogie und die Dämonologie, werden eher zurückhaltend und mit leichten Akzentuierungen aufgenommen.