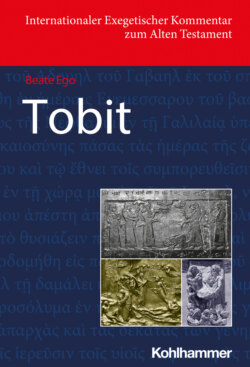Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Synthese
ОглавлениеDie Buchüberschrift bietet sehr konkrete Angaben zum Stammbaum und zur Herkunft des Protagonisten Tobit sowie zu dessen historischer Kontextualisierung. Im Zentrum steht das Schicksal Tobits, eines Naftaliten, der aus seiner galiläischen Heimat unter König Salmanassar V. (726–722 v. Chr.) ins assyrische Exil deportiert wurde.
Der Buchanfang erinnert formal an zeitgenössische pseudepigraphe Überlieferungen großer Gestalten aus Israels Vergangenheit, sodass der Protagonist der Erzählung gleich in die Aura besonderer Bedeutsamkeit und Weisheit gehüllt wird. Es ist nicht auszuschließen, dass der Erzähler auf konkrete Familien- bzw. Lokaltraditionen rekurriert und auch das Ziel verfolgt, das Prestige einer bestimmten Familie bzw. von Menschen, die mit den hier genannten Ortslagen in Galiläa verbunden sind, zu untermauern.
Konkretere Rückschlüsse auf den historischen Ort und den Sitz im Leben der Buchüberschrift sind allerdings nicht möglich, da deren Angaben kein stimmiges Gesamtbild ergeben. Die Ortsangaben wirken einerseits sehr konkret, lassen sich aber andererseits nicht miteinander harmonisieren, da nur „Kedesch in Naftali“ und „Asser/Hazor“ in Galiläa lokalisiert werden können, „Tisbe“ und „Phogor“ jedoch nur aus der Geographie des Ostjordanlandes bekannt sind. Die Ortslagen „Kedesch in Naftali“ und „Asser/Hazor“ sowie die Bedeutung, die Galiläa hier insgesamt einnimmt, passen in die Zeit der Makkabäerkämpfe (vgl. 1 Makk 5,21–23) bzw. der Gebietserweiterungen der Hasmonäer unter Aristobul I. (104–103 v. Chr.), aber eine solche Beziehung ist nicht zwingend.
Die Assoziationen zu den Tobiaden, die durch die Genealogie anklingen, sind zwar nicht zu übersehen, unklar bleibt aber, wie sich dann Tobits Zugehörigkeit zum Stamm Naftali in die gesamte Szenerie einfügen soll. Ob sich diese Einzelteile zu einem kohärenten Ganzen zusammensetzen lassen, muss offenbleiben. Vielleicht wurde eine alte Tobiaden-Familiensage umgedeutet und mit Naftali in Verbindung gebracht („Tisbe“ und „Phogor“ könnten dann Reminiszensen an die Herkunft des Stoffes aus dem Ostjordanland sein) oder es gab sogar zur Zeit der Makkabäerkämpfe eine Person aus der Tobiadenfamilie, die sich in Galiläa niedergelassen hatte und die aktiv an ihrem Image arbeitete, indem sie sich durch ihren Ahnherrn mit der altehrwürdigen Geschichte Israels zu verbinden versuchte (man beachte, dass bei den Kämpfen des Judas auch Reiteroffiziere aus dieser Familie beteiligt waren). All dies gehört in das Reich der Spekulation. Vielleicht ist die Verbindung der Namen zum Tobiadenclan reiner Zufall, und der Erzähler hatte einfach keine konkrete Vorstellung von der Geographie Galiläas …
Abgesehen von solchen Versuchen einer konkreten historischen Kontextualisierung ist festzuhalten: Die zentrale Thematik, die hier gleich beim Auftakt des Buches anklingt, ist die Begegnung Israels mit der Fremdherrschaft. Die Genealogie verweist sowohl auf die kollektive Dimension der Geschichte als auch auf das Thema der Familie, das zu den Leitmotiven der Erzählung gehört. Allerdings war es nach der entsprechenden Referenzstelle 2 Kön 15,29 nicht Salmanassar V. (726–722 v. Chr.), sondern vielmehr dessen Vorgänger und Vater Tiglat-Pileser III. (744–727 v. Chr.), der für die Exilierung des nördlichen Teils Israels unter Pekach (735–732 v. Chr.) verantwortlich war. Salmanassar V. dagegen erscheint in 2 Kön 17,3 und 2 Kön 18,9 als der Eroberer Samarias, der das endgültige Ende des Nordreichs besiegelte (722 v. Chr.). Die Vermischung dieser Angaben kann im Sinne einer historischen Fiktion verstanden werden, die markante geschichtliche Ereignisse kombiniert, um so zu einer idealtypischen Konstellation zu gelangen. Tobit wird so gleich zu Beginn der Erzählung als das Urbild eines Opfers aggressiver Weltmachtspolitik charakterisiert und seine Existenz als die eines Flüchtlings beschrieben. Da die Erzählung wohl in der hellenistischen Zeit entstand, ist nicht davon auszugehen, dass es sich hier noch um eine konkrete Auseinandersetzung mit der assyrischen Herrschaft handelt. Assur, das zu dieser Zeit bereits lange untergegangen war, ist zur Chiffre für die aggressive Expansionspolitik und die Bedrohung durch den universalen Machtanspruch einer Fremdmacht geworden und hat exemplarischen Charakter. Die religiöse Bedeutung des Namens „Tobit“ beinhaltet auch ein Statement über die Güte Gottes, sodass – vor dem Hintergrund der Exilierung – implizit die Frage nach der göttlichen Gerechtigkeit anklingt.
Diese Problematik soll sich im Laufe der Erzählung durch das Leiden Tobits und auch das Leiden Saras verstärken, um dann aber schließlich durch das Motiv der göttlichen Hilfe eine Lösung zu erfahren. Der gesamten Erzählung wird die Aufgabe zukommen, Gottes Güte, die durch den Namen des Protagonisten gleich am Anfang der Erzählung programmatisch eingespielt wird, aber angesichts individueller und kollektiver Krisen nicht immer auf den ersten Blick offensichtlich ist, zu entbergen. Die Einleitung eröffnet somit einen Spannungsbogen, der dann sowohl durch die Geschichte von Gottes Rettungstaten als auch durch das Finale mit dem großen Jerusalemhymnus (13,9–18) und Tobits Testament (14,6–7) entfaltet und aufgelöst wird.