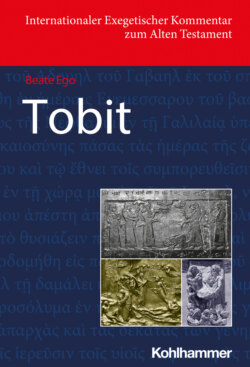Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление– Bei der Aktivität des Engels kann das Motiv der Gebetsmittlerschaft betont werden (HG zu 12,12); auffällig ist aber v. a. Ar, wo das Motiv der Selbstoffenbarung des Engels gänzlich fehlt.
– Insgesamt bemerkenswert ist auch die Angleichung an den rabbinischen Sprachgebrauch, wenn Rafaël als Fürst ׄשר bezeichnet wird (so z. B. HM in Tob 3,17; 12,15).
– Am Ende, nachdem der Engel entschwunden ist, fürchten die Protagonisten, dass sie sterben könnten, da sie einen „Engel des Herrn der Heerscharen“ gesehen haben (HL zu Tob 12,21).
– Asmodäus kann entweder „König der Dämonen“ (so z. B. Ar, HM zu 3,8.17) oder „Reschef“ genannt werden (HL zu 6,16.18; 8,3; 12,3).
– Manche Texte scheinen konkretere dämonologische Vorstellungen zu haben, wenn etwa vom „Herausziehen“ des Dämons (HL zu Tob 6,8) die Rede ist.
– Eine Art Theologisierung der Dämonologie findet statt, insofern das Gebet vor die Vertreibung des Dämons platziert werden kann (OhQ zu Tob 6,17; 8,2).
– Der Verweis darauf, dass das Räucherwerk unter dem Rock Saras platziert wird (Ar, HM und HG zu Tob 6,17; 8,2), könnte darauf hindeuten, dass hier ein konkretes Räucherritual aus einem medizinischen Kontext Pate gestanden hat und der Autor, welcher das Motiv zum ersten Mal in die Überlieferung einspielte, dieses vor Auge hatte.
f) Eine bedeutende Tendenz, die sich in fast allen Überlieferungen findet, ist der Verzicht auf den eschatologischen Ausblick, wie er für den Schluss der Erzählung in den antiken Versionen typisch ist. So zeigen sich in gewisser Weise eine „Ent-Eschatologisierung“ und eine Konzentration auf die eigentliche Handlung. Lediglich HF enthält die Wiedergabe des Jerusalemhymnus in Tob 13 bzw. 14,4–7 in einem nennenswerten Umfang.
g) Ansonsten ist zu bemerken, dass die Erzählfiguren unterschiedlich akzentuiert werden.
– Dabei spielt v. a. die Figur der Hanna eine besondere Rolle. Insbesondere ihre religiöse Aktivität wird betont, wenn sie nun – im Gegensatz zu den älteren Texten – als aktive Beterin dargestellt werden kann. Sie segnet ihren Sohn zum Abschied (HL zu Tob 5,18) und preist Gott nach seiner Rückkehr bzw. nach der Heilung Tobits (Ar zu Tob 11,9; HL zu Tob 11,14; HM zu Tob 11,16). Außerdem zieht sie ihrer künftigen Schwiegertochter entgegen (HM zu Tob 11,16).
– Des Weiteren kann auch Tobits Frömmigkeit betont werden, indem er als idealer Lehrer geschildert wird, der sich von jeder Sünde fernhält (HL zu Tob 1,9) und sich um das Wohl seiner Mitmenschen kümmert (HL zu Tob 1,13). Eine theologische Aufwertung von Tobits Ungehorsam gegenüber dem König formuliert HL, insofern Tobit hier sagen kann: „Ich fürchte den Herrn der Herren mehr als den König, der wie ich aus Erde geformt ist“ (zu Tob 2,8).
– Die Versionen sind außerdem darum bemüht, Saras Unschuld in den Hochzeitsnächten zu unterstreichen (Ar, HM und OhQ zu Tob 7,11).
h) In narratologischer Hinsicht interessant ist die Tendenz zur Dramatisierung der Handlung.
Dieser Aspekt zeigt sich deutlich im Kontext der Not Tobits bei seiner Flucht und bei seinem Gebet (HG zu 1,20 [während seiner Flucht wird Tobits Haus geplündert]; HL und HF zu 3,1 [Beschreibung des körperlichen Zustands beim Gebet]) oder bei der Begegnung zwischen Vater und Sohn bei seiner Rückkehr (HL zu Tob 11,10). Auch die Begegnung mit dem Fisch wird ausgeschmückt, insofern dieser „groß und furchtbar“ ist (HL zu 6,1–3; siehe auch OhQ).
i) Weitere Elemente dienen der Beleuchtung narrativer Details, insbesondere im Kontext des Eheschließungsrituals.
– So kann die Hochzeitszeremonie derart beschrieben werden, dass der Brautvater die Hand Saras in die Hand Tobias gibt und daraufhin die Antrauungsformel spricht (OhQ zu Tob 7,12).
– Außerdem erfolgen Angaben zum Material, auf das der Ehevertrag geschrieben wird, und bei der Eheschließung sind auch Zeugen zugegen (Ar und HM zu Tob 7,13).
– Besonders eindrücklich ist HL zu Tob 7,13–14, wonach sich die Ältesten der Stadt versammeln, Dinge niederschreiben (gemeint ist vermutlich der Ehevertrag), Gott preisen, Bräutigam und Braut segnen, um dann eine fröhliche Mahlzeit zu beginnen.
– Aber auch der Modus der Aushändigung des Geldes an Gabaël bzw. der Austausch der Unterschriften bei der Hinterlegung des Geldes kann genauer erklärt werden (HF zu Tob 3,17; HL zu 1,14; Ar, HM, HF, HG und OhQ zu 5,3).
j) Eine Reihe von Texten zeichnet sich durch das Bemühen aus, den Text an die biblische Überlieferung anzugleichen.
Dies kann durch biblische Begriffe (z. B. גער [„Schelten“ des Dämons] (HF zu Tob 3,17; HL zu Tob 2,10; 8,6f.; 8,17) geschehen, durch die Einfügung von Schriftzitaten (z. B. Jer 31,17 zu 13,9 oder Ps 72,10 zu 13,11 in HF) oder durch einen Eingriff in die Textüberlieferung selbst, durch welchen die historischen Referenzen der Erzählung an die biblische Überlieferung angeglichen werden (OhQ zu Tob 1,10.15).
Somit lässt sich insgesamt feststellen, dass in diesen nach-antiken Texten der ethische Aspekt, insbesondere die Bedeutung von Almosengabe, Toragehorsam und Gebet unterstrichen wird. Angelologie und Dämonologie sowie die eschatologische Ausrichtung der Überlieferung treten dagegen zurück. Weitere Arbeiten haben diese groben Traditionslinien genauer zu beleuchten, wobei der Verbindung zwischen der Vulgatatradition und Hebraeus Londini besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte.