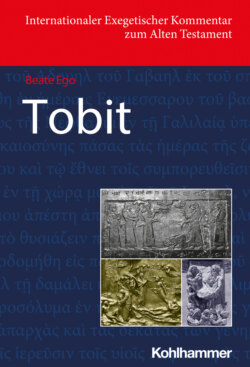Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diachrone Analyse
Оглавление1,1: βίβλος λόγωνDer Ausdruck βίβλος λόγων („Buch der Geschichte“) weckt Assoziationen an die biblische Wendung N. N. ספר דברי הימים (z. B. 2 Kön 14,28; 15,6.21.31; 16,19 [griech. in der Regel mit βιβλίον λόγων τῶν ἡμερῶν N. N., z. B. 2 Kön 14,28; 15,6.21.31; 16,19 oder βιβλίον ῥημάτων τῶν ἡμερῶν N. N., so 1 Kön 14,29 wiedergegeben])3 bzw. an den biblischen Ausdruck N. N. ספר דברי (so 1 Kön 11,41, griech.: βιβλίον ῥημάτων N. N.). Eine solche Chronik erscheint in der biblischen Geschichtsschreibung (bzw. im Esterbuch, das den Anschein von Geschichtsschreibung erwecken möchte), um auf ein Werk zu verweisen, in dem bedeutende geschichtliche Ereignisse verzeichnet sind. Der Begriff λόγος ist hier daher im Sinne von „Begebenheiten, Geschichte“ zu verstehen (vgl. auch Apg 1,1).4 Der Anschluss im Hebräischen wird in der Regel mit Lamed in der Rolle einer Nebenprädikation5 bzw. im Griechischen mit Dativ konstruiert. Nur 1 Kön 11,41 verwendet eine Constructus-Verbindung bzw. im Griechischen dann den Genitivus possessivus. Die Bezugsgrößen sind dabei die Könige Judas oder Israels; in den Belegen aus dem Esterbuch geht es um die Chronik des Perserkönigs (Est 2,23; vgl. 6,1) bzw. die Chronik der Könige von Medien und Persien, in die – als Auszeichnung und große Ehre – auch die Taten Mordechais Eingang finden (Est 10,2). Die Formulierung in 1 Kön 11,41 kommt Tob 1,1 insofern am nächsten, als das „Buch der Begebenheiten“ dort ebenfalls mit einer einzelnen Person, nämlich mit Salomo, verbunden wird.
Außerbiblische ReferenzenEin ähnlicher Buchanfang wie hier findet sich im Genesisapokryphon 1QGenApocr 5,29, wo von einer Kopie des Buches der Worte Noachs (כתב מלי נוח פרשגן) die Rede ist.6 Des Weiteren liegt auch eine enge Korrespondenz zu den Testamenten der Zwölf Patriarchen7 sowie zum Anfang der aramäischen Achikarerzählung vor.8 Hier allerdings ist die Übersetzung „Buch/Schrift der Worte N. N.“ passender. Für Tobit insgesamt ist die erste Möglichkeit, wonach es um die „Geschichte Tobits“ geht, vorzuziehen, da nur am Buchanfang Tobit in der 1. Pers. spricht (so 1,3 bis 3,6) und dann – ab Tob 3,7 – ein auktorialer Erzähler agiert.
Die Parallelen zum Buchanfang erscheinen somit allesamt im nationalen bzw. internationalen Kontext königlicher Geschichtsschreibung bzw. in der Literatur, die mit altehrwürdigen Patriarchen in Verbindung steht. Tob 1,1 unterscheidet sich davon insofern, als hier weder eine königliche Figur noch einer der weisen Urväter vorgestellt wird, dazu ist Tobit auch noch ein Exilierter. Auf diese Art und Weise erscheint die Figur Tobits in der Patina historischer bzw. weisheitlicher Bedeutsamkeit. Gleichzeitig wird die Erwartung aufgebaut, dass nun entweder „große“ politische Geschichte berichtet wird oder aber – ähnlich wie in der Testamentenliteratur oder bei Achikar – eine besondere Art der Weisheitslehre erfolgt. Die Erzählung spielt zunächst aber – wenn auch in die Geschichte der großen Reiche eingebunden – in der „kleinen Welt“ der Familie. Erst am Ende des Buches soll deutlich werden, dass gerade das „Familiär-Private“ hier auf das Nationale hin transparent gemacht wird. Somit formuliert das Buch Tobit in „Anlehnung und Modifikation zu den im dtr. und chr. Geschichtswerk erwähnten Buchtiteln […] seinen Anspruch, eine für die Geschichte Israels insgesamt maßgebliche, ja positiv paradigmatische Person darzustellen.“9
1,1: Der Name „Tobit“Der Name „Tobit“, der in seiner Langform „Tobija(hu)“ bzw. „Tobiël“ die Bedeutung „Jhwh bzw. Gott ist gut“ (siehe TA 1,1a) hat, signalisiert das dem Wohl der Menschen dienende Handeln Gottes. Die symbolische Dimension des Namens erschließt sich insbesondere durch den innerbiblischen Bezug zu Nah 1,7, einem der wenigen Statements über Gottes Rettung seines Volkes „in the midst of a book largely devoted to prophesying God’s jugdement on Niniveh“.10
1,1: Die TobiadenInnerhalb der biblischen Überlieferung und der Geschichte Israels ist der Name „Tobit“ insbesondere mit der Familie der Tobiaden und einer Figur namens Tobija in Neh 2,10.19; 4,1–9; 6,1.12.14.17.19; 13,4–9 verbunden, die als „Knecht Ammons“ (Neh 2,10.19) bezeichnet wird und als Widersacher Nehemias auftritt. Das theophore Element des Namens (wie auch des Namens seines Sohnes Johanan; siehe Neh 6,18) deutet ausdrücklich darauf hin, dass dieser ein Jahweverehrer war. Deutlich wird zudem, dass dieser Tobija in engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu hoch angesehenen Jerusalemer Familien stand und eine breite Akzeptanz und hohes Ansehen bei den Eliten genoss.
Nach Neh 13,4 war Tobija mit dem Priester Eljaschib (nach Neh 3,20 Hoherpriester!) verwandt (siehe auch Neh 6,18, wonach Tobija in einem verwandtschaflichen Verhältnis zu Schechanja stand, der ebenfalls zu den Priestern gezählt wird [Neh 12,3]). Eljaschib hatte Tobija sogar einen Raum im Jerusalemer Tempel zur Verfügung gestellt, damit dieser dort seine Besitztümer aufbewahren konnte (Neh 13,5). Außerdem hatten viele Judäer Tobija einen Treueeid geleistet (Neh 6,18). Wenn Nehemia Tobijas Recht auf dauerhaftes Andenken in Jerusalem bestreitet (Neh 2,20), so impliziert dies, dass ein solcher Anspruch, der vermutlich politische Implikationen hatte, tatsächlich bestand bzw. erhoben wurde.
Die Bezeichnung „Knecht Ammons“ spielt auf die Herkunft Tobijas aus dem ostjordanischen Ammon an, das als dem Siedlungsgebiet der israelitischen Stämme zugehörig betrachtet werden konnte (siehe Jos 13,24–28).11 Man hat erwogen, ob Tobija sogar die Position eines ammonitischen Statthalters innehatte. Klaus-Dietrich Schunck plädiert dafür, in Tobija einen „Unterbeamten“ zu sehen, der in enger Verbindung mit Sanballat als dem Statthalter der Provinz Samaria stand. Eine solche Annahme „würde noch eine Bestätigung erhalten, wenn es zutreffen sollte, daß der in Esr 4,7 genannte טבאל mit ihm identisch ist […]. Dieser טבאל wirkte bereits 448 v. Chr. als Beamter in Samaria, von wo er sich in einer Jerusalem betreffenden Angelegenheit mit einem Brief an Artaxerxes wandte.“12
Tobija scheint zu einer Familie gehört zu haben, die unter dem Namen „Söhne Tobijas“ in den Rückkehrerlisten in Esr 2,59f. und Neh 7,61f. als eine Gruppe genannt wird, bei der nicht klar war, ob sie aus Israel stammte.13
Weitere aufschlussreiche Hinweise zu Tobija sowie zur Geschichte seiner Familie gibt Benjamin Mazar. Er betont ausdrücklich, dass Tobija Jude war; die Bezeichnung „Knecht Ammons“ möchte er als Hinweis auf seine hohe gesellschaftliche Position deuten und seine Funktion als Diener („servant“) des persischen Königs mit Residenz in Ammon bestimmen.14
Nach Mazar entstammte dieser Tobija einer Familie, die bereits in vorexilischer Zeit politisch bedeutsam war und über einen großen Reichtum verfügte. Das früheste Zeugnis hierfür könnte sich bereits in Jes 7,6 finden, wo ein gewisser Tabeal genannt wird, der von den angreifenden Aramäern anstelle Ahas’ zum König Judas gemacht werden soll. Vor dem Hintergrund der Theorie, dass der Name Tabeal hier eine pejorative Form des Namens Tobiël darstellt und dass das theophore Namenselement -el infolge der josianischen Reform durch -jah(u) ersetzt wurde, möchte Mazar bereits diese Person als Mitglied der Tobiadenfamilie und als einen frühen Vorfahren des Tobija aus dem Nehemiabuch sehen, der einer einflussreichen judäischen Familie angehörte, „perhaps even a relation of the house of David, who had many supporters among Ahaz’ enemies in Jerusalem and was closely connected with the kings of Israel and Aram, and we might well see in this Ben-Tab’al the ancestor of the Tobiad family.“15 Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Tobiaden bereits in den letzten Jahren vor dem Ende des Königtums in Juda sehr einflussreich waren, findet sich in den Lachischbriefen, wo ein Tobiah als „Diener des Königs“ (Lachischbrief III, II, 19–21) bzw. als „Arm des Königs“ (Lachischbrief V, II, 7–10) bezeichnet werden kann.16
Für die Verbindung mit dem Ostjordanland bietet Mazar verschiedene Erklärungen an. So verweist er darauf, dass manche der israelitischen Könige enge Beziehungen zu Grundbesitzern in Transjordanien hatten. Pekach, der Sohn Remaljas, wurde mit Hilfe der Gileaditen König (2 Kön 15,25), und es ist nach Mazar möglich, dass die Tobiaden ihre Karriere als Landbesitzer in Transjordanien in den Tagen von Usija und Jotam begannen, als diese Besitztümer von den Ammonitern erhielten (vgl. 2 Chr 26,8; 27,5). Eine Alternative für die Verbindung der Tobiaden mit Gilead schlägt Mazar in einer Fußnote vor: „If we accept the assumption that Tab’al was the ancestor of the Tobiads, then the family estates in Gilead would be a pledge for his loyality towards Pekah, the king of Israel.“17
Mazar möchte zudem auch annehmen, dass Mitglieder der Tobiadenfamilie, die später als „Söhne Tobijas“ in den Rückkehrerlisten erscheinen (siehe Esr 2,59f. und Neh 7,61f.), von Tiglat-Pileser III. (744–727 v. Chr.) aus Gilead exiliert worden waren. Für eine solche Rückkehr sprechen Belege aus der prophetischen Überlieferung – so Jer 1,19, Ob 19 und Sach 10,10.18 Die babylonischen Texte aus dem Murashu-Archiv in Nippur zeigen aber auch, dass ein Teil der Familie im mesopotamischem Exil blieb.19 Zudem identifiziert Mazar jenen Tobija, der in Sach 6,10 erwähnt wird und der Gold für die Herstellung der Krone für Jeschua und Jozadak bringen sollte, als Großvater des Gegenspielers Nehemias.20
Blickt man von diesen Belegen aus auf die weitere Geschichte dieser Familie, so wird in der Regel angenommen, dass die Gestalt Tobijas, die im Nehemiabuch erwähnt wird, in Beziehung zu dem wohlhabenden und einflussreichen Tobiadenclan steht, der für die Geschichte des antiken Judentums in der Ptolemäer- und Seleukidenzeit bedeutsam wurde.21 So dokumentieren die Zenon-Papyri die Aktivität eines Tobias im 3. Jh. v. Chr., der im Ostjordanland ein wohlhabender Landbesitzer und ein Geschäftsmann war. Wenn Zenon-Papyrus Inv. 2358, der aus der Zeit Ptolemäus’ II. (283–246 v. Chr.) stammt, vom „Land des Tobija“ spricht, wird deutlich, dass die Familie der Tobiaden östlich des Jordans umfangreiche Ländereien besaß. Mazar beschreibt auf der Basis der Zenon-Papyri das Territorium dieses Clans folgendermaßen:
„We may fix its boundaries roughly according to the Zenon papyri. In the West it boardered on Abila, to which probably belonged the regions adjoining the Jordan on the east between Wadi Nimrin and the Dead Sea (the biblical ‘plains of Moab’). In the east it extended as far as the vicinity of Rabbath-Ammon, i. e. Philadelphia, which appears in the papyri as an autonomous city and it is called by its ancient name: ἐν Ραββαταμμανοις. In the south it is bordered on the Moabitis, and the boundary probably passed along the Wadi Ḥisban. In the north the whole neighbourhood of es-Salt belonged to Gedora […].“22
Diese Angabe wiederum passt zu den Ausführungen des Josephus im sog. Tobiadenroman, in dem erzählt wird, wie ein gewisser Josef, Sohn des Tobias und der Schwester des Hohenpriesters Onias II., vom Ptolemäerkönig das Amt des Generalsteuerpächters verliehen bekam und dieses zweiundzwanzig Jahre lang innehatte. Dieser Josef hatte sieben Söhne, und sein jüngster Sohn Hyrkanus, der die proptolemäische Haltung seines Vaters vertrat, überwarf sich mit seinen Brüdern, die proseleukidisch eingestellt waren, und musste ins Ostjordanland fliehen. Dort nahm er sich beim Regierungsantritt von Antiochus IV. Epiphanes (175–167 v. Chr.) im Jahre 175 v. Chr. das Leben (Flav. Jos. Ant. XII, 4, 2–11 [160–236]).23
Der Jerusalemer Zweig der Tobiaden dagegen kämpfte wohl weiterhin in Jerusalem um Einfluss und stellte sich gegen den Hohepriester Onias II. und seine Familie. Josephus berichtet, dass es die Tobiaden waren, die Menelaos unterstützten, als er das Hohepriesteramt von Jason, dem Bruder des Onias, erwerben wollte. Nach Josephus waren es auch die Tobiaden, die Antiochus IV. ermutigten, Judäa zu besetzen, ihm ihren Dienst dort anboten und ihn ermunterten, die griechische Lebensweise in Jerusalem zu fördern (Flav. Jos. Ant. XII, 5, 1 [237–241]).24
Die Nachricht, dass die „Brüder“ der Tubianer (ἐν τοῖς Τουβίου) von den umwohnenden Syrern angegriffen und versklavt wurden (1 Makk 5,13) sowie dass Judas den „Tubianer“ genannten Juden in Charax zu Hilfe eilte (2 Makk 12,17) belegt, dass auch nach dem Tod Hyrkanus’ im Ostjordanland Anhänger oder sogar Zugehörige zu diesem Zweig der Familie lebten.25 Beim Kampf gegen die Seleukiden leisteten wiederum die Reiteroffiziere Sosipatros und Dositheus, die ebenfalls mit den Tobiaden in Verbindung gebracht werden können (hierzu eine Lesart von 2 Makk 12,35), Judas tatkräftige Unterstützung (2 Makk 12,19.24.35).26
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Tobiaden eine alte Familie waren, die wahrscheinlich schon vorexilisch nicht nur in Jerusalem bedeutenden Einfluss besaß, sondern auch im Ostjordanland über ein großes Territorium verfügte. Dies findet, wie die Überlieferung bei Nehemia zeigt, nach dem Exil seine Fortsetzung; allerdings wird das Bild etwas getrübt, insofern die Familie ihren Stammbaum nicht deutlich belegen kann. In der Zeit des 3. und 2. Jh. v. Chr. erscheinen die Tobiaden als eine in hohem Maße hellenisierte Familie, die weiterhin ihre Machtbasis im Ostjordanland hatte, aber auch in Jerusalem und Juda politisch machtvoll agierte. In der Gemengelage von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen nach der Rückkehr aus dem Exil unter den Persern bzw. in der hellenistischen Zeit sowie vor dem Hintergrund von innerfamiliären Streitigkeiten scheint es für die Familie der Tobiaden immer wieder einen erheblichen Legitimationsbedarf gegeben zu haben. Vor diesem Hintergrund wurde in der Forschungsliteratur auch die These vertreten, dass die Erzählung als Familiensaga des Tobiadenclans diente, die das Image desselben in einem positiven Licht darstellen sollte.27
1,1: GenealogieSowohl der Name Tobit als auch die in der Genealogie genannten Namen weisen enge intertextuelle Bezüge zu anderen biblischen Schriften auf.
| Text | Mögliches Äquivalent in MT | Septuaginta | Bedeutung | Bemerkungen |
| Tobit – Tωβίθ | טוביה– Neh 2,10 u. ö.bzw. טוביהוnur in 2 Chr 17,8s. a. Tobiël | ΤωβιαΤωβιας | „Jhwh ist gut“ | |
| Tobiël –Tωβιήλ | טבאל– Jes 7,6; Esr 4,7 | Ταβεήλ | „El ist gut“ | |
| Hananel – Ἃνανιηλ | Name eines Turmes חננאל– Sach 14,10; Neh 3,1; 12,39vgl. auch חנני / חנניה / חנניהו | Ανανεήλ Ανανι/Ανανια/Ανανιας | „El ist gnädig“ | Tob 1,8 kennt Hananel als „Vater“ im Sinne eines Vorfahren |
| Aduël – Ἀδυήλ | in MT nicht belegt; evtl. עדיאל– 1 Chr 4,36 | Εδιήλ | „Ein Schmuck ist Gott“ | |
| Gabaël – Γαβαήλ | in MT nicht belegt | nur in Tob | „Gott hat erhoben“ | Person, bei der Tobit das Geld deponiert hat (1,14; 4,1.20 u. ö.). |
| Rafaël – Ραφαήλ | רפאלals Name einer Person nur in 1 Chr 26,7 | Ραφαήλ | „Gott heilt“ | vgl. den Namen des Engels (3,16 GI; 3,17 GII); ferner äthHen 9,1; 20,3; 22,4 u. ö. |
| Raguël –Ραγουήλ | רעואלGen 36,4.10.13; Ex 2,18 u. ö. | Ραγουήλ | „Freund Gottes“ | Name des Brautvaters (vgl. 3,7.17 u. ö.); vgl. den Namen eines Engels in äthHen 20,4; 23,4. |
| Asiël –Ἀσιήλ | יחצאל – der Erstgeborene Naftalis – Gen 46,24; Num 26,48 עשׂיאל – ein Vorfahre Jehus – 1 Chr 4,35 (nicht zu Naftali gehörig) | ἈσιήλἈσιήλ | Asiël ist der Einzige unter den hier genannten Vorfahren Tobits, der auch im MT dem Stamm Naftali zugerechnet wird. |
Auffällig bei all diesen Namen ist die Tatsache, dass sie das theophore Element „El“ enthalten und somit ihre Träger indirekt als fromme Personen charakterisieren.28 Durch die Konstanz im Stammbaum klingt zudem auch eine gewisse „Traditionstreue“ dieser Familie an.29 Der Stammbaum findet am Ende noch eine konkrete Präzisierung, wenn der Stammvater „Asiël“ mit dem Terminus σπέρμα in der Bedeutung von „Sippe, Clan“ verbunden und dieser wiederum dem Stamm (φυλή) Naftali zugeschrieben wird. Φυλή und σπέρμα sind in Verbindung mit πατριά bzw. γένος Teil des genealogischen Systems Tob, das in immer kleiner werdenden Einheiten die Organisation des gesamten Volkes zeigt.30
1,1: NaftaliTobit gehört dem Stamm Naftali an. Naftali war der zweite Sohn Jakobs mit Rahels Magd Bilha (Gen 30,7f.; 35,25; 46,24f.) und steht für den entlang dem Ostrand des unter- und obergaliläischen Gebirges lebenden Stamm. Die Frage, warum ausgerechnet ein Repräsentant des Stammes Naftali in Tob eine so bedeutende Rolle spielt, wird durch den Fortgang der Erzählung deutlich, wo die symbolische Bedeutung dieses Stammes zum Ausdruck kommt: Naftalis Bewohner waren nach der biblischen Darstellung die Ersten in der Geschichte Israels, die unter der Aggression einer Großmacht exiliert wurden (1,2; siehe 2 Kön 15,29).
1,2: ExilierungDer Erzähler weiß zunächst, dass der Protagonist unter dem assyrischen König Salmanassar V. (726–722 v. Chr.) in die Gefangenschaft geführt wurde (αἰχμαλωτεύω pass.). Damit spielt er auf die biblische Überlieferung von der Exilierung der Nordstämme an und gibt die Assyrerherrschaft als den zeitlichen Rahmen, in dem die Geschichte spielen soll, vor. Im Zuge der aggressiven Expansionspolitik unter Tiglat-Pileser III. (744–727 v. Chr.) löschte das neuassyrische Reich im Jahre 722 v. Chr. das Nordreich Israel aus und stellte dann für fast einhundert Jahre eine ständige Bedrohung für das Südreich Juda dar. Im letzten Drittel des 7. Jh.s v. Chr. aber schwand seine Kraft zusehends, und so konnte die Hauptstadt Ninive im Jahr 612 v. Chr. von den miteinander verbündeten Babyloniern und Medern erobert und zerstört werden.31
Allerdings liegt hier ein deutlicher Unterschied zur biblischen Überlieferung vor: König Salmanassar wird in 2 Kön 17,3 und 2 Kön 18,9 als der Eroberer Samarias vorgestellt, dessen Handeln zum endgültigen Ende des Nordreichs führte (722 v. Chr.).32 Die Exilierung Naftalis, die den Hintergrund für Tobits Geschick bildet, fand bereits zur Zeit des Königs Pekach (732 v. Chr.) unter König Salmanassars Vorgänger und Vater Tiglat-Pileser III. (744–727 v. Chr.) statt. Diese Vermischung der geschichtlichen Angaben könnte im Sinne einer historischen Fiktion verstanden werden, die markante Elemente der Exilierung kombiniert, um so zu einer idealtypischen Konstellation zu gelangen;33 vielleicht handelt es sich auch um einen schlichten historischen Irrtum. Jedenfalls wird Tobit als das prototypische Opfer aggressiver Weltmachtspolitik präsentiert.34
1,2: Tobits „Heimat“Die detaillierten Ortsangaben lassen sich durch biblische Bezüge genauer fassen, allerdings wirft die Zusammenstellung im Einzelnen auch verschiedene Probleme auf, da nur „Kydios“ und „Asser“ im Stammesgebiet Naftali eindeutig lokalisiert werden können; „Tisbe“ und „Phogor“ dagegen weisen in das Ostjordanland.35
– Die Ortsangabe „Tisbe“ stellt vor die Frage, wie sich dies mit der Herkunft Tobits aus dem Stamm Naftali vereinbaren lässt. Eine Ortslage Tisbe im Stammesgebiet Naftali ist nicht bekannt (vgl. Jos 19,32–39), vielmehr erinnert diese geographische Bezeichnung an Tisbe in Gilead, das als Heimat des Propheten Elija gilt (vgl. u. a. 1 Kön 17,1). Erschwerend kommt hinzu, dass die Ortslagen „Kydios“ und „Asser“, die im Folgenden genannt werden, eindeutig im Stammesgebiet Naftalis zu verorten sind. Vor diesem Hintergrund wollte Józef Milik, der nachdrücklich für eine Verbindung von Tob mit der Tobiadendynastie plädierte, Tisbe mit Ṭûbâs identifizieren, einer Ortslage ca. 20 km nordöstlich von Nablus an der alten Römerstraße zwischen dem Wadi al-Far‘â und dem Dorf Teyâṣîr gelegen. Wolfgang Zwickel setzt Tisbe hier mit Khirbet Harrawi / Khirbet Harrah / Qeren Naftali gleich. Die Ortslage liegt, so Zwickel, „unmittelbar an der Abbruchkante zum Huletal hin. Von hier aus kann man das ganze Hulebecken bestens überblicken.“36 Von daher passe diese Identifizierung in der Tat zu der Angabe, dass Tisbe „oberhalb von Asser/Hazor“ liegt. Ein weiteres Argument für diese Lokalisierung leitet sich aus der Tatsache ab, dass die beiden im Folgenden genannten Orte Asser/Hazor und Kedesch eindeutig zuzuordnen seien; wenn diese Orte wirklich existieren, sei es nicht plausibel, dass es sich bei den beiden anderen Orten „um fiktive Lokalisationen handeln“ solle.37 In Qeren Naftali befand sich eine große Festungsanlage, die wohl in hellenistischer Zeit massiv ausgebaut wurde; vermutlich handelte es sich um eine seleukidische Garnison, die die Hauptwasserquelle des Hulebeckens und die nach Norden gehende Handelsstraße überwachte. Das Fort wurde wohl um 145/144 v. Chr. von hasmonäischen Truppen erobert und besetzt, und die Einrichtung einer Miqwe in dieser Anlage deutet auf eine dauerhafte jüdische Existenz. Die Stadt wurde dann im Jahre 38/37 v. Chr. erobert. Zwar ist nicht klar, wer hinter diesem Angriff stand, aber nun wurde die Miqwe zugeschüttet und in einen Kochplatz verwandelt, an dem man auch Schweineknochen fand.38
– Kydios wird mit dem heutigen Tel Kedesch / Tell Qedes, dem biblischen Kedesch auf dem Stammesgebiet Naftalis in Obergaliläa, identifiziert (Jos 20,7; 21,32). Vermutlich ist der Ort auch mit der Stadt gleichzusetzen, die Tiglat-Pileser III. (744–727 v. Chr.) nach 2 Kön 15,29 erobert hat. Auch die Schlacht zwischen dem Hasmonäer Jonatan (161–142 v. Chr) und dem Seleukiden Demetrius II. (145–140 v. Chr.) um 144 v. Chr. fand wohl an diesem Ort statt (siehe 1 Makk 11,63.73 und Flav. Jos., Ant. XIII, 5, 6f. [154–162]). Die Ortslage ist von Kedesch-Naftali in Untergaliläa zu unterscheiden (zu Kedesch-Naftali siehe zu 1,8).39 Verschiedene Ausgrabungen belegen die Bedeutung des Ortes als regionales Zentrum und strategisch wichtige Ortschaft. Man entdeckte dort auf einem perserzeitlichen Fundament ein monumentales hellenistisches Gebäude, das aufgrund seiner Größe kein gewöhnliches Wohnhaus gewesen sein kann. So schloss man, dass es sich um ein administratives Gebäude gehandelt haben muss; verschiedene Siegel präsentieren ein breites Spektrum persischer und griechischer Motive, die auf aktive Handelsbeziehungen der Bewohner und einen gehobenen Lebensstil schließen lassen. Zudem zeigt sich ein enger Bezug zur phönizischen Welt, so z. B. durch den Fund eines Siegels, auf dem die Göttin Tanit dargestellt ist. Stempelabdrücke auf Amphorenhenkeln können auf die Zeit zwischen 180 und 145 v. Chr. datiert werden; für die Zeit um 145 v. Chr. ist ein Brand festzustellen, der wohl gezielt im Archivbereich gelegt wurde, und bereits zu Beginn der Ausgrabungen stellten die Ausgräber die Vermutung auf, der Ausbruch des Feuers stehe in Zusammenhang mit dem Kampf Jonatans gegen Demetrius II. (144 v. Chr.). Während der makkabäisch-hasmonäischen Expansionsbewegung hat der Ort seine Bedeutung als regionales Verwaltungszentrum verloren, wurde aber dann nach dem Feuer wieder besiedelt und bestand bis ins frühe 1. Jh. v. Chr. Dabei zeigt sich wiederum der Einfluss des phönizischen Kulturbereiches. Anscheinend gelang es den Hasmonäern nicht, das Gebiet dauerhaft unter Kontrolle zu bringen.40
– Asser wird in der Regel mit dem vormaligen kanaanäischen Stadtstaat Hazor gleichgesetzt; wie Kedesch wird diese Ortslage in der Ortsliste des Stammes Naftali erwähnt (vgl. Jos 19,36f.). Man fand dort Spuren, die auf die Errichtung einer assyrischen Zitadelle hinweisen, die wohl bis in die persische und griechische Zeit Bestand hatte. „Eine flächendeckende Wiederbesiedlung der eisenzeitlichen Großstadt ist nach der assyrischen Eroberung auszuschließen. In hellenistischer Zeit existierte dort eine kleine unbedeutende Siedlung in der Größe von 1 Hektar.“41
– Die Ortslage eines galiläischen Phogor ist biblisch nicht belegt. Stattdessen verweist der Name wieder auf das Ostjordanland, denn ein Berg namens Φόγωρ (Num 23,28LXX; vgl. Pegor) wird in Moab lokalisiert. Zwickel möchte annehmen, dass man Fogor/Phogor in der Nähe von Tisbe suchen muss, „und zwar im Hulebecken selbst. Das südliche Hulebecken war in hellenistischer Zeit abgesehen von Hazor unbesiedelt. Ein optimaler Kandidat wäre jedoch Tell Naama […], eine Ortslage, die in hellenistischer Zeit wiederbesiedelt wurde, nachdem sie nahezu ohne Unterbrechung seit dem Neolithikum bis vermutlich 732 v. Chr. bewohnt war.“42
Insgesamt deuten die Angaben darauf, dass die Figur Tobits mit Obergaliläa als Herkunftsort in Verbindung gebracht werden soll. Dort lebten auch nach der assyrischen Deportation noch Menschen der vormaligen Stämme. Im Gegensatz zu Samaria hören wir an keiner Stelle davon, dass die Assyrer in Galiläa fremde Bevölkerungselemente ansiedelten (vgl. dagegen 2 Kön 17,24). 2 Chr 30,5–10 weiß jedenfalls, dass Hiskija auch in den Norden aussandte, um diejenigen, die der Gewalt der Assyrer entronnen waren, zum Passahfest nach Jerusalem zu laden, und 2 Chr 34,6 berichtet, dass Joschija bei seiner Reform auch Altäre und Götterbilder „in den Städten von Manasse und Efraim, von Simeon bis nach Naftali“ zerstören ließ. Auch wenn die Aussage selbst keinen Anspruch auf Historizität haben kann, spiegelt sich in ihr zumindest die Tatsache wider, dass der Chronist ein solches Vorgehen Joschijas für möglich und wohl auch für nötig hielt. Allerdings ist es schwierig festzustellen, wie groß die vormalig israelitische Bevölkerung in diesem Gebiet war. 1 Makk 5,21–23 lässt darauf schließen, dass zur Zeit des Makkabäeraufstandes eine solche Minderheit in einem überwiegend paganen Territorium lebte; nach der hasmonäischen Eroberung wurden zahlreiche pagane Siedlungen in ganz Galiläa in jüdische Siedlungen umgewandelt, sodass man geradezu von einer Judaisierung Galiläas sprechen kann (siehe hierzu insbesondere die Eroberungen unter Aristobul I. [104–103 v. Chr.]; Flav. Jos. Ant. XIII, 11, 3 [318]).43
Die biblischen Angaben sind mit dem archäologischen Befund zu korrelieren. Diese zeigen, dass die Besiedlung dieser Gegend im Übergang von der persischen zur hellenistischen Ära intensiviert wurde, wobei zunächst vor allem phönizische und hellenistische Einflüsse zu greifen sind. Archäologische Funde wie Miqwen und Steingefäße oder das Verschwinden von paganen Münzen bzw. die Zerstörung paganer Heiligtümer weisen darauf hin, dass die hasmonäische Eroberung einen kulturellen Wandel in der Region mit sich brachte. Ausgeprägte jüdische Präsenz ist in Yodfat und Sepphoris nachzuweisen; aber auch die Orte Khirbet Shura, Khirbet el-Kerak, Qeren Naftali, Betsaida, Mizpe Yamim, Horvat Be’er Sheva, Horvat Tefen und Tel Kedesch legen solche kulturellen Veränderungen nahe.44
Bemerkenswert ist, dass die konkreten Ortsangaben am Anfang dieser Erzählung nicht allein durch biblische Referenzen erklärt werden können, vielmehr liegt hier ein Detailwissen vor, das die Tobitfigur bewusst im nördlichen Galiläa verankern möchte. Der Verfasser des Buches (bzw. der einleitenden Überschrift) scheint auf jeden Fall eine gute Kenntnis der Region Galiläas gehabt zu haben. Ob man daraus ableiten kann, dass der Erzähler aus dieser Gegend stammte,45 sei einmal dahingestellt. Zumindest lassen die konkreten Angaben darauf schließen, dass der Erzähler die Verbindung Tobits mit Galiläa betonen wollte und dass durch diese Figur, die im Folgenden als exemplarischer Frommer und Jerusalempilger gezeichnet wird, auch die Bedeutung dieser Region und ihr Bezug zu Jerusalem ideell gestärkt wurde.