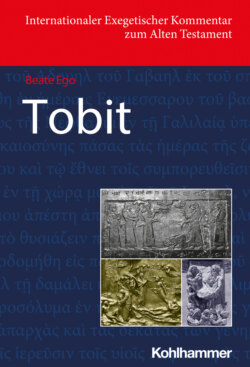Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kanonizität und Wirkungsgeschichte Kanongeschichtliche Aspekte
ОглавлениеAntikes JudentumDie Erzählung erfreute sich im 1. Jh. v. Chr. im Land Israel einer großen Beliebtheit. Dafür sprechen ihre Bezeugung unter den Texten vom Toten Meer und ihre Übersetzung vom Aramäischen ins Hebräische, durch welche das Buch die Aura einer altehrwürdigen Schrift erhielt. Auch die Übersetzung ins Griechische, die uns heute im sog. Langtext vorliegt und die sich eng an der aramäischen bzw. hebräischen Textform orientiert, belegt eine hohe Akzeptanz des Buches im Judentum der hellenistischen Zeit. Aus Gründen, die sich nicht mehr genau eruieren lassen, scheint das Buch in der jüdischen Tradition aber im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte an Akzeptanz und Bedeutung verloren zu haben. Gegen seine Aufnahme in den Kanon sprach vielleicht, dass es ursprünglich nicht auf Hebräisch verfasst worden war; aber auch inhaltliche Faktoren, etwa die kritische Auseinandersetzung mit Engelsvorstellungen, wie sie für das rabbinische Judentum typisch ist, könnten zu einer solchen Marginalisierung beigetragen haben.163 Es wurde auch vorgeschlagen, dass die Darstellung der Rolle der Frauen (insbesondere der Hannas, die ihrem Mann ganz selbstständig Paroli bietet) den Rabbinen missfiel.164
So findet sich weder in der Liste der biblischen Bücher bei Josephus in Contra Apionem (I, 8 [38]) noch in der rabbinischen Baraita bBB 14b ein Hinweis darauf, dass das Tobitbuch zu den heiligen Schriften gezählt würde. Auch die Zeugnisse der Kirchenväter unterstützen dieses Bild. Origenes (185–254) weiß zu berichten, dass das Buch zwar in den Kirchen gelesen wird, nicht aber von den Juden, die es auch nicht in hebräischer Sprache besitzen,165 und Hieronymus schreibt in seiner Einleitung zur Übersetzung des Buches in der Vulgata: Die „Hebräer scheiden das Buch aus der Liste der heiligen Schriften aus und schlagen es jenen zu, die sie Hagiographen nennen.“166
Alte Kirche und MittelalterWährend das Tobitbuch in der jüdischen Überlieferung eine zunehmende Marginalisierung erfuhr, erfreute es sich in der Alten Kirche großer Beliebtheit und genoss in der Tradition des Westens über Jahrhunderte hin kanonischen Status. Da Johannes Gamberoni das Material in seiner Studie zur Auslegungsgeschichte des Tobitbuches aus dem Jahre 1969 vorbildlich zusammengestellt hat, können hier einige grundlegende Hinweise genügen. Wenn die Bischöfe Hieronymus drängen, er solle das Buch ins Lateinische übersetzen, so zeigt sich die Bedeutung, die dieser Text für den Westen am Ende des 4. Jh.s hatte. Auch die einschlägigen Kanonverzeichnisse können Tobit auflisten. Zwar gab es immer wieder auch einzelne Stimmen, die dem Buch Tobit sein Recht bestritten, unter die Bücher der Heiligen Schriften gezählt zu werden. All diese Diskussionen hatten auf die Praxis freilich jahrhundertelang keinen Einfluss.167 Für den Westen ist es die Fassung der Vulgata, die in ihrer Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte bedeutsam wurde.
Humanismus und ReformationEine solch positve Einstellung soll sich erst um die Wende vom 15. zum 16. Jh. im Gefolge von Renaissance und Humanismus ändern. Explizite Kritik am Inhalt des Buches wurde zum ersten Mal bei dem Freiburger D. A. Pelargus (1493/94–1531) laut. Dieser Humanist hatte das Buch zunächst einer eigenen Vorlesung für Wert befunden, zeigte sich dann aber – wie aus einem Brief an Erasmus von Rotterdam (ca. 1466–1536) hervorgeht – bald tief enttäuscht. Das Buch lasse einen kalt, sei hausbacken („jeiunus“) und vieles daran sei sehr dunkel, vor allem in der griechischen Version der Septuaginta. Auch Erasmus von Rotterdam äußerte eine ausgesprochen distanzierte Haltung zu diesem Buch.168
Die grundlegende kanonische Akzeptanz des Buches änderte sich – trotz gelegentlicher Kritik – erst im Zeitalter der Reformation, in dem die Maxime „ad fontes“ dazu führte, dass es – im Gegensatz zur katholischen Tradition – aus dem protestantischen Kanon ausgeschieden und nun zu den Apokryphen gezählt wurde. Der entscheidende Schritt zur De-Kanonisierung des Buches in der protestantischen Überlieferung kam von Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt (1486–1541). Für ihn war der Umfang des jüdischen Kanons das entscheidende Kriterium dafür, ob ein Buch auch in der christlichen Tradition als kanonisch oder nicht-kanonisch zu betrachten sei. Alles andere, wie die kirchliche Praxis oder die Bekanntheit des Verfassers, sei dagegen als sekundär zu erachten. Somit waren alle Bücher, die nicht im jüdischen Kanon enthalten waren, von vornherein auch für den christlichen Kanon ausgeschlossen. Da aber auch die Apokryphen wertvolle Wahrheiten enthalten, dürfe man diese Überlieferungen nicht verachten. Aber ihre Autorität komme nicht aus den Apokryphen selbst, sondern vielmehr, insoweit deren Wahrheiten auch in den kanonischen Schriften selbst enthalten seien.169
Was Karlstadt in der Theorie darlegte, wurde dann von dem Drucker Johannes Knoblauch in Straßburg in die Tat umgesetzt. Am 21. November 1522 brachte er eine Vulgata des Alten Testaments in insgesamt sechs Bänden heraus, wobei nun – im Gegensatz zu älteren Ausgaben – die deuterokanonischen Bücher getrennt in dem letzten Band zusammengefasst waren. Dieser trug den Titel: „Bücher, die von den Juden nicht als kanonisch angenommen sind“.170 Diese Tendenz, sich auf einen engeren Kanon zu beschränken, wurde durch das Erscheinen von jüdischen Druckausgaben der Hebräischen Bibel, die in dieser Zeit aus Italien kamen,171 verstärkt.
Martin Luthers Entscheidung, die Apokryphen aus dem Kanon auszuscheiden und diese nur als „gut und nützlich zu lesen“ zu klassifizieren, war somit zu seiner Zeit sowohl theoretisch als auch praktisch vorgezeichnet, und die Notwendigkeit, dieses Vorgehen explizit zu erklären, schien sich damit zu erübrigen. Vor diesem Hintergrund liest sich freilich Luthers Vorrede zum Tobitbuch von 1530 fast wie eine Apologie des Buches. So stellt er den alten Tobit nicht nur als Vorbild an Glaubenstreue, Geduld und dem Tun guter Werke dar, sondern betont auch die Kontinuität zwischen der hebräischen Dichtung der Bibel und der griechischen Dichtung. Wenn er das Tobitbuch mit dem Werk „eines feinen hebräischen Poeten“ vergleicht, „der keine leichtfertigen, sondern die rechten Sachen handelt und über die Maßen christlich treibt und beschreibt“,172 so deutet Luther zumindest an, dass das Buch Tobit, wenn auch auf Griechisch verfasst, doch dem Ideal der „Veritas Hebraica“ zu entsprechen vermag – von den hebräischen Fragmenten, die noch jahrhundertelang in der Judäischen Wüste auf ihre Entdeckung harren sollten, konnte Luther nichts ahnen.173
Für die katholische Kirche wurde dann, wie allgemein bekannt, die Kanonizität des Tobitbuches als Reaktion auf die Reformation im Konzil von Trient 1546 definitiv festgelegt, und es wird seitdem in dieser Tradition zu den sog. „Deuterokanonen“ gezählt.174