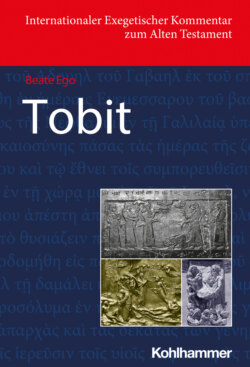Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gesamtinterpretation
Оглавление„Kern“Die Geschichte erzählt in ihrem Kern (zum Umfang siehe „Literarkritik“) von zwei Heilungen, nämlich von der des frommen erblindeten Tobit und von der Saras, die von einem Dämon belästigt wird, welcher ihre potentiellen Ehemänner tötet. Dieser Aspekt verbindet sich mit dem Reisemotiv und dem Schutz auf dem Weg sowie einem narrativen Diskurs über die theologische Dimension von Heilungspraktiken. In Tob begegnen die beiden verschiedenen Krankheitstypen, die für die vorhippokratische Medizin in der Alten Welt typisch sind, nämlich zum einen der pragmamorphe und zum anderen der biomorphe Typ. Für beide gilt: Heilung ist nur durch eine „Medizin“ zu finden, deren Wirksamkeit über den Engel von Gott (der in der Erzählung der eine Gott und der Gott Israels ist) offenbart wird. Somit findet eine Legitimierung magisch-medizinischer Praktiken im Rahmen der Jahwereligion statt. Gleichzeitig könnte hier auch eine klare Position gegenüber dem Versuch, medizinisches Wissen als eine menschliche Errungenschaft und damit innerweltlich zu konzipieren – so ein Diskurs im griechischen Denken der hellenistischen Zeit –, zu finden sein.
Ein weiteres für die Erzählung wichtiges Thema ist das der Barmherzigkeitstaten. Es steht im Kontext eines theologischen Diskurses, der sich mit der Gültigkeit des Tun-Ergehen-Zusammenhangs auseinandersetzt. Während Tobits Erblindung der Vorstellung einer gerechten Belohnung für solidarisches Handeln diametral entgegenzustehen scheint, zeigt seine Heilung (wie auch die eingeflochtene Achikarreferenz), dass Barmherzigkeitstaten letztlich doch eine gerechte Belohnung erfahren. Die Erzählung kann hier als narrative Veranschaulichung der Weisheitslehre des Siraziden verstanden werden, die unermüdlich den Wert der Barmherzigkeitstaten betont und eine Belohnung für dieselben in Aussicht stellt (so z. B. Sir 1,12f.[12f.18f.]), aber auch das Motiv der Demütigung und Prüfung durch Leiden kennt (Sir 2,1–18[22–23]). Damit ist der ethische Impuls der Erzählung nicht zu übersehen.
Zudem betont der Erzähler die Rolle des Gebets und des göttlichen Lobpreises. Dabei kommt dem Engel als Mittler (und nicht als einem Wesen, das selbst Anbetung erfahren soll) besondere Bedeutung zu. So findet implizit eine Abgrenzung gegen die religiöse Verehrung von Engelwesen statt. Durch die zahlreichen intratextuellen Bezüge wird die Erzählung ganz in die altehrwürdige Tradition Israels eingebunden, wobei die Erzelternerzählungen eine ganz besondere Rolle spielen. Damit entsteht der Eindruck der Beständigkeit der göttlichen Zuwendung zu seinem Volk über die Generationen hinweg.
Auch wenn die Belege für Exil und Rückkehr vornehmlich (wenn auch nicht ausschließlich) im Rahmenteil des Buches (1,2f.10; 13; 14; siehe unten) erscheinen, bilden sie doch den allgemeinen Verstehenshintergrund für die Interpretation des gesamten Geschehens. Insofern die Geschichte in der Diaspora spielt, bezeugen die Heilungen und die erfolgreiche Reise ganz generell Gottes Schutz und Zuwendung zu seinem Volk auch außerhalb des Landes und fernab von Jerusalem. Im Kontext der Exilsthematik erfolgt auch eine Aktualisierung und Neuauslegung der Tora, als für das Leben im Exil vor allem das Endogamiegebot sowie die Fürsorge für die Armen als zentrale Bestimmungen akzentuiert werden. Diese Elemente implizieren – wie auch die Distanzierung von den Speisen der Völker – eine Abgrenzung nach außen, mit der nach innen ein stärkerer Zusammenhalt und wachsende Solidarität korrelieren. Es erfolgt so der Versuch, die Identität des Volkes in einer Minderheitensituation zu stabilisieren.
Durch das Medium des Gebets besteht zudem auch in der Diaspora die Möglichkeit, in Verbindung mit Gott zu treten, und Gottes Engel vermittelt den Seinen dessen helfende und heilende Zuwendung. Das Exil erweist sich damit – allem äußeren Anschein zuwider und trotz der dort erfahrenen Unsicherheit und Verfolgung – als ein Ort der Gottesnähe. Somit entfaltet der Erzähler grundlegende Koordinaten für das Leben im Exil, um auch dieses als Ort für Erfahrung der Hilfe Gottes verstehen zu können.
„Rahmen“Die Rahmenteile, die die Exilsituation und den Bezug zu Jerusalem betonen (zum Umfang siehe „Literarkritik“), stellen die Erzählung in einen geschichtstheologischen Kontext. Dabei kommt der Stadt Ninive eine Signalwirkung zu: Die Stadt steht am Anfang des Buches als pars pro toto für die assyrische Aggression und Machtentfaltung (1,3) und hat aufgrund der Rolle der assyrischen Expansion für die Geschichte Israels paradigmatischen Charakter. Tobit erscheint als das prototypische Opfer brutaler Weltmachtspolitik. Die Turbulenzen, in die er gerät, spiegeln die Unsicherheit der Existenz eines Deportierten. Insofern das Buch aber mit einem eschatologischen Geschichtsausblick und dem Untergang Ninives endet, bringt der Erzähler deutlich zum Ausdruck, dass Israel dank der Zuwendung seines Gottes letztlich diese Krise des Exils bewältigen wird. Somit steckt die Erzählung nicht nur die Koordinaten für ein Leben in der Diaspora ab, sie reagiert auch mit einem Zukunftsentwurf auf die geschichtstheologische Herausforderung der Exilserfahrung und der Konfrontation mit der Expansionspolitik der Großreiche.139 Die Problematik der Theodizee wird dabei durch den Rückgriff auf die dtn.-dtr. Theologie beantwortet: Die Aufgabe des Menschen besteht in der Umkehr und im Gebet.
„Kern“ und „Rahmen“Weitere zentrale Komponenten zum Verständnis der Gesamterzählung ergeben sich aus dem Zusammenspiel zwischen den Rahmenteilen und der Kernerzählung: Die Rahmung, die Jerusalem zum inhaltlichen Haftpunkt hat, unterstreicht zunächst das Diasporasetting; das Exil erscheint eindeutig als Interim. Von entscheidender Bedeutung ist aber vor allem die Tatsache, dass sich insgesamt eine enge Verschränkung der individuellen Geschichte Tobits und Saras mit der Geschichte des Volkes und somit dem kollektiven Aspekt findet. Hier spielen zunächst Stichwortverbindungen eine zentrale Rolle. Ein Schlüsseltext sind Aussagen in Tobits Hymnus (13,2.5.6a–d.9), wo Tobit Gott dafür preist, dass er das Volk wegen seiner Sünden züchtigt (μαστιγόω), sich ihm aber auch gnädig wieder zuwenden wird (ἐλεέω). Durch die Verwendung des Begriffes μαστιγόω entsteht hier ein Bezug zu Tobits Deutung seines eigenen Schicksals als Züchtigung (11,15).
Tobits Hymnus weist auch enge Bezüge zu seinem Gebet (3,1–6) auf: Die Sentenz, dass Gott in die Unterwelt hinabführt und von dort auch wieder heraufholt (13,2), erinnert an Tobits Todeswunsch (3,6), wonach er wieder zur Erde werden möchte, und das Motiv des Exils als Bestrafung verweist auf Tobits Bekenntnis, dass er an den Sünden seines Volkes partizipiert (3,3–5). Schließlich sind der Hymnus Tobits (13,1–18) und sein Gebet (3,1–6) auch durch das Motiv des göttlichen Angesichts miteinander verbunden: Während Tobit in seinem Gebet die Nähe Gottes und die Erlösung darin sucht, dass Gott ihn sterben lässt (3,6), erscheint Gottes Angesicht im Hymnus im Kontext der Umkehr des Volkes und der erneuten göttlichen Zuwendung im Horizont der nationalen Erlösung durch die Rückkehr aus dem Exil (13,6).
Auch der Begriff ἐλεέω (13,5.6) verbindet die Aussage vom göttlichen Erbarmen mit dem Kern der Geschichte. In ihrem gemeinsamen Gebet preisen Raguël und seine Frau Gott für seine Barmherzigkeit gegenüber Tobias und Sara in der Hochzeitsnacht (8,16f.), und Tobit wiederum versteht die Heilung von seiner Blindheit als Ausdruck des erbarmenden Handelns Gottes, das er in Ninive öffentlich lobt (11,17).
Schließlich wird der Hymnus Tobits noch durch den Begriff ταλαίπωρος, „elend“, mit der Gesamthandlung verknüpft. Während der Hymnus den Wunsch äußert, dass in Jerusalem allen Elenden Liebe erwiesen werde (13,10), charakterisiert Raguël bei seiner Begrüßung der Reisenden Tobits persönliches Schicksal und seine Erblindung als „böses Elend“ (7,7).
Ein weiteres Stichwort für die Verbindung der kollektiven mit der individuellen Sphäre ist das des Schmerzes. So kann Tobit in seinem Geschichtsausblick davon sprechen, dass das Haus Gottes in Jerusalem nach der Zerstreuung der Israeliten in die Gefangenschaft „im Schmerz“ (λύπη) sein wird (14,4). Das Stichwort „Schmerz“ verweist hier intratextuell sowohl auf das Schicksal Tobits als auch auf das Schicksal der Sara, die beide voller Schmerz ihre Gebete sprechen (3,1.6.10). Zudem wünscht Edna ihrer Tochter vor der Hochzeitsnacht, dass Gott ihren Schmerz in Freude verwandeln möge (7,17).140
Weitere Hinweise auf die Verbindung der individuellen Ebene mit der kollektiven finden sich, wenn gleich zu Beginn der Erzählung Tobit als Teil der Gruppe der Exilierten vorgestellt wird (1,3). Tobit nimmt das Wort Am 8,10LXX, das sich in einem Plural an das Kollektiv richtet, für sein eigenes Schicksal in Anspruch, und so wird deutlich, dass er als Repräsentant des gesamten Volkes fungiert.
Auch Tobits Blindheit impliziert eine kollektive Dimension, insofern die Verbindung von Tod und Blindheit durch die biblische Tradition vorgegeben ist und diese Blindheit in einem kollektiven Kontext verorten kann. Blindheit gehört nach Dtn 28,28f.65 zu den Strafen für das untreue Israel (siehe auch Jes 6,9f.). Auf einen kollektiven Bezug des Motivs verweist auch die Beobachtung, dass der Zustand der Blindheit in Beziehung zur Situation des Stammes Naftali gesehen werden kann, da Aussagen vom „Volk, das im Finstern wandelt“ und „das im Lande der Dunkelheit lebte“ (Jes 8,23–9,1) auf diesen Stamm bezogen werden können. Auch der Hymnus mit dem Motiv der Lichtherrlichkeit Jerusalems (13,11; siehe auch die Edelsteine in der Stadt in 13,16–17) ist in diesem Zusammenhang zu verstehen, da es an die Heilung Tobits von seiner Blindheit, die ihn wieder das Licht sehen lässt, erinnert (vgl. 3,17; 5,10; 11,14).
Darüber hinaus verweist auch das Element des Lobpreises auf die Verbindung zwischen Individuum und Kollektiv, insofern Tobit sowohl seinen Sohn (4,19) als auch dessen Kinder (14,8.9) zum Lobpreis Gottes auffordert. Schließlich findet eine Ausweitung dieses Chores auf die gesamte Völkerwelt statt (14,6f.; siehe auch 13,3.6.11).
Wie bereits beim Stichwort λύπη deutlich wurde, steht auch die Figur Saras in einem kollektiven Horizont. Durch die intratextuellen Bezüge über den Namen „Sara“ zu den Klageliedern (siehe Klgl 1,1f. mit Jerusalem als Fürstin [שׂרה]) kann ihre Geschichte als Parabel für das Geschick Jerusalems verstanden werden (siehe zu 3,7). So wird ihre Heilung paradigmatisch für die Erlösung des Volkes.141
Auch im Endogamiegebot klingt letztlich die kollektive Ebene der Erzählung an, da dieses Gebot der Identitätserhaltung und -sicherung des gesamten Volkes dient. In seiner Abschiedsrede macht Tobit die Einhaltung der Endogamieforderung zudem zur Bedingung für den Besitz des Landes (siehe 4,12).
In diesem Kontext ist schließlich auch noch auf die Rolle des Dämons Asmodäus zu verweisen. Er ist nicht nur ein individueller Feind Saras. Da der Dämon mit seiner tödlichen Aggression gegenüber ihren Ehemännern letztlich der Zukunft des gesamten Volkes und der Realisierung der Toratreue entgegensteht, hat seine Vertreibung ebenfalls kollektive Dimensionen.
Fazit: Durch die intratextuellen Bezüge entsteht ein konzises Konzept einer theologischen Geschichtsschau, das die Erzählung vom individuellen Geschick Tobits und seiner Familie übergreift und theologisch in die Geschichte Israels als Teil der Weltgeschichte einbindet. Das Exil ist aber nicht nur Ausdruck der Strafe; die Zerstreuung unter die Völker enthält auch einen positiven Aspekt, insofern sie zu einer Gelegenheit wird, Gott auch unter den Völkern zu preisen. Da die Rettung der Protagonisten für die Adressaten der Erzählung bereits in der Vergangenheit liegt, die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Land und das Neue Jerusalem aber noch nicht erfüllt ist, entsteht eine gewisse Spannung zwischen der Geschichte von der Heilung Tobits und Saras und den eschatologisch ausgerichteten Abschnitten (13; 14,4–7). Die vergangene Rettung der Protagonisten wird so zum Exempel und Hoffnungszeichen der künftigen Zuwendung Gottes zu seinem Volk. Man kann die Erzählung als eine Resilienzgeschichte interpretieren, insofern die Kernerzählung mit dem Wandel vom Schmerz zur Heilung die Entwicklung Tobits zu einer resilienten Persönlichkeit zeigt und ihn gleichzeitig als kollektiven Resilienzträger charakterisiert (zu 13,1 – 14,1a „Wichtige buchinterne Bezüge“). Literarische Mittel wie die emotionale Darstellung des Geschehens dienen dabei den Rezipienten als Identifikationspotential, das die Funktion der Erzählung als individuelle und kollektive Resilienzresource erschließt.142