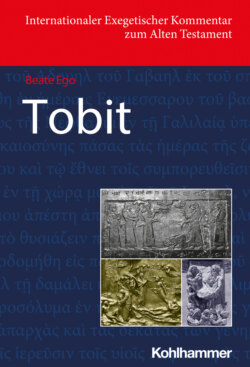Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Textüberlieferung
ОглавлениеÜberblickDie Textüberlieferung des Buches ist komplex. Außer den hebräischen bzw. aramäischen Qumranfragmenten liegen drei verschiedene griechische Textformen vor (der sog. Kurztext GI, der Langtext GII und eine Mischform GIII). Zu den älteren Übersetzungen gehören – neben einer syrischen, sahidischen, äthiopischen und armenischen Version – auch zwei lateinische Fassungen: die Vetus Latina und die Vulgata des Hieronymus. Während die Vetus Latina große Ähnlichkeiten mit dem Langtext GII aufweist, hat die Übersetzung des Hieronymus bei aller Nähe zur Vetus Latina eine ganz eigene Prägung. Darüber hinaus existieren noch fünf spätere, hebräische Textversionen sowie eine aramäische, die sich z. T. bis ins Mittelalter zurückverfolgen lassen. Es handelt sich um Rückübersetzungen der griechischen bzw. lateinischen Texte, die die Überlieferung frei gestalten.9
QumranDie Qumranfunde konnten eindeutig belegen, dass die Erzählung ursprünglich in einer semitischen Sprache verfasst wurde. So wurden im Jahre 1952 in Höhle 4 zahlreiche Einzelfragmente des Textes in aramäischer und hebräischer Sprache gefunden. Insgesamt handelt es sich um vier aramäischsprachige bruchstückhaft erhaltene Rollen (1–4) sowie ein hebräischsprachiges fragmentarisches Manuskript (5):
1. 4QpapToba ar (4Q196) ist auf Papyrus in späthasmonäischer Schrift geschrieben und auf ca. 50 v. Chr. zu datieren. Hier konnten 20 Fragmente von unterschiedlicher Länge identifiziert werden; 30 Teile sind unidentifiziert.
2. 4QTobb ar (4Q197) ist auf braune Lederfragmente geschrieben. Diese Abschrift wurde in frühherodianischer Formalschrift verfasst und kann in die Zeit zwischen ca. 25 v. Chr. und 25 n. Chr. datiert werden. Von dieser Kopie konnten fünf Fragmente identifiziert werden; zwei blieben unidentifiziert.
3. 4QTobc ar (4Q198) besteht aus zwei Fragmenten auf dünnem gegerbtem Leder. Die Schrift kann als späthasmonäische oder frühherodianische „book hand“ mit einigen semikursiven Elementen klassifiziert werden und ist zeitlich ungefähr um 50 v. Chr. anzusetzen. Die beiden Fragmente enthalten anscheinend Teile von Tob 14; allerdings kann das zweite nicht klar zugeordnet werden.
4. 4QTobd ar (4Q199) wird von zwei Einzelfragmenten auf braunem Leder repräsentiert. Der Text ist in hasmonäischer Schrift geschrieben und kann auf ca. 100 v. Chr. datiert werden. Es handelt sich damit um den ältesten uns erhaltenen Text des Tobitbuches.
5. 4QTobe hebr (4Q200), das einzige hebräischsprachige Fragment, besteht aus neun Einzelfragmenten auf Leder. Die Schrift kann als frühe herodianische „formal hand“ bezeichnet werden, die zwischen ca. 25 v. Chr. bis 25 n. Chr. anzusetzen ist. Es sind insgesamt 11 Fragmente enthalten; die Identifizierung von zwei Fragmenten ist unsicher.
Überblick über die Qumranfragmente 4Q196–200
| 4QpapToba ar | 4QTobb ar | 4QTobc ar | 4QTobd ar | 4QTobe hebr |
| 1 1,17 | ||||
| 2 1,19–2,2 | ||||
| 3 2,3 | ||||
| 4 2,10–11 | ||||
| 5 3,5 | 1 3,6–8 | 1 i 3,6 | ||
| 6 3,9–15 | 1 ii 3,10–11 | |||
| 7 3,17 | ||||
| 8 4,2 | ||||
| 9 4,5 | 2 4,3–9 | |||
| 10 4,7 | ||||
| 11 4,21–5,1 | 2 4,21–5,1 | 3 5,2 | ||
| 12 5,9 | 3 5,12–14 | |||
| 13 6,6–8 | 4 i 5,19–6,12 | |||
| 14 i 6,13–18 | 4 ii 6,12–18 | |||
| 14 ii 6,18–7,6 | 4 iii 6,18–7,10 | |||
| 1 7,11 | ||||
| 15 7,13 | ||||
| 5 8,17–9,4 | ||||
| 4 10,7–9 | ||||
| 5 11,10–14 | ||||
| 16 12,1 | ||||
| 17 i 12,18–13,6 | 6 12,20–13,4 | |||
| 17 ii 13,6–12 | 7 i 13,13–14 | |||
| 18 13,12–14,3 | 1 14,2–6 | 7 ii 13,18–14,2 | ||
| 19 14,7 | 2 14,10 (?) | 2 14,10 | 8 ? | |
| 20–49 ? | 6–7 ? | 9 3,3–4 |
Schließlich existiert noch ein Fragment Schøyen Ms. 5234 zu Tob 14,3–6.
Die Fragmente aus Qumran weisen einige Charakteristika auf, die für die Schreiberpraxis in Qumran typisch sind. Das Aramäische wird als Mittelaramäisch klassifiziert, das anderen nichtbiblischen Texten aus Qumran, wie z. B. dem Genesis-Apokryphon oder dem Hiobtargum, ähnelt und in die Zeit zwischen dem 2. Jh. v. Chr. und dem Anfang des 2. Jh.s n. Chr. zu datieren ist. Die Sprache des hebräischen Fragments stellt dagegen ein Beispiel eines spät-nachexilischen Hebräisch dar.
Ein viel diskutiertes Problem seit der Entdeckung dieser Fragmente ist die Frage, welche Textform – die aramäische oder die hebräische – als Original anzusehen ist. Erschwerend für eine Entscheidung ist das Faktum, dass zwar 20 Prozent des aramäischen, aber nur sechs Prozent des hebräischen Textes erhalten sind und es nur wenige Überlappungen der beiden Überlieferungen gibt, sodass ein direkter Vergleich längerer Passagen nicht möglich ist. Insgesamt hat sich in den letzten Jahren die Tendenz zu der Annahme, dass die Erzählung zunächst auf Aramäisch verfasst und dann ins Hebräische übersetzt wurde, verstärkt. Als wichtiges Argument kann angeführt werden, dass die Erzählung aufgrund zahlreicher Motivparallelen als Bestandteil eines breiteren Korpus aramäischer Texte aus der Zeit des Zweiten Tempels verstanden werden kann.10 Durch die Übersetzung des Textes ins Hebräische erhielt das Buch eine größere Autorität.11
Die griechischen VersionenAls weitere Stufe der Textgeschichte lässt sich die Erzählung in den griechischen Versionen greifen, nämlich in
– GI – repräsentiert durch den Codex Vaticanus (4. Jh.), den Codex Alexandrinus (5. Jh.) und den Codex Venetus (8. Jh.) sowie durch eine Anzahl von Minuskelhandschriften;
– GII – repräsentiert durch den Codex Sinaiticus (4. Jh.; es fehlen 4,7–19b und 13,6i–10b) sowie die Minuskelhandschrift 319 (3,6–6,16),
– GIII – repräsentiert durch die Handschriften 106 und 107 (auf 6,9–12,22 beschränkt).12
Seit der Entdeckung des Codex Sinaiticus in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Frage nach dem Verhältnis von GI zu GII zum zentralen Thema der Tobitforschung. Nach langer Diskussion13 hat sich in den letzten Jahren vor dem Hintergrund, dass die Qumrantexte im Wesentlichen der Form des Langtextes entsprechen, zunehmend der Konsens durchgesetzt, dass GII die ältere Textform darstellt, die in GI überarbeitet wurde. Die sprachliche Grundtendenz dieser Revision besteht in einer Kürzung des Textes sowie in seiner Glättung, welche die stark semitisierende Sprachform von GII in ein flüssigeres Griechisch umarbeitet. GIII wiederum kann als eine gegenüber GI und GII nochmals sekundäre Textform bestimmt werden, die grundsätzlich GII zuzuordnen ist, aber auch Textelemente von GI übernommen hat.14 Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen die Überlieferung von Qumran mit der Überlieferung von GI zusammengeht. Dies deutet darauf hin, dass die uns vorliegenden Texte der Version GII nicht deren älteste Version repräsentieren, sondern bereits eine spätere Abschrift eines nicht mehr vorhandenen Originals darstellen, in welche sich im Überlieferungsprozess kleine Veränderungen eingeschlichen haben. Ob diese frühere griechische Version eine hebräische oder aramäische Vorlage hatte, kann wegen der geringen Textbezeugung nicht entschieden werden.15
Lateinische VersionenDie griechischen Texte bilden wiederum die Grundlage für die lateinischen Versionen.
Vetus LatinaDie Vetus Latina, von der bislang keine kritische Edition vorliegt, setzt GII als Vorlage voraus16 und spielt deshalb für die Rekonstruktion von GII eine bedeutende Rolle. Wichtige alte Handschriften sind u. a. Codex Regius 3564, die Alcalà-Bibel und Codex Reginensis 7.17
VulgataAls weitere lateinische Übersetzung ist die Vulgata des Hieronymus aus dem Jahre 404 zu nennen. Nach seinem eigenen Zeugnis, das er in der dazugehörenden Vorrede gibt, entstand diese Übersetzung an einem einzigen Tag. Ein Dolmetscher übertrug den Text vom Aramäischen ins Hebräische, aus welchem Hieronymus dann ins Lateinische übersetzte. Diese Schilderung erklärt den paraphrastischen Charakter des Textes, der sowohl zu den aramäischen Texten aus Qumran als auch zu den griechischen Versionen häufig große Differenzen aufweist. Wenn die Vulgata aber oft eine große Nähe zu der Vetus Latina zeigt, so wird deutlich, dass sich Hieronymus bei seiner Arbeit auch dieser als Vorlage bediente.18
Weitere antike ÜbersetzungenNeben den griechischen und lateinischen Übersetzungen liegt noch eine Reihe weiterer alter Übersetzungen ins Syrische, Koptische, Äthiopische, Armenische, Georgische und Arabische vor. Die syrische Version ist ein Mischtext aus allen drei griechischen Versionen mit z. T. ganz eigenständigen Traditionen.19 Für die anderen Überlieferungen spielt GI als Vorlage eine wichtige Rolle, aber auch andere Lesarten (GIII und auch GII) konnten einfließen.20
Die nach-antiken jüdischen ÜberlieferungenSchließlich existieren noch mehrere nach-antike hebräische sowie eine aramäische Version der Erzählung aus mittelalterlicher bzw. noch späterer Zeit, nämlich „Hebraeus Münster“ (1542; basierend auf Ms. Konstantinopel 1516), „Hebraeus Fagius“ (1542; nach Ms. Konstantinopel 1519), „Hebraeus Londini“ (ed. Gaster 1897; nach dem Ms. der British Library, Add. 11639, 13. Jh.); „Hebrew Gaster“ (ed. Gaster 1897, nach einem verloren gegangenen Manuskript aus dem 15. Jh. von Gaster selbst erstellt [Codex Or. Gaster 28]) und Ozar ha-Qodesch (Druck Lemberg 1851, Manuskript unbekannt) sowie einer aramäischen Version (ed. Neubauer 1878; nach Bodleian Hebrew Ms. 2339).21 Diese Texte, die keine direkten Fortführungen der alten semitischsprachigen Tradition darstellen, sondern vielmehr freie Rückübersetzungen aus dem Griechischen bzw. Lateinischen sind, zeigen sowohl midraschähnliche Erweiterungen als auch paraphrastische Verkürzungen und Auslassungen.22