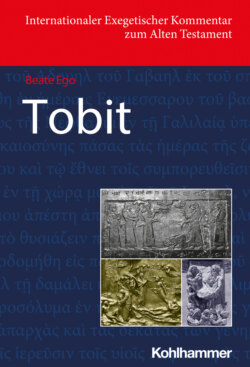Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung Zur Anlage dieser Kommentierung
ОглавлениеDie Tobiterzählung (künftig: Tob) ist sowohl in hebräischer und aramäischer Sprache (so die fragmentarische Überlieferung der Texte von Qumran) bezeugt als auch in drei griechischen (GI, GII und GIII) sowie zwei lateinischen („Vetus Latina“ und „Vulgata“) Versionen. Wegen des fragmentarischen Charakters der Qumrantexte muss eine Kommentierung, die der gesamten Erzählung gerecht werden will, bei der griechischen Überlieferung ansetzen. Da die Langform GII, die hauptsächlich durch Ms. Sinaiticus belegt ist, die älteste und so gut wie vollständige Version der Erzählung repräsentiert und die dort fehlenden Abschnitte 4,7–19b und 13,6c–10 sich mit Hilfe des Kurztextes GI und der Vetus Latina relativ einfach rekonstruieren lassen,1 soll diese Version in der vorliegenden Kommentierung zum Ausgangspunkt genommen werden.2 Als Basis meiner Übersetzung diente die Übersetzung des Tobittextes in „Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung“, hg. von Wolfgang Kraus und Martin Karrer, © 2009, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Soweit keine gesonderten Verweise erfolgen, beziehen sich die Stellenangaben auf den Langtext, also die Version GII; die dort fehlenden Verse 4,7–19b und 13,6c–10 wurden rekonstruiert. Die Versangaben orientieren sich an der Septuaginta-Ausgabe von Robert Hanhart (1983).
Die einzelnen Abschnitte der Kommentierung sind wie folgt gegliedert: Nach einer Übersetzung des Textes nach der Version GII folgen zunächst Anmerkungen zur Übersetzung, in die knappe Hinweise zum Kurztext GI sowie zur Qumranüberlieferung und zur Vulgata eingeschlossen sind. Ziel dabei ist es, inhaltlich relevante Abweichungen knapp zu benennen. Um den Umfang dieses Kommentars in einem überschaubaren Rahmen zu halten, muss im Hinblick auf eine ausführliche Darbietung dieser Textversionen und ihrer einschlägigen Übersetzungen auf die bereits vorliegenden und leicht zugänglichen Publikationen verwiesen werden: Eine umfassende Präsentation aller Qumrantexte mit einem philologischen Fokus bieten Joseph Fitzmyer3 und Michaela Hallermayer4. Der Kurztext GI findet sich in Septuaginta Deutsch (2009)5 und die Überlieferung der Vulgata bietet die jüngst erschienene Übersetzung in der Reihe Tvscvlvm6. Die weiteren Ausführungen zum Text orientieren sich an dem durch die Kommentarreihe „Internationaler exegetischer Kommentar zum Alten Testament“ vorgegebenen Format und differenzieren deutlich zwischen einer synchronen und diachronen Betrachtung der Texte.7 Unter der Überschrift „Synchrone Analyse“ fragt der erste Hauptteil der Kommentierung vornehmlich nach der Struktur des Textes, der Erzählweise, nach wichtigen Motiven und der theologischen Aussage, wie sie dem Text unmittelbar entnommen werden können. Ein weiterer Hauptteil untersucht dann diachrone Aspekte des Textes. Da eine Kommentierung der Gesamterzählung mit einem Übersetzungstext arbeiten muss, erlaubt die Überlieferung des Buches nur begrenzt literarkritische Schlüsse. Vor diesem Hintergrund verzichtet die hier vorliegende Arbeit im Kommentarteil auf eine kleinteilige Literarkritik und bietet vor allem in der Einleitung einige grundlegende Informationen zu diesem Aspekt und ein „großflächiges“ Modell zur Literargeschichte. Umso aufschlussreicher sind im Hinblick auf die diachrone Struktur der Überlieferung jedoch die Bezüge zu älteren biblischen Texten sowie die traditionsgeschichtlichen Kontexte. Eine Synthese wird am Ende eines jeden Kapitels die vorangehenden Darlegungen zu einem knappen Gesamtbild zusammenfassen.
Die wichtigsten Einsichten zur Entwicklung vom Langtext GII zum Kurztext GI, zur Vulgata und zu nach-antiken jüdischen Überlieferungen werden, um den Umfang des Kommentars nicht zu sprengen, zusammenfassend in der Einleitung präsentiert. Eine durchgehende inhaltliche Kommentierung der Vulgata sowie eine ausführliche Präsentation der nach-antiken Texte und ihrer textgeschichtlichen Entwicklungen muss späteren Studien vorbehalten bleiben.
Somit liegt der Schwerpunkt der Kommentierung selbst – neben einer synchronen Betrachtung – auf der Traditionsgeschichte, wohingegen der Einleitungsteil neben den üblichen sog. „Einleitungsfragen“ auch wichtige textgeschichtliche Entwicklungen in ihren inhaltlichen Dimensionen behandelt.
Seit der Publikation der Fragmente aus Qumran ist das Interesse an Tob stetig gestiegen.8 Da diese Kommentierung in einem überschaubaren Umfang gehalten werden musste, war es mir nicht möglich, die zahlreichen Arbeiten zu Tob alle ausführlich zu diskutieren und zu würdigen. Allen Kolleginnen und Kollegen sei an dieser Stelle herzlich für ihre Beiträge gedankt, auch wenn nicht immer explizit auf diese verwiesen werden konnte.