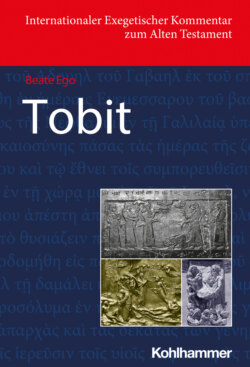Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Figuren der Handlung
ОглавлениеIm Zentrum der Erzählung stehen die Figuren Tobit, Sara und Tobias, deren Schicksale eng verbunden sind. Weitere wichtige Figuren, die das Geschehen begleiten, sind Hanna, Tobits Frau, die Brauteltern Raguël und Edna sowie Gabaël in Medien. Namentlich genannt werden zudem noch Achikar und sein Neffe Nadab. Durch den Verweis auf die Assyrerkönige Salmanassar V. (726–722 v. Chr.; siehe 1,2.13.15), Sanherib (704–681 v. Chr.; siehe 1,15) und Asarhaddon (680–669 v. Chr.; siehe 1,21f.) spannt der Erzähler ein Koordinatensystem auf, das das Geschehen in einen zeitlichen Rahmen stellt. Weitere Akteure sind Gott, der Engel Rafaël und der Dämon Asmodäus. Wichtige Figuren, die namentlich nicht genannt werden, sind die Person, die Tobit wegen seiner Bestattung der Toten beim König anzeigt (1,19), die Nachbarn, die ihn verspotten (2,8), Tobits mitexilierte Brüder, die ihn bemitleiden (2,10), Saras Mägde (3,8f.) sowie die Einwohner Ninives bzw. die Juden, die sich über Tobits Heilung wundern und sich mit der Familie nach der Ankunft Saras freuen (11,16f.; siehe dort zum Begriff „Juden“.).
Tobit, Tobias und SaraIm Hinblick auf eine Charakterisierung der Figuren sind insbesondere die Figurenstimmen bedeutsam, da der Erzähler selbst in der Erzählstimme keine expliziten Aussagen über den Charakter der Protagonisten macht. Dabei kommt der Figur Tobits eine besondere Rolle zu, da die Erzählform in der 1. Pers. am Anfang des Buches (1,3–3,6) einen deutlichen Blick auf seinen frommen Charakter und seine emotionale Verfasstheit ermöglicht. Für Saras Darstellung ist ihr Gebet (3,11–15) bedeutsam. Tobias wird durch den gesamten Handlungskontext als gehorsamer Sohn porträtiert, für den das Gebot des Vaters höchste Priorität hat. Eine sehr persönliche Zeichnung findet sich bei Hanna, insofern diese sich mit der Lebenshaltung und dem Geschick ihres Mannes auseinandersetzt (2,11–14) und sie zudem ihren Schmerz und ihre Trauer um das Ergehen ihres Sohnes zum Ausdruck bringt (5,18–20; 10,4–7a). Der Erzähler lenkt den Blick immer wieder auf die Welt der Frauenfiguren und ihre emotionale Verfasstheit;33 allerdings fällt dennoch auf, dass Frauen im Vergleich mit den männlichen Protagonisten eine eher passive Rolle spielen.34
Gott als FigurGott wirkt – so das Gottesbild der Tobiterzählung – im Verborgenen; nirgends wird erzählt, dass Gott direkt in das Geschehen eingreift. Er kann Leid bringen, was als Strafe oder Züchtigung verstanden wird (μαστιγόω – so 11,15), erhört aber schließlich die Gebete der Protagonisten, indem er den Engel Rafaël entsendet, der ihnen Hilfe und Rettung bringt (3,16f.). Somit lässt die Erzählung keinen Zweifel daran, dass Gott sich der Frommen erbarmt (8,16f.; 11,17) und all das Gute gewirkt hat, das den Protagonisten begegnet (10,13; 11,17; 12,22). Gottes Handeln erscheint ansonsten noch im Kontext der Geschichte, insofern er in seiner Gerechtigkeit sein Volk bestrafen oder züchtigen kann (μαστιγόω – 13,2.5.9; vgl. auch 3,5 mit dem Hinweis auf Gottes Gerichtshandeln), aber auch hier hat letztlich seine erbarmende Zuwendung das letzte Wort (ἐλεέω – 13,2.5.9).
In diesem Kontext finden sich auch passive Formulierungen, die im Sinne eines passivum divinum verstanden werden können (siehe z. B. 13,10; 14,4). Während in den zahlreichen Abschnitten, in denen die Figurenstimmen reden (sei es direkt oder indirekt), Gott relativ häufig erwähnt wird (siehe insbesondere die Gebete und Tobits Weisheitslehre in 4,3–19, aber auch 10,13; 11,16), kommt er in den Passagen, in denen der Erzähler direkt spricht, selten vor (so nur 3,16f.). Die meisten Nennungen zeigen sich in den drei letzten Kapiteln in der Abschiedsrede des Engels (12,6–20), im Lobgebet Tobits (13) und in seiner Sterberede (14,3–11). Insbesondere der Hymnus in Tob 13 nennt Gott sehr häufig. Wenn so „fast ausschließlich die Figuren der Erzählung Gott im Munde [führen], sei es in ihrem monologischen Erzählen und Reden, sei es in Gesprächen miteinander oder in Gebeten […], erhält das Reden von Gott einen persönlichen Anstrich und die Qualität des Bekennens zu der Gottheit.“ Somit kann das Reden der Figuren „von und zu Gott“ als „exemplarisch vorbildhaft“ beschrieben werden.35
In GII erscheinen v. a. folgende Gottesbezeichnungen bzw. -namen: „Gott“, „Herr“, „Gott/Herr des Himmels“, „Gott Israels“, „Höchster“ sowie „König“, „(heiliger) Name“ und „unser Vater“.
– Die häufigste Gottesbezeichnung ist ὁ θεός, „Gott“. Der Begriff erscheint in GII insgesamt über 50-mal, in der Regel mit dem bestimmten Artikel (vgl. aber 3,11 und 8,15 im Vokativ).36
– An zweiter Stelle steht die Gottesbezeichnung κύριος mit fast 30 Belegen.37 In ungefähr der Hälfte der Fälle ist dieses Wort mit dem bestimmten Artikel verbunden;38 fünf der Belege haben, stets ohne Artikel, den Vokativ κύριε.39
– κύριος und ὁ θεός können auch miteinander kombiniert werden, dann trägt das an zweiter Stelle stehende Wort θεός den Artikel.40
– Manchmal treten beide Gottesbezeichnungen mit dem nachfolgenden Genitivattribut τοῦ οὐρανοῦ41 oder τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴς γής42 auch miteinander verknüpft auf („Herr / Gott des Himmels [und der Erde]“). In diesem Kontext findet sich auch je einmal die Verbindung ὁ θεὸς τῶν πατέρα ἡμῶν, „der Gott unserer Väter“ (8,5).
– GII hat darüber hinaus einmal ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ, „der Gott Israels“ (13,18). Hinzu kommt die Kombination mit Personalpronomina im Genitiv.43
– Die Gottesbezeichnung ὕψιστος, „Höchster“, erscheint nur einmal (1,13).
– Weitere Gottesbezeichnungen sind βασιλεύς, „König“ (auffallend häufig in 13),44 sowie τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον, „der heilige Name“45 bzw. τὸ ὄνομα, „der Name“46. Schließlich ist auch die Gottesbezeichnung „unser Vater“ (13,4) belegt.47
Karin Schöpflin weist darauf hin, dass alle Gottesbezeichnungen der profanen Sprache entstammen und – mit Ausnahme der Bezeichnung „der Name“– „jeweils Spitzenpositionen innerhalb eines sozialen Gefüges (beschreiben) und […] somit Relationsbegriffe“ sind. Auch wenn die Texte vom Namen Gottes sprechen, wird dieser selbst doch nie genannt, „sodass Gott streng genommen namenlos bleibt“.48
RafaëlDie Wirksamkeit des Engels Rafaël, der zum Medium des göttlichen Rettungshandelns wird, umfasst eine Vielzahl von Funktionen, und er erscheint in ganz unterschiedlichen Rollen, so als Gebetsmittler (12,12), als Thronengel (12,15; siehe auch 3,16), als Wegbegleiter und Schutzengel (5–11 passim), als Offenbarer medizinischen Wissens (6,5.7–9; 11,4.7f.), als Brautwerber (7,9), als Dämonenvertreiber (8,3) sowie als Unterweiser in der Tora (6,10–18) und als Weisheitslehrer und Lehrer des rechten Gotteslobs (12,6–15.17–20).49
AsmodäusRafaëls Gegenspieler ist der Dämon Asmodäus. Auch diese Figur hat unterschiedliche Facetten: Asmodäus wirkt mit der Tötung der Ehemänner zunächst als Schadensdämon, dessen Aggressivität nicht näher erklärt ist (3,8). In diese Richtung deutet auch der hebr. Name „Aschmodai“ (der allerdings in den Qumranfragmenten nicht erhalten ist und erst in späteren Texten erscheint), denn er weckt Assoziationen an den hebräischen Begriff שׁמד hif., „ausrotten, vernichten“.50 Wenn seine „Entfernung“ oder „Lösung“ im Kontext der Mission Rafaëls als „Heilung“ verstanden werden kann (so 3,17), dann scheint der Dämon eine Art Krankheit zu verkörpern. Asmodäus kann als Symbolisierung einer Infektionskrankheit verstanden werden: Während Sara zwar infektiös ist, aber keine Symptome zeigt, hat diese für die betroffenen Männer einen tödlichen Ausgang. Dies erklärt die Aussage, dass Asmodäus Sara in Liebe verbunden ist (so 4Q196 14 i 4; Ms. 319; 6,15 GI); es klingt hier aber auch die Vorstellung von einem Incubus-Dämon51 an. Solche Dämonen zeigten sich in nächtlichen sexuellen Träumen, die wiederum als Grund für Erkrankungen angesehen werden konnten. Insofern der Dämon die endogamen Ehen Saras verhindert, die wiederum in der Vorstellungswelt der Erzählung dem Gebot der Tora entsprechen, fungiert er als Gegenspieler eines toragemäßen Lebens und als ein Feind Israels. Der Dämon kann mit Räucherwerk vertrieben werden (6,8.14f.17; 8,2f.); außerdem wird er von Rafaël noch gefesselt, sodass er fortan keinen Schaden mehr anrichten kann (8,3).52