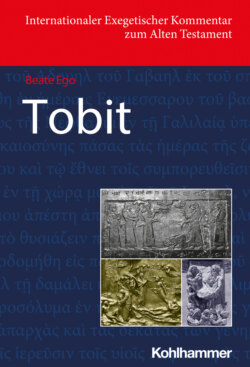Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weitere Traditionen
ОглавлениеWeitere Traditionen entstammen der sog. „Umwelt“, wobei ägyptische, mesopotamische, persische und griechische Texte bzw. Überlieferungen rezipiert werden.
Achikar– Eine wichtige Rolle spielt der Achikarstoff, der uns heute in den Elephantinetexten vorliegt (aber sicherlich nicht auf Ägypten begrenzt war). Durch die Konstruktion, wonach Achikar ein Verwandter Tobits ist, hat der Autor diese Figur geschickt mit seiner Erzählung verbunden, und so wird die Figur des Tobit aufgewertet. Zudem fungiert die Achikarerzählung als eine Art Subplot, die die grundlegende Gültigkeit des Tun-Ergehen-Zusammenhangs veranschaulicht.128 Schließlich dient Achikar auch als Exempel familiärer Solidarität und barmherzigen Handelns (zum letzteren Aspekt siehe 2,10; 14,10).129
Babylonische Medizin und Magie– Sowohl die „rationale“ Augenheilkunde als auch das Räucherritual haben viele Entsprechungen in babylonischen Traditionen.
a) Babylonische Heiltexte bezeugen sowohl die Behandlung von Augenkrankheiten durch Salben als auch die Verwendung von Fischgalle für die Herstellung derselben. Durch die unterschiedlichen Angaben zum konkreten Prozess der Heilbehandlung (siehe oben im Abschnitt „Wichtige Themen“) bleiben die konkreten realen Bezüge der Erzählung aber im Unklaren.130 Bei der Blindheit, wie sie hier dargestellt wird, handelt es sich um den „pragmamorphen Typ“ einer Krankheit; Krankheitsursache ist ein lebloser Fremdkörper, der in den Menschen eingedrungen ist, und die Heilung erfolgt durch die mechanische Entfernung desselben.
Eine andere Art des Krankheitsverständnisses begegnet mit dem Motiv des Dämons und dem Exorzismus durch das Räucherritual. Da die Ursache der Krankheit hier in einem lebendigen Wesen gesehen wird, kann vom Typ einer „biomorphen“ Krankheit gesprochen werden, und es ist nach der immanenten Logik eine Vertreibung des Schädlings zur Heilung vonnöten.131 Babylonische Texte enthalten reiches Material, das Dämonenvertreibungen durch Räucherrituale belegt.132
b) Neben diesen Bezügen kann zum Verständnis des breiteren Hintergrunds auf die babylonischen Zauberschalen verwiesen werden. Wenn diese auch erst in das 5.–7. nachchristliche Jahrhundert datiert werden können, belegen sie doch auf eindrückliche Weise die folgende Vorstellung: Dämonen, die auch geschlechtliche Verbindungen mit ihren „Opfern“ eingehen, können mit ihrer schädigenden Kraft den Bereich des Hauses affizieren und in Form von Krankheiten Unheil anrichten; sie werden durch Beschwörung „geschieden“, müssen fliehen und werden schließlich gebunden. In diesen Quellen ist sowohl Asmodäus als auch Rafaël belegt (siehe zu 3,8.17; 6,15; 8,3).
Dieser allgemeine religionsgeschichtliche Hintergrund zeigt: Indem das Wissen um die richtige „Medizin“ in der Tobiterzählung durch den Engel Rafaël vermittelt wird, der wiederum von Gott zur Heilung der beiden Protagonisten entsandt wurde, erfolgt hier eine Legitimierung medizinisch-magischer Praktiken im Rahmen der Jahwereligion. Weder die Erblindung noch die Heimsuchung durch den Dämon werden dabei als eine göttliche Strafe dargestellt; diese Bedrohungen scheinen vielmehr grundlos über die Protagonisten hereingebrochen zu sein.
Zoroastrische Traditionen– An zoroastrische Vorstellungen erinnert der Name des Dämons Asmodäus; er entspricht dem Dämon des Zorns, Ashmadaeva. Eine unmittelbare Konkretisierung als Krankheitsdämon wird in den einschlägigen Quellen allerdings nicht gegeben; Ashmadaeva ist ganz allgemein der Dämon des Zorns und der Zerstörung.133
Ägypten und Griechenland– Weitere Motive verweisen eher auf den griechischen Bereich bzw. dann auch auf Ägypten:
a) In literarischer Hinsicht bedeutsam ist die Einsicht, dass die Erzählung durch Form und Stoff an den griechischen Roman erinnert (siehe oben zu „Gattung[en]“).
In der Forschungsliteratur hat man darüber hinaus eine wichtige Quelle in der Odyssee gesehen.134 So arbeitete Dennis R. MacDonald eine Vielzahl von einzelnen Motivparallelen heraus, die er verschiedenen Etappen der Handlung zugeordnet hat.135 Problematisch bei dieser These ist allerdings, dass sich die Haupthandlung der Odyssee bzw. die Nebenhandlung der Telemachie ganz wesentlich von der Tobitgeschichte unterscheidet. Telemachos zieht los, um seinen Vater zu finden, während das Ziel der Handlung hier letztlich in der Heilung des blinden Tobit und der Vertreibung des Dämons besteht. Die wesentlichen Handlungsmotive (Fischfang, Vertreibung des Dämons und Hochzeit der Protagonisten sowie die Heilung des Blinden) erscheinen in der Telemachie gerade nicht. Es handelt sich bei den Entsprechungen zwischen Tobit und der Odyssee also eher um Motive allgemeiner Art, die hier wie Versatzstücke erscheinen. Welche Mutter wäre nicht überglücklich, ihr Kind nach einer langen und gefahrvollen Reise wieder zu sehen? Das Motiv der Hochzeit ist völlig anders kontextualisiert, und dass man bei einer solchen Feier isst und trinkt und sich zur Vorbereitung einer Waschung unterzieht, ist ebenfalls recht trivial. Das Motiv der Offenbarung der Identität Odysseus’ und der Rafaëls liegen auf ganz verschiedenen Ebenen und sind nicht kompatibel. Homer war in der gesamten Antike unter den Gebildeten (auch den jüdischen!) eine bekannte Größe,136 und so ist anzunehmen, dass der Autor der Tobitschrift die Odyssee gekannt und einzelne Versatzstücke, sei es bewusst oder unbewusst, in seine Erzählung eingefügt hat. Für die Erzählung selbst sind die Bezüge allerdings nicht von handlungstragender Relevanz.137
b) Das Motiv von der Verborgenheit des Engels könnte – wenngleich der Nukleus auch in der biblischen Überlieferung enthalten ist (z. B. Gen 16,7; siehe auch Gen 18,2; 19,1; Ri 13,16) – auch auf griechische Einflüsse zurückgehen, da hier das Motiv der „verborgenen Epiphanie“ häufig zu finden ist.138 Zudem könnten bei der Gestalt Rafaëls auch Bezüge zu der Figur des Hermes mitschwingen (zu 5,17); auch eine Verbindung zu griechischen Kulturstiftern (insbesondere Prometheus und Chiron, vielleicht auch zu dem ägyptischen Thot) ist nicht auszuschließen (zu 6,6–9).
c) Die griechischen Überlieferungen sind im Hinblick auf Dämonenvertreibungen eher zurückhaltend; Vergleichsmaterial findet sich hier vornehmlich in den Zauberpapyri mit der Vorstellung vom Binden des Dämons (zu 8,3). Allerdings weisen neuere Arbeiten darauf hin, dass der Antagonismus zwischen dem „magischen Osten“ und dem „rationalen Westen“, wie er oft in der Literatur dargestellt wird, nicht sachgemäß ist. Auch die babylonische Medizin gründet auf empirischen Beobachtungen, und für Griechenland ist im Bereich des Volksglaubens auch in hellenistischer Zeit mit vorhippokratischen Vorstellungen zu rechnen (zu 3,8).
d) Wenn sich in den Jahrhunderten v. Chr. in der griechischen Welt ein Diskurs findet, der sich dezidiert dafür ausspricht, Krankheiten nicht in einem theologischen System zu begreifen, sondern rational-wissenschaftlich zu deuten, so könnte dies den Referenzrahmen darstellen, in dem Tobits Augenkrankheit und seine Heilung gesehen werden müssen und gegen den der Erzähler mit dem Motiv der durch den Engel vermittelten Heilkunst Stellung beziehen möchte. Insbesondere in Ägypten fand sich eine hoch entwickelte Augenheilkunde (zu 2,10; 6,6–9).