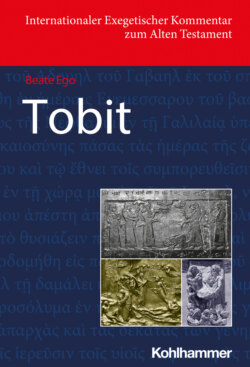Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wichtige Themen: Leitwörter, bedeutende Motive und Motivfelder
ОглавлениеDie Erzählung enthält verschiedene Leitwörter, die sich wiederum zu Motiven und schließlich auch zu Motivfeldern zusammenfassen lassen und die auf deren zentrale Themen verweisen. Diese Felder können sich berühren oder sogar überschneiden. Wenngleich ihnen unterschiedliche narrative Funktionen und Bedeutungen zukommen (die an anderer Stelle noch weiter zu differenzieren wären), so durchziehen sie doch die gesamte Erzählung.
„Exil vs. Jerusalem“Ein Motiv, das gleich am Anfang der Erzählung erscheint, ist das der Gefangenschaft bzw. des Exils. Hier stehen die Begriffe αἰχμαλωσία, „Gefangenschaft“, αἰχμαλωτεύω/αἰχμαλωτίζω, „in Gefangenschaft führen“, αἰχμάλωτος, „Gefangener“, im Zentrum. Tobit gehört zu der Gruppe der Nordisraeliten, die unter Salmanassar (726–722 v. Chr.) ins Exil nach Ninive geführt wurden (1,2), wo er seinen „Brüdern“ viele Wohltätigkeiten erweist und dafür mit Verfolgung, Enteignung und sozialer Schmach bezahlen muss (1,3.10–20; 2,1–7; zum Begriff siehe 1,3.10). Auch im Verlauf der Kerngeschichte wird immer wieder auf die Exilserfahrung rekurriert: So erklärt Tobit in seinem Gebet die Exilierung mit seinen eigenen Sünden und denen seines Volkes (3,3–6; zum Begriff 3,4). Auch Sara spricht in ihrem Gebet davon, dass sie sich im „Land der Gefangenschaft“ befindet (3,15); zudem verweisen Tobias und sein Reisebegleiter bei ihrer Vorstellung im Hause Raguëls auf ihre Zugehörigkeit zu den Exilierten (7,3).
Die Verbindung zwischen den Sünden des Volkes und der Exilierung findet sich auch in Tobits Hymnus am Ende des Buches unter dem Stichwort διασπείρω (13,3) bzw. διασκορπίζω (13,5) mit der Bedeutung „zerstreuen“. Tobits Hymnus macht deutlich, dass das Exil der Ort sein soll, an dem Gottes mächtiges Handeln vor den Völkern bekannt wird. Israel wird so zum Zeugen seines Gottes in der Völkerwelt (13,1–6). Im Neuen Jerusalem sollen dann auch die Gefangenen erfreut werden (13,10). In seinem Geschichtsausblick schaut Tobit auf das Babylonische Exil (14,4). Das Buch endet mit dem Untergang Ninives, und so ist es schließlich das stolze Reich der Assyrer selbst, das die Schmach und das Leid der Exilierung tragen muss (14,15).53
Gegenpol zur Exilserfahrung ist das Leben im Land und in Jerusalem. Dieses Motiv (und damit die Spannung „Exil vs. Land“) wird ebenfalls gleich am Anfang eingebracht: Explizit verweist der Erzähler auf Tobits Herkunft aus Nordgaliläa und lässt den Protagonisten dann in der Ich-Form auch über sein Leben im Land vor seiner Exilierung berichten, in dem er regelmäßig nach Jerusalem wallfahrtete (1,4–8). Hier findet eine Verbindung mit dem Motiv des „Mosegesetzes“ statt (1,8: νόμος Μωσῆ und ἐντολή; 1,6: πρόσταγμα αἰώνιον).
Auch beim Gespräch mit dem künftigen Reisebegleiter seines Sohnes erscheint die Erinnerung an Tobits Wallfahrten nach Jerusalem (5,14). Das Thema ist zudem auch integraler Bestandteil der Zukunftshoffnung: So wird das Endogamiegebot mit der Landgabe verbunden (4,12), und am Ende des Buches erscheint das Motiv der Rückkehr nach Jerusalem als ein breites Thema, insofern Tobit in seinem Hymnus das Neue Jerusalem als eine Stadt des Jubels besingt, in der die Gefangenen erfreut und in die auch die Völker mit ihren Gaben strömen werden (13,8–18). Ebenso verweist Tobit in seinem Geschichtsausblick kurz vor seinem Tod auf die Rückkehr der gesamten Gola und die Erbauung Jerusalems (14,5–7).54 Tobits Pilgerschaft nach Jerusalem kann so als eine Antizipation der eschatologischen Jerusalemwallfahrt gesehen werden; die für die Heilszeit erhofften Ereignisse werden aber alles Frühere überbieten.
Barmherzigkeitstaten, Armut und ReichtumDie Erzählung setzt das Milieu einer wohlhabenden Schicht voraus, und Tobit scheint – zumindest in seinen guten Jahren – ein reicher Mann gewesen zu sein. Hätte er nicht über ein bestimmtes Vermögen verfügt, hätte er seine Landsleute nicht in ihrer Bedürftigkeit unterstützen können (1,16–20; 2,2–7); auch die Mahnungen zum Almosengeben (4,6–11.16–17) oder zur korrekten Bezahlung eines Lohnarbeiters (4,14) ergeben nur dann Sinn, wenn sie sich an ein Publikum richten, das zumindest einen gewissen finanziellen Spielraum hat. Auch die Beschreibung seines Mahls deutet auf diesen Aspekt hin (2,1f.). Ein wichtiges Handlungselement, das mit dem Reichtum der Familie verbunden ist, ist das bei Gabaël im fernen Medien deponierte Vermögen (1,14), das durch die erfolgreiche Reise des Tobias wieder in den unmittelbaren Besitz der Familie kommt (vgl. 4,1.20; 5,3.6; 9,1–6; 10,2; 11,15; 12,3; oft mit expliziten Vor- und Rückverweisen55). Auch die Heirat mit Sara hat positive Auswirkungen auf das Vermögen der Familie (8,21; 10,10; 14,13).
Aber auch Tobits Verwandtschaft macht einen prosperierenden Eindruck. Für Achikar ist das ganz offensichtlich (1,22), ebenso muss Saras Familie über gewisse finanzielle Freiheiten verfügt haben, wenn reichlich aufgetischt werden kann (7,9; 8,19f.; 9,6) und für die Reise der Brautleute auch Dienstpersonal und Reittiere zur Verfügung stehen (9,2.5).
Das Thema des Reichtums klingt auch durch den Namen „Tobit“ an, da er Assoziationen an die Familie der Tobiaden – einer begüterten Adelsfamilie im spät-nachexilischen Judentum – weckt (siehe zu 1,1).
Die Geschichte zeigt aber problematische Seiten des Reichtums: So findet sich in den Worten Hannas nach dem Abschied ihres Sohnes („Es soll ja nicht das Silber zum Silber kommen …“; 5,19f.) eine eindeutige Kritik an dessen Überschätzung, und die Fragilität des Reichtums bzw. des Besitzes wird durch Tobits eigenes Schicksal nur zu deutlich: Wegen der Unsicherheit auf den Straßen ist Tobit nach dem Regierungsantritt Sanheribs (704–681 v. Chr.) in seiner Aktivität als Fernhandelskaufmann eingeschränkt und kann somit nicht mehr seiner Erwerbstätigkeit nachgehen (1,15); als er wegen der Bestattung seiner Landsleute verfolgt wird, verliert er sein Vermögen (1,20), und nach seiner Erblindung ist er nicht mehr in der Lage, für seinen Unterhalt und den seiner Familie zu sorgen (so implizit durch 2,10 und 2,11). In diesen Situationen ist Tobit auf die Solidarität seiner Verwandtschaft (i. e. Achikar; 1,22; 2,10) bzw. seiner Frau (2,11) angewiesen.
Innerhalb dieses breiten biographischen Rahmens kommt der Wertschätzung solidarischen Handelns eine bedeutende Rolle zu. Die Begriffe ἀλήθεια, „Wahrheit“, δικαιοσύνη, „Gerechtigkeit“, und ἐλεημοσύνη, „Barmherzigkeit bzw. Almosen“, durchziehen die Erzählung wie ein roter Faden und können als Leitwörter gelten.56 Alle drei Begriffe finden sich gleich am Anfang (1,3) und kehren sowohl in den erzählenden Abschnitten als auch in Redeelementen unterschiedlichster Art wieder. Dabei können aber auch nur einzelne Begriffe der Trias erscheinen. Durch die verschiedenen Belege ergibt sich eine Sinndimension, welche die gesamte Erzählung überspannt: Die Begriffe werden am Anfang programmatisch eingeführt, dann durch die Handlung bestätigt, um schließlich in der Rede des Engels am Ende der Geschichte reflektiert und gleichzeitig auf die Zukunft hin entfaltet zu werden.57 Speziell die Gabe von Almosen (eine mögliche Übersetzung des Terminus ἐλεημοσύνη, die sich aus dem Kontext ergibt58) wird in der Abschiedsrede Tobits thematisiert (4,6–11.16–17). In diesem Kontext erfolgt des Weiteren eine explizite Verbindung mit den göttlichen Geboten und Weisungen (vgl. die Rahmung 4,5 und 4,19). Zudem wird der Gebotsgehorsam mit der Wendung „Gottes gedenken“ zusammengefasst (4,5f.).59 Ein weiterer Rekurs auf die Thematik findet sich in der Rede des Engels (12,8–10; hier wieder alle drei Begriffe) sowie am Ende der Erzählung, wenn es heißt, dass Tobit auch nach seiner Erblindung weiterhin barmherzige Taten wirkte (14,2). Durch Tobits Rede vor seinem Tod wird der Anspruch einer solchen Praxis an die nächste Generation weitergegeben (14,8.9, ebenfalls alle drei Begriffe) und es erfolgt so eine Art „Verstetigung“ dieser Haltung.60
Tobit wird als Vorbild eines solchen solidarischen Handelns präsentiert (vgl. den programmatischen Einsatz in 1,3), der sich auch in extremen Krisensituationen nicht vom praktischen Tun der Barmherzigkeit abhalten lässt. Er erweist – unter Einsatz seiner gesicherten Existenz – seinen mitexilierten Brüdern viele Barmherzigkeitstaten, indem er sie speist, bekleidet und bestattet (1,16–20; 2,2–7; vgl. ἐλεημοσύνη siehe 1,16). Trotz seiner persönlichen Krise, in der ihm seine Frau vorhält, dass seine Haltung der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu nichts nütze war (vgl. 2,11–14 mit ἐλεημοσύνη und δικαιοσύνη), bleibt er seinen Idealen treu. In seinem Gebet schickt er sich in seine Situation und betont Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit (3,1–6), und im Anschluss daran ermahnt er seinen Sohn zu einem Leben in Gerechtigkeit und Wahrheit (4,5f.).
Die gesamte Motivik impliziert einen narrativen Diskurs über den Tun-Ergehen-Zusammenhang. In Tobits Gebet (3,1–6) wird deutlich, dass „Barmherzigkeit“, „Gerechtigkeit“ (hier als Adjektiv) und „Wahrheit“ nicht nur menschliche Ideale, sondern auch göttliche Wirkgrößen darstellen (3,2). Insofern Gottes Handeln an Tobit als Barmherzigkeitshandeln zusammengefasst werden kann (11,17: ἐλεέω) und Tobit am Ende seines Lebens seinen Wohlstand auch wieder erlangt (14,2), steht die gesamte Motivik im Kontext eines funktionierenden Tun-Ergehen-Zusammenhangs: Derjenige, der seinen Nächsten barmherzige Taten erweist, erfährt auch die Barmherzigkeit Gottes. Dieser Zusammenhang wird in einem Subplot, d. h. einer Art Nebenhandlung, auch durch die Figur Achikars veranschaulicht, der als Exempel dafür dient, dass barmherziges Handeln letztlich belohnt wird (14,10f.).61 Am Ende der Erzählung soll dann in der Beschreibung des „Neuen Jerusalem“ mit seiner Lichtherrlichkeit (13,11; siehe auch 13,16f.) die spirituelle Dimension des Reichtums anklingen.
Tod und BestattungEin Sonderfall der Barmherzigkeitstaten ist die Bestattung. Tobit begräbt die Toten seines Volkes, die zu Opfern der Verfolgung wurden, als Ausdruck der Nächstenliebe (1,17–19; 2,3–8). Dieses Verhalten bringt ihm aber zunächst nur Unglück, da er vom König verfolgt (1,19f.) sowie von den Nachbarn (2,8) und auch seiner Frau (2,14) verspottet wird. Schließlich erblindet Tobit sogar in unmittelbarem Zusammenhang mit einer solchen Tat (2,9f.). In seinem Testament befiehlt er seinem Sohn, dass er ihn und seine Mutter würdig in einem Doppelgrab bestatten solle (4,3f.). Auf diesen Befehl, die Eltern zu bestatten, rekurriert Tobias, um zu begründen, dass er sein Leben nicht durch eine Heirat mit Sara riskieren möchte (6,15). Eine Ironisierung des Motivs findet während der Hochzeitsnacht statt, wenn der Brautvater Raguël in seiner Furcht, seinen künftigen Schwiegersohn könnte dasselbe Unglück ereilen wie dessen Vorgänger, ein Grab ausheben lässt (8,9f.), das dann aber glücklicherweise nicht benötigt wird, sodass er die Grube unbenutzt wieder zuschaufeln kann (8,18). Schließlich bestattet Tobias tatsächlich am Ende der Geschichte – in Entsprechung zur Lebenslehre Tobits (4,3) – seinen hochbetagten Vater (14,1.11), seine Mutter (14,12) und seine Schwiegereltern (14,13). Das Motiv ist nicht nur im Hinblick auf die Demonstration der Frömmigkeit Tobits bedeutsam, sondern zeigt auch, dass diese Frömmigkeit schließlich von Gott belohnt wird – ist es doch dieses Handeln, das den Engel Rafaël dazu bringt, das Gebet Tobits zu Gott zu bringen (12,12). In der Rede des Engels werden die negativen Folgen, die sich aus der Bestattung der Toten ergeben, auch als Probe interpretiert. Wenn der Sohn Tobias das Gebot der Elternbestattung, das zu der Weisheitslehre seines Vaters gehörte, befolgt, so zeigt er sich zudem als gehorsamer und vorbildlicher Sohn.62
Wege und ReisenEin weiterer Schwerpunkt bezieht sich auf das Motivfeld „Wege und Reisen“, vertreten durch die Begriffe ὁδός, „Weg“, πορεύομαι, „reisen“, und εὐοδόω, „Gelingen haben“. Der Begriff πορεύομαι erscheint ebenfalls gleich am Anfang der Erzählung für die Wallfahrt nach Jerusalem (1,6f.), für Tobits Weg ins Exil (1,10), für seine Handelsreisen nach Medien (1,14f.) sowie sein Weg zu den Ärzten nach seiner Erblindung (2,10). Aber auch Tobias’ Suche in der Stadt nach einem Bedürftigen, der mit dem Vater speisen soll (2,3), wird mit diesem Begriff bezeichnet. Im Zentrum stehen allerdings die Aussagen mit πορεύομαι, die sich auf die Reise nach Ekbatana (5,2.3.4.5.6.9.10.16.17.21; 6,1.6.18) bzw. Rages (9,2.5) und den Rückweg von dort (11,4) bzw. die gesamte Reise (10,1.5.6; 11,6; 12,1) beziehen.63 Dabei ist eine Verbindung mit ὁδός häufig. Der Begriff kann aber auch isoliert erscheinen und sich direkt auf den konkreten Weg beziehen, auf dem Hanna ihren Sohn sehnsüchtig erwartet (11,5). Schließlich kann πορεύομαι auch für Tobits freies Einherschreiten nach seiner Heilung auf dem Weg zum Stadttor (11,16) verwendet werden.
Eine besondere Rolle spielt das Wort εὐοδόω: Im Gespräch mit seiner Frau bringt Tobit seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Reise ihres Sohnes gelingen wird (5,22), und schließlich preist Tobias (10,13) bzw. Tobit Gott für den erfolgreichen Ausgang der Reise.64 Zudem findet sich auch eine übertragene Bedeutung des Begriffs εὐοδόω, insofern Raguël wünscht, dass Gott Tobias und seiner Tochter für die Eheschließung Gelingen schenken möge (7,12; 10,11).
Begleitet werden diese konkreten Angaben zu Reise und Weg durch eine metaphorische Verwendung der Begrifflichkeit. Tobit geht auf den Wegen von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit (1,3), bekennt aber in seinem Gebet, dass das Volk („wir“) nicht in Wahrheit auf den Wegen Gottes gewandelt sei (3,5). In seiner Abschiedsrede weist Tobit seinen Sohn an, dass er nicht auf den Wegen der Ungerechtigkeit gehen solle (4,5) bzw. dass er von Gott das Gelingen seiner Pläne erbitten möge (4,19). Diejenigen, die die Wahrheit tun, werden in ihren Werken Gelingen haben (4,6).
Krankheit und HeilungEin weiteres Wortfeld ist dem Thema der „Krankheit“ und „Heilung“ gewidmet. Hier ist zunächst Tobits Blindheit zu nennen. Tob 2,10 erzählt von seiner Erblindung, und nach seinem Gebet wird Rafaël zu seiner Heilung entsandt (3,17). Da Tobit nichts von diesem hintergründigen Wirken Gottes weiß, beklagt er bei der Begegnung mit Azarias seinen Zustand (5,10). Implizit klingt das Motiv der Blindheit auch beim Fischfang und dem Ausnehmen der Innereien an, insofern Rafaël hier von einer Medizin gegen Blindheit sprechen kann (6,9). Dann verweist Raguël bei der Begrüßung von Tobias und Azarias explizit auf Tobits Blindheit (7,7), und der Kreis schließt sich, als Tobit bei der Rückkehr seines Sohnes geheilt werden kann und Gott lobpreist (11,8.10–17). In Tob 12,3 bezieht sich Tobias explizit auf die Heilung des Vaters zurück; Tob 12,13f. deutet die Erblindung Tobits nicht als unglücklichen Zufall, sondern als göttliche Prüfung. Tob 14,2 schließlich wirft einen Blick auf die biographische Einbindung der Erblindung Tobits: Danach erblindete er im Alter von 62 Jahren.65
Die Erzählung kennt zwei verschiedene Begriffe für das Heilungshandeln, nämlich ἰάομαι und θεραπεύω. Der Begriff ἰάομαι findet sich bei der Entsendung des Engels Rafaël (3,17) sowie in dessen Worten (siehe den Zuspruch für Tobit in 5,10 und den Rückblick des Engels in 12,14). Θεραπεύω dagegen erscheint im Kontext des Versuches Tobits, sich bei den Ärzten Hilfe zu holen (2,10), sowie bei Tobias’ Rückblick auf das Geschehen (12,3). So wird deutlich, dass das Heilungsgeschehen hier aus zwei Perspektiven beleuchtet wird: ἰάομαι steht für Heilungen, die im Kontext des göttlichen Rettungshandelns erfolgen, wohingegen bei θεραπεύω ein solcher Referenzrahmen nicht gegeben bzw. dem Sprecher nicht offenbar ist.66
Tob 3,17 (ἰάομαι) sowie Tob 12,3 (θεραπεύω) zeigen, dass auch die Vertreibung des Dämons (ein „böser Geist“), der eine Begegnung (ἀπάντημα) mit einem Menschen hat (6,8), als Heilungshandeln verstanden wird.
Weitere Begriffe aus dem Wortfeld „Heilung“ sind φάρμακον sowie die damit verbundenen Fischinnereien Herz, Leber und Galle, aus denen das Räucherwerk gegen den Dämon und die Augensalbe für den Vater hergestellt werden (6,4.7; 11,8.11; siehe auch 2,10 allgemein als Arznei bei Augenkrankheiten). In Tob 2,10 werden auch die Ärzte (ἰατρός) genannt.
Die Heilungen selbst sind dann ganz unterschiedlich beschrieben: Die Augensalbe soll aufgestrichen (ἐγχρίω) bzw. auf die Augen gehaucht (ἐμφυσάω) (6,9) oder geschmiert (ἐμπλάσσω) werden, sodass sie die weißen Flecken zusammenzieht (ἀποστύφω) und abschält (ἀπολεπίζω) (11,8). Beim Heilungsakt selbst bläst (ἐμφυσάω) Tobias dem Vater in die Augen, er trägt die Salbe auf (ἐπιβάλλω) und reicht sie ihm dar (ἐπιδίδωμι), dann werden die weißen Flecken mit den Händen abgeschält (ἀπολεπίζω) (11,11–13). Diese Unterschiede zwischen den einzelnen Abschnitten könnten darauf hindeuten, dass der Erzähler über die Abfolge der Handlungen („in die Augen blasen“ – „die Salbe aufstreichen“) beim Heilungsakt keine exakten Vorstellungen hatte.
Die Heilung vom Dämon soll dadurch erfolgen, dass dieser „gelöst“ oder „geschieden“ (ἀπολύω) wird (3,17). Bei der eigentlichen Vertreibung (wo allerdings der Begriff ἰάομαι nicht erscheint) wird er dann durch den Geruch zurückgehalten (κωλύω) und entweicht (ἀποτρέχω) nach Ägypten, wo er gefesselt (δέω) wird (8,3).
FamilieEin wichtiges Motiv der Erzählung ist das der Familie. Bereits der Buchanfang (1,1) zeigt durch den detaillierten Stammbaum die Bedeutung von familiären Strukturen.67 Der Wert der Familie äußert sich dann auch im Gespräch Tobits mit dem künftigen Reisebegleiter seines Sohnes, insofern er sich genau nach dessen Herkunft erkundigt und überglücklich ist, dass er die Verwandtschaft des jungen Mannes kennt (siehe 5,11–14). Auch die Begrüßungsszenen mit ihren z. T. stark emotional aufgeladenen Darstellungen unterstreichen die Bedeutung familiärer Strukturen (Tobias bei Raguël und Edna – 7,1–8; Gabaël beim Mahl bei Raguël – 9,6; Tobit und Sara – 11,17). In diesem inhaltlichen Rahmen steht auch die Verabschiedung Saras durch Vater und Mutter (10,12). Eine besondere Form der familiären Bindung äußert sich in Hannas Sorge um ihren Sohn, wobei hier auch, neben der Mutterliebe, materielle Aspekte mitschwingen können (5,18–20; 10,4–7a). Schließlich spielt die Thematik am Ende der Erzählung nochmals eine Rolle, insofern Tobit seinem Sohn und dessen Kindern eine Unterweisung über die künftigen Ereignisse der Geschichte ihres Volkes und die Bedeutung von Barmherzigkeitstaten erteilt (14,8.9).68 Neben dem Vater Tobit (siehe auch 4,3–21) erscheinen auch die Vorfahren, seien es allgemein die Erzväter (4,12) oder konkreter Ahnen aus der Familie (1,8: Debora), als bedeutsame Autoritäten.69
Das Buch kennt aber auch Ansätze, die Familie zur Sippe hin zu entgrenzen; ja sogar das ganze Volk oder zumindest alle Exilierten können als eine Art Familie dargestellt werden. Dies belegt die Verwendung des Begriffes ἀδελφός, „Bruder“, der im Tobitbuch ein weites und manchmal etwas unklares Bedeutungsspektrum hat. Er kann sowohl den leiblichen Bruder bezeichnen (so 1,21) als auch einen Verwandten (so eindeutig 3,15; 7,10) oder eine Person aus derselben Sippe (4,12). Darüber hinaus wird der Begriff auch allgemein für einen Stammesgenossen (5,13.14; evtl. 5,17) oder für einen Menschen aus dem Volk Israel (so 1,10.16f.; 2,2; 14,4) verwendet. In diesem Kontext scheint der Bezug zum Exil eine wichtige Rolle zu spielen (so 1,3.10.16f.; 2,2; siehe auch 4,13). Oft ist auch eine konkrete Zuordnung nicht möglich (z. B. 1,3.5; 5,17; 7,11a). Der Begriff erscheint vor diesem Hintergrund auch häufig in der Anrede der Figuren untereinander. Neben der Zugehörigkeit zum selben Volk sind hier die verwandtschaftlichen Beziehungen bedeutsam (so insbesondere in den Dialogen in Kap. 5, 6 und 7). Die wiederholte, fast monotone Verwendung bringt dabei die enge Verbindung der Figuren untereinander zum Ausdruck. Wird der Begriff für Menschen aus dem Volk Israel verwendet, so werden die Exilierten wie eine große Familie dargestellt. Wenn am Ende der Erzählung ganz Israel in Jerusalem versammelt wird (13,9–18) und zudem alle Völker den Gott Israels preisen (13,11; 14,6f.), so kommt insgesamt eine zunehmende Universalisierung zum Ausdruck.70
Eine andere Abwandlung der Vorstellung einer Familie erfolgt insofern, als der Begriff „Bruder“ bzw. „Schwester“ für den Status des Ehegatten benutzt werden kann (so 7,11: „von nun an bist du ihr Bruder, und sie ist deine Schwester“; für Schwester siehe auch 10,12). In Tob 10,12 verwendet Edna den Begriff „Bruder“ zur Anrede ihres Schwiegersohnes; daneben erscheint der Begriff „Schwester“ auch als Anrede der Ehefrau durch ihren Mann (siehe 5,21; 7,15; 10,6; siehe auch 7,9.11, wo Raguël Sara als Schwester des Tobias bezeichnet).71
Ehe und HochzeitIn engem Bezug zur Familie stehen die Motive „Ehe“ und „Hochzeit“.72 Bereits der Verweis auf die Eheschließung Tobits mit Hanna (1,9; die Wendung ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν) macht deutlich, dass für die Erzählung das Prinzip einer sippeninternen Endogamie wichtig ist.73
Im Kontext der Handlung betont Rafaël in Tob 6,13, dass die Eheschließung mit Sara „nach der Bestimmung des Buches des Mose“ (κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως) erfolgen soll; in Tob 6,16 wird das Gebot, Sara zu heiraten, zudem explizit mit dem Endogamiegebot verbunden, das bereits Bestandteil der Lebenslehre des Vaters war (allerdings ohne die entsprechende Begrifflichkeit). Die „Tora des Mose“ ist auch die Leitlinie für den Prozess der Eheschließung zwischen Tobias und Sara (7,10–13). Im Hintergrund dieser Anweisung steht die Erbtöchtertora aus Num 36,6–9, wonach eine Tochter, die von ihrem Vater geerbt hat, innerhalb der eigenen Sippe heiraten soll, damit der Besitz in dieser bleibt (siehe hierzu bereits die Anspielungen in 3,15; siehe auch 8,21). Allerdings liegt in Tob eine Weiterentwicklung des Erbtöchtergesetzes vor, insofern das Übertreten dieses Gebots mit der Todesstrafe sanktioniert wird (6,13). Auch in Tob 3,16f. könnte dieses Motiv in der Begrifflichkeit, dass es Tobias zustand, Sara zu „erben“, im Hintergrund stehen.
Daneben erscheint das Motiv der sippeninternen Endogamie auch im Rahmen der Unterweisung, da Tobit in seiner Abschiedsrede die Forderung nach Endogamie mit dem Handeln der Patriarchen begründet (4,12). Der Bezug zur Tora ist hier indirekt gegeben, da es ja der Pentateuch ist, in dem von den endogamen Ehen Abrahams, Isaaks und Jakobs erzählt wird (siehe Gen 24,3–4.37–38 und Gen 28,1–4). Im Kontext von Tob 4,12–13 spielt zudem auch die Landperspektive sowie die Bruderliebe als Akt der Solidarität eine Rolle.
Diese Aussagen zur Ehe sind in die gesamte Handlung eingebettet. Den Auftakt bildet die Entsendung des Engels mit dem Auftrag, die Ehe zwischen Sara und Tobias in die Wege zu leiten, und das Thema ist dann sowohl in Tob 6,10–18 als auch in Tob 7 und 8 mit den Elementen „Brautwerbung“ und „Vertreibung des Dämons“ beherrschend. Mit den Feierlichkeiten beim Mahl nach der Eheschließung findet der Spannungsbogen einen ersten Abschluss (8,19–21; 9,6). In Tob 11,17f. folgt die Hochzeitsfeier in Ninive; hier verbindet sich das Motiv mit dem der Heilung Tobits. Einen Rückblick auf die Brautfindung enthält die Rede des Tobias in Tob 12,3.
Die Vorschrift der Endogamie dient sowohl der gruppeninternen Kohäsion und Stabilisierung als auch der Abgrenzung nach außen. Dadurch kommt dieser Regelung insbesondere dann ein großes Gewicht zu, wenn eine Gruppe sich durch die (entweder reale oder imaginierte) Übermacht einer anderen Gruppe in ihrer Existenz als gefährdet empfindet. Das Gebot kann aber auch in einem erbrechtlichen Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen (siehe zu 3,15). Die Ablehnung von Eheschließungen mit Nichtisraeliten war in frühjüdischer Zeit ein wichtiges Thema, wie es insbesondere die Debatte in Esr 9–10 und Neh 13 belegt. Im Vergleich mit diesen Texten, die auf ein Verbot der Ehe mit Frauen aus anderen Völkern wie den Moabitern oder Ammonitern zielen, erfolgt hier eine Fokussierung auf eine sippeninterne Endogamie (so auch in den Erzelternerzählungen z. B. Gen 20,12 sowie Gen 24; 27,46; 28,1–2.6f. in Abgrenzung von den „Töchtern Kanaans“; siehe zu 4,12f.).74
Neben der Ehe von Tobias und Sara ist auch die Ehe von Tobit und Hanna Gegenstand der Erzählung, allerdings werden hier v. a. Konflikte geschildert: Der Streit mit Hanna führt Tobit in eine Lebenskrise (2,11–14), wohingegen er in Tob 5,18–22 seine über die Abreise des Sohnes verzweifelte Frau zu trösten versucht. Hannas Sorge um den Sohn ist auch Thema der Szene in Tob 10,1–7a. Wie bereits in der Gesprächsszene in Tob 5,18–22 versucht Tobit seine Frau zu beruhigen (vgl. insbesondere die Wendung „Hab keine Sorge; er ist wohlbehalten“ in 5,21); während Tobit in Tob 5,18–22 aber erfolgreich ist und seiner Frau Trost zusprechen kann, will ihm dies später nicht gelingen. In Tob 10,1–7a findet sich der dritte und letzte Konflikt zwischen den Eheleuten.75
Toragehorsam und göttliche WeisungenEinzelne Handlungsweisen werden als Realisierung des Mosegesetzes verstanden, dem eine wichtige Autorität in der Erzählung zukommt.76 Die explizite Rede vom „Gesetz des Mose“ (νόμος Μωσῆ) hat zwei Haftpunkte, nämlich die sippeninterne Endogamie (6,13.16; 7,10–13; siehe zu „Ehe und Hochzeit“) sowie die Wallfahrt nach Jerusalem (siehe 1,6.8; siehe zu „Exil vs. Jerusalem“).77 In diesem Kontext steht das „Gesetz des Mose“ also in einem kultischen Zusammenhang. Bemerkenswert ist, dass mit Debora, Tobits Großmutter, eine Frau in der Unterweisung Tobits aktiv ist.78
Aber auch weitere Verhaltensideale bzw. konkrete Handlungen werden mit dem göttlichen Gebot in Verbindung gebracht (allerdings ohne Rekurs auf den Terminus νόμος). Über den Begriff ἐντολή erschließt sich der Bezug zur Weisheitsrede Tobits in Tob 4, insofern hier explizit dazu aufgefordert wird, nicht von den Geboten Gottes abzuweichen (ἐντολή; 4,5), und die Mahnung, der Gebote zu gedenken, diese Liste von einzelnen Unterweisungen auch abschließt (ebenfalls ἐντολή; 4,19). So wird der Gebotsgehorsam geradezu zum Überbegriff für die einzelnen Anweisungen in Tobits Abschiedsrede, die neben dem Endogamiegebot v. a. Taten der Barmherzigkeit umfassen. Indem Tobit als Sprecher dieser Sentenzen erscheint, tritt er als Lehrer des göttlichen Gebotes auf.
Schließlich sei noch auf die Begrifflichkeit vom „Gedenken Gottes“ verwiesen, die synonym mit dem Gebotsgehorsam gebraucht werden kann (siehe 4,5). Sie wird auch im Hinblick auf Tobits Beachtung der Speisegebote benutzt (1,11f.) und kann sogar in eschatologischer Perspektive erscheinen, wenn die Kinder Israel, die „Gottes in Wahrheit gedenken“, nach Jerusalem versammelt werden (14,7). Neben einer kultischen Perspektive auf das Gebot wird dessen soziale Dimension deutlich in den Vordergrund gestellt. Dahinter liegt das Potential, auf eine gottgemäße Lebensordnung zu verweisen, die sich unter der Bedingung einer tempellosen Existenz, z. B. in der Diaspora, verwirklichen lässt. Da der fromme und verzweifelte Tobit, der nach Gottes Weisungen lebt, Gott um Hilfe gebeten hat (3,3), entsteht ein reziproker Zusammenhang zwischen dem Erfüllen des göttlichen Gebots und der Zuwendung Gottes. Da das Motiv sowohl Teil der Narration als auch der Paränese ist, erfolgt auch hier wiederum eine Verbindung der beiden Bereiche.79
Gebete und LobpreisGebete und Lobpreis Gottes bilden ein weiteres Leitmotiv innerhalb der Erzählung, wobei eine klare Linie festzustellen ist. Zunächst finden sich mit dem Gebet Tobits (3,2–6) und dem Gebet Saras (3,11–15) sowie dem der beiden Brautleute (8,5–8) Bittgebete, die auch – so im Falle der Gebete Tobits und Saras in Tob 3 – Klageelemente enthalten können. Im Anschluss an die unbeschadet überstandene Brautnacht kennt die Erzählung nur noch Hymnen (8,15–17; 11,14f.; 13,1–18). Zudem finden sich auch kurze Erzählnotizen über den Lobpreis Gottes (so 11,15.17; 12,22; 14,2.15). Da die Geschichte damit endet, dass Tobias vor seinem Tod Gott wegen des Untergangs Ninives preist, wird die Bedeutung dieses Motivs besonders deutlich herausgestellt (14,15). Diese Handlungselemente vom Loben Gottes werden durch paränetische Abschnitte in den Reden unterstrichen, insofern sowohl die Weisheitslehre Tobits (4,19) und die Abschiedsrede des Engels (12,6f.11.17f.20) als auch das Testament Tobits (14,8.9) zum Lobpreis Gottes auffordern.
Durch intratextuelle Bezüge entstehen weitere Bedeutungsdimensionen: So bestätigt der Engel die Relevanz des Gotteslobs gleichsam von einer höheren, transzendenten Ebene aus. Wenn Tobias Gott lobt, erweist er sich als gehorsamer Sohn, der die väterlichen Ermahnungen bzw. die des Engels befolgt. Schließlich wird durch die Anweisungen zum Lobpreis dieses Element insofern verstetigt, als nun Tobias (Adressat in 4,19 und bei der Rede des Engels) sowie dessen Kinder (14,8.9) zum Gotteslob aufgefordert werden. Zudem verkündet Tobit das künftige Lob der kommenden Generationen (13,11) und des Neuen Jerusalem (13,18). Indem der Sohn Tobias auch den Lobpreis Gottes anstimmt (11,15; 14,15), zeigt er, dass sich diese Dimension tatsächlich erfüllt. Diese Belege verdeutlichen zudem, dass die einzelnen Elemente des Lobpreises eine Dynamik zu einer Erweiterung der Zuhörerschaft bzw. des Chores enthalten: Nach seiner Heilung zieht Tobit mit seinem Lobpreis durch die ganze Stadt (11,6); in seinem Hymnus spricht er dann alle Völker an (13,6; siehe auch 13,11.18). Damit wird die gesamte Erzählung von einer dialogischen Struktur zwischen Gott und Mensch geprägt. Durch den Bezug zwischen dem anfänglichen Bittgebet und dem Hymnus am Ende des Buches wird die Figur des Tobit geradezu paradigmatisch für die Bewegung von der Not zur Freude, die ihren Grund in Gottes Heilungs- und Rettungshandeln hat, mit dem Gott auf die Gebete der Menschen antwortet.80
FreudeEng verbunden mit dem Lobpreis ist die Begrifflichkeit „Freude“ bzw. „sich freuen“ (χαρά/χαίρω). Während der Anfang der Erzählung durch das Fehlen dieses Wortfelds gekennzeichnet ist, erscheint es mit dem Auftauchen des Engels in der Welt der Protagonisten zum ersten Mal. Der Engel begrüßt Tobit hier mit dem Wunsch, dass er viel Freude erleben möge. Dieser aber verweist explizit darauf, dass er in seinem Leben wegen seiner Erblindung eben keine Freude mehr habe (5,10). Diese Begrifflichkeit durchzieht dann die gesamte Erzählung: So erscheint sie mit dem Reisewunsch des Vaters an seinen Sohn (5,14: „Freudig mögest du ziehen“), bei der Ankunft von Tobias und seinem Reisebegleiter bei Raguël (7,1), als Wunsch Ednas an ihre Tochter Sara vor der Hochzeitsnacht (7,17), beim Abschied Tobias’ von seinen Schwiegereltern und dem Beginn seiner Heimkehr (10,13), beim Lobpreis des Tobias über die Heilung des Vaters und die geglückte Reise (11,15.16), bei der Begrüßung Saras in Ninive (11,17) und bei den Hochzeitsfeierlichkeiten mit den Bewohnern der Stadt und dem Erscheinen von Achikar und Nadab (11,17–18). Aber nicht nur im privaten Leben der Protagonisten spielt die Freude eine große Rolle; sie ist auch ein Element, das für das gesamte Volk Bedeutung hat, insofern sie aufs Engste mit der Erwartung des Neuen Jerusalem verbunden ist (vgl. 13,10.14; 14,7). Schließlich freut sich Tobias noch vor seinem Tod über den Untergang Ninives. Dies ist keine Schadenfreude, sondern eine Reaktion auf ein Ereignis, das ein Zeichen dafür darstellt, dass Gottes Heilsplan (vgl. 14,4–7) in Erfüllung geht (14,15 – der letzte Vers des gesamten Buches!).
SpeisenAuch das Motiv des Speisens kann als ein Leitmotiv angesehen werden. Die Form der Speisen spiegelt in gewisser Art und Weise die Stimmung innerhalb der Handlung und charakterisiert auch die Figuren. Insbesondere das Motiv der Speisung der mitexilierten Landsleute ist eng mit der Handlung verbunden, insofern es als Auslöser für eine Reihe von Ereignissen dient, die zu Tobits Blindheit, seiner Isolation und schließlich zu seiner Todesverzweiflung führen (2,1b–3,6).81 Als weitere Elemente sind zu nennen: Tobit gibt den zweiten Zehnten (der erste Zehnt ist für die Priester bestimmt) jedes dritte Jahr den Waisen, Witwen und Proselyten und verzehrt diesen gemeinsam mit ihnen in Jerusalem in Entsprechung zur Tora des Mose (1,6–8); als er dann im Exil ist, hält er von den Speisen der Völker Abstand (1,10f.). Somit macht sein Umgang mit den Speisen deutlich, dass er sich dem göttlichen Gebot gegenüber konform verhält. Insofern Tobit die Bedürftigen seines Volkes mit Nahrung versorgt, zeigt sich auch seine Barmherzigkeit (1,17; 2,2f.). Wegen der Not seiner Landsleute verzichtet Tobit auf das Festmahl und nimmt – nachdem er einen noch unbestatteten Toten versteckt hat – sein Brot „mit Trauer“ und unter Tränen ein (2,5.7). Die Gabe von Speisen an die Bedürftigen ist auch integraler Bestandteil seiner Lebenslehre (4,16f.). In der Szene mit dem Fisch scheint Tobias selbst in eine Speise verwandelt zu werden, aber dank des beherzten Eingreifens des Engels kehrt sich die gesamte Konstellation um und der Fisch wird nun zur Wegzehrung (6,3–6). Eine wichtige Rolle spielt das Motiv einer gemeinsamen Mahlzeit im Kontext der Brautwerbung: Nach dem Empfang bei Edna, Raguël und Sara schlachten die Gastgeber einen Widder (7,9a); bevor das Mahl aber stattfindet, verhandeln Raguël und Tobias über die Verheiratung (7,9b–13). Mehrmals fordert Raguël dabei Tobias zum Essen auf (7,10.11); Tobias will aber erst etwas zu sich nehmen, wenn die Angelegenheit der Eheschließung entschieden ist (7,11). Im Anschluss an das Mahl kann die Hochzeitsnacht beginnen (8,1). Nach der erfolgreich verlaufenen Hochzeitsnacht, bei der der Dämon vertrieben werden konnte, findet das üppige Antrauungsmahl statt (8,19), zu dem dann auch Gabaël hinzustößt (9,6). Schließlich erscheint das Motiv auch in der Rede des Engels, nun aber unter umgekehrtem Vorzeichen, wenn dieser betont, dass er nur zum Schein gegessen habe (12,19).
Dunkelheit und LichtAuch die Opposition von „Dunkelheit“ und „Licht“ kann als Leitmotiv genannt werden, wobei es bemerkenswert ist, dass dieses Motiv den Rahmen und die Kernhandlung umspannt. Der erblindete Tobit liegt in der Finsternis des Totenreiches und vermag das Licht Gottes nicht mehr zu schauen (5,10); Almosengeben aber – so die weisheitliche Sentenz – lässt nicht in die Finsternis eingehen (4,10). Tobias kann als Licht für seine Eltern bezeichnet werden (10,5; 11,14), und am Ende schaut der alte Tobias auf die künftige Gottesstadt Jerusalem mit ihrer Lichtherrlichkeit (13,11; siehe auch 13,16f.). Dass das Licht mehr als eine physische Qualität hat, wird auch deutlich, wenn im Hinblick auf Achikars positives Schicksal gesagt werden kann, dass er „ins Licht“ hinausging (14,10). Diese einzelnen Motive lassen sich kohärent miteinander verbinden, und so wird im Hinblick auf die Gesamterzählung ein Spannungsbogen aufgebaut. Dieser führt von Tobits Blindheit – also der Finsternis – über das Tun der Barmherzigkeit und Tobits Heilung zum Wiedererblicken des geliebten Sohnes Tobias und zur Hoffnung auf die Lichtherrlichkeit Jerusalems.82