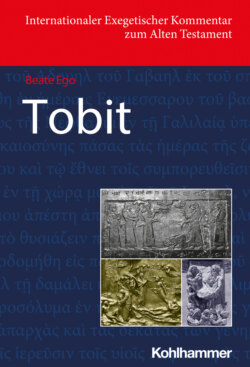Читать книгу Tobit - Beate Ego - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erzählstil
ОглавлениеFür den Großteil der Geschichte ist der Stil szenischen Erzählens, der vor allem aus kürzeren Dialogen besteht, vorherrschend. Durch dieses Stilmittel kommen Erzählzeit und erzählte Zeit oft zur Deckung und so wird die Leserschaft schnell in die Handlung hineingenommen. Darüber hinaus enthält die Erzählung aber auch längere Redeeinheiten (3,1–6; 4,3–21; 12,6–20; 13,1b–18; 14,3–11).27 Die Rahmenteile Tob 1,3–22 und 14,1–15 haben eher summarischen Charakter, insofern hier ein weit gespannter Rückblick auf Tobits Leben gegeben wird. Auffällig ist der Erzählerwechsel. Das Buch beginnt nach der Überschrift (1,1–2) mit der Ich-Erzählung des alten Tobit (ab 1,3) und wechselt dann, wie es der Stoff erfordert, mit der Geschichte der Sara in die 3. Pers. (3,7). Diese Perspektive wird bis zum Buchende beibehalten. Man hat überlegt, diesen Wechsel literarkritisch zu erklären (siehe unten Diachronie), allerdings kongruiert der Erzählerwechsel nicht mit gängigen literarkritischen Modellen. Außerdem kennen auch andere frühjüdische Erzählungen (so Esr, Neh, GenAp) einen solchen Wechsel der Erzählperson.28
Wenn ab Tob 3,7 einerseits ein Erzähler spricht, der einen deutlichen Wissensvorsprung gegenüber seinen Figuren hat, und andererseits auch häufig – durch den szenischen Erzählstil – die Figurenstimmen zu hören sind, die von den metaphysischen Hintergründen des Geschehens zunächst ja noch nichts wissen, so zeigt die Geschichte insgesamt eine ironische Komponente – so insbesondere, wenn von der Begleitung eines „guten Engels“ (vgl. 5,22) die Rede ist. Vor allem die Kernerzählung Tob 2–12 enthält solche Momente, zu denen auch die Episode vom Ausheben des Grabes während der Hochzeitsnacht gehört (8,9f.).29
Die Erzählung weist eine ganz besondere Art der Spannung auf, die man als „anticipatory suspense“ bezeichnet hat. Im Gegensatz zur „suspense of uncertainty“, bei der der Ausgang der Ereignisse tatsächlich noch offen erscheint, ist ab Tob 3,16–17 mit der Nachricht von der Entsendung des Engels klar, dass die Geschichte mit der Heilung Tobits und Saras enden wird. Offen – und auch das erzeugt natürlich wieder Spannung – bleibt allerdings, wie dies im Einzelnen geschehen soll, und die Kunst des Erzählers besteht dabei nicht zuletzt darin, die beiden Lebensfäden von Tobit und Sara miteinander zu verknüpfen.30
Typisch für die Erzählweise des Buches ist es auch, bestimmte Ereignisse, die sich zeitgleich zutragen, nebeneinander zu stellen. Das beste Beispiel hierfür ist die „Parallelschaltung“ der Geschicke Tobits und Saras, die beide in ihrem jeweiligen Gebet kulminieren (1,3–3,6; 3,7–15) und die mit der Entsendung des Engels zusammengeführt werden (3,16f.). Darüber hinaus wird auch von der Hochzeitsnacht sowohl in der Innen- als auch in der Außenperspektive erzählt (8,1–18), und schließlich thematisiert Tob 10,1–13 die Heimkehr Tobias’ sowohl aus dem Blickwinkel seiner Eltern als auch aus dem der Brauteltern. Die kunstvolle Verflechtung der verschiedenen Erzählstränge sowie ihre Zusammenführung können als Stilmittel verstanden werden, das die göttliche Führung des Geschehens zum Ausdruck bringt.31 Sehr gerne gibt der Erzähler auch einen Einblick in die Gefühlswelt und die Emotionen der Protagonisten und bietet somit in rezeptionsästhetischer Hinsicht das Identifikationspotential, das der Leserschaft die mentale Partizipation an dem Geschehen ermöglicht.32